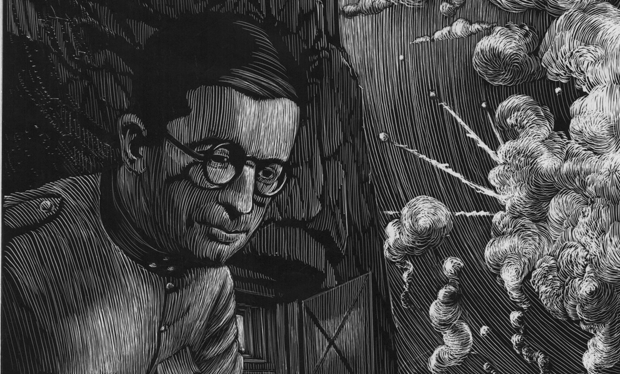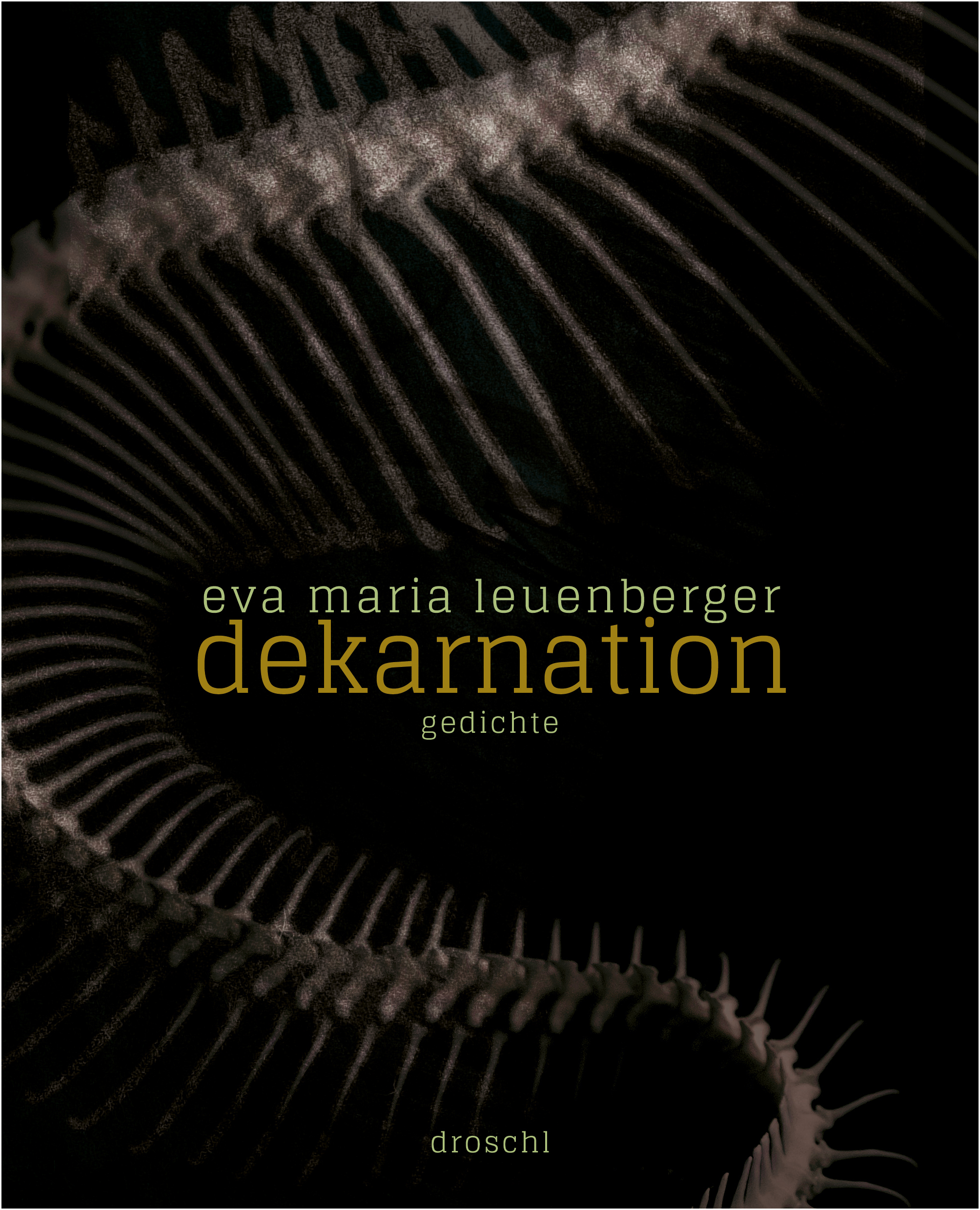Madame Robovary und Tron Quijote
Wenn Jules Verne, Aldous Huxley und der Traum vom ewigen Leben zusammenfinden, ist der Physiker und Philosoph Marc Atallah nicht weit. Besuch im einzigen Science-Fiction-Museum der Schweiz.

Marc Atallah, Sie leiten das Museum «Maison d’Ailleurs – Musée de la science-fiction, de l’utopie et des voyages extraordinaires» in Yverdon – ein nicht nur schweizweit einzigartiges Museum im Zeichen von Science-Fiction und Utopie. Ein wichtiger Bestandteil des Museums ist die Jules-Verne-Bibliothek. Beginnen wir mit ihm: Wie stark hat Jules Verne das Genre Science-Fiction geprägt?
So gut wie gar nicht.
Wie bitte? Den Franzosen gilt er als «Erfinder» der Science-Fiction!
Aber keiner seiner Romane ist Science-Fiction, bis auf einen vielleicht, «Paris im 20. Jahrhundert». Der wurde 1864 geschrieben, von Vernes Verleger aber abgelehnt. Er fand die Zukunftsvision zu negativ. Das Manuskript wurde erst 1989 wiederentdeckt. Alle anderen Werke, ob «Fünf Wochen im Ballon» oder «20 000 Meilen unter dem Meer», sind streng genommen keine Science-Fiction.
Sondern?
Abenteuergeschichten.
Warum widmet das Museum ihm dann trotzdem einen Saal?
Weil es sein Vermächtnis an die Science-Fiction ist, das allgemeine Interesse an Wissenschaft und Technik gefördert zu haben. Bei ihm erfahren wir viel über verwendete Technologien – U-Boote, Ballons, Helikopter –, aber nicht viel über die Figuren. Die Maschinen, so könnte man zuspitzen, waren ihm wichtiger als die Menschen. Verne fasste die Wissenschaft seiner Zeit zusammen und popularisierte sie. Aber: nichts, was in Science-Fiction-Geschichten beschrieben wird, ist jemals wirklich wissenschaftlich. Es sieht bloss so aus. (lacht)
Dazu kommen wir später noch. Wenn nicht Verne – wen sehen Sie dann am Anfang des Genres?
H. G. Wells. Er begründete Science-Fiction-Narrative, die wir heute noch lesen: Sei es die «Zeitmaschine» oder den «Krieg der Welten». Die meisten amerikanischen Sci-Fi-Autoren der 20er und 30er, die das Genre weiter popularisierten, waren von ihm inspiriert.
Aus dem angelsächsischen Raum schwappte also die Bewegung nach Zentraleuropa?
Genau. Dabei war sie im französischen Sprachraum erfolgreicher als im deutschen.
Das gilt bis heute und auch für die Schweiz: In der Romandie ist das Genre deutlich populärer als in der Deutschschweiz. Warum?
Es gibt Leute, die behaupten, dass der alte germanische Mythos der Grund dafür sei, dass im deutschsprachigen Raum Fantasy – das ganze Tolkien-Ding etwa – populärer war und geblieben ist als Science-Fiction. Das überzeugt mich nicht. Ich glaube, es geht vielmehr ums verlegerische Umfeld, nicht um Sprache und Mythos: Während in den USA, etwa um 1950, viele Science-Fiction-Geschichten veröffentlicht wurden, kam in Frankreich das Taschenbuch auf. Hiesige Verleger witterten gute Geschäfte mit den Übersetzungen. Science-Fiction war plötzlich multimedial präsent, weil gut verkäuflich: Bücher, Comics, Hefte, Filme, Hörspiele, später das Fernsehen, die Musik. Ich sage nur: «Ziggy Stardust». Das Genre ist Teil der Populärkultur geworden, weil Science-Fiction über andere Welten spricht, die mit unserer in Verbindung stehen. Das spricht die Leute eben an. Denn streng genommen geht es dabei nicht vorrangig um die Zukunft, die Wissenschaft oder die Technik, sondern um den Menschen in seiner Gegenwart.
Das müssen Sie ausführen.
Zukunftsvisionen und Alternativweltgeschichten dienen dazu, die Realität zu verzerren, zu hinterfragen. Uns einen Spiegel vorzuhalten. Sie sind ein guter Weg, um auf das zu schauen, was wir wissen – und darauf, wie wir damit umgehen. Science-Fiction ist ein Genre, in dem deshalb sehr viele Metaphern verwendet werden: so erschliesst man neue Wege, um menschliche Wesen zu betrachten, ihr Suchen und Streben in Wissenschaft und Technologie. Bereits im beginnenden 20. Jahrhundert bot Science-Fiction damit einen neuen Weg, über die Conditio humana zu sprechen – indem sie gebräuchliche Worte und Themen auf eine spezifisch neue Weise verwendete. Damals gab es beispielsweise Unmengen von Insekten-Romanen. Menschen beobachteten Insekten, lernten ihre Welt unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten besser kennen, et voilà: In der Fiktion fallen Insekten über Menschen her – eine typische Endzeitvision. Das heutige Pendant dazu sind Viren, Organismen, die die Forschung schon lange untersucht, um ihnen Einhalt zu gebieten – was ja auch immer besser funktioniert. Pandemien tauchen momentan in gefühlt jedem zweiten Zukunftsszenario in Literatur, Film und so weiter auf. Es ist sogar schon so weit, dass der Mensch selbst als «Virus» bezeichnet wird – denken wir nur an «Matrix».
Man kann also im Rückblick aus Science-Fiction-Texten vor allem ableiten, in welcher Zeit sie entstanden sind und welche Ängste damals herrschten?
Bis zu einem gewissen Punkt ja. Unter dem Label «Science-Fiction» werden dabei ganz verschiedene Dinge subsumiert. Ich würde deshalb klärend einmal folgende Definition vorschlagen: Science-Fiction ist die rationale Extrapolation der Gegenwart, egal ob sie in ferner Zukunft spielt – oder schon übermorgen. Dabei spielt die «Verzauberung» wissenschaftlicher Erkenntnisse, aktueller Technologien oder Entwicklungen mit literarischen Mitteln eine zentrale Rolle. Denn: wir haben eine Realität, die ohne erfundene Sprachen, ohne Narrative nicht erfasst werden kann.
Können Sie das an einem Beispiel erklären?
William Gibson! Er war einer der Begründer des Cyberpunk und hat in «Neuromancer» etwas ausgedrückt, was im Erscheinungsjahr 1984 ungeheuer neu war…
Sie sprechen vom «Cyberspace»?
Genau. Aber nicht den, den wir heute kennen! Gibsons eigens erfundene Sprache dient nicht primär dazu, über Computer zu sprechen, sondern sie zeigt auf, dass die Menschen schon immer versuchten, ihren Körpern in einen virtuellen Raum zu entkommen. Der virtuelle Raum ist also auch nicht derjenige der Informatik, sondern der Traum des Eskapismus vom eigenen Körper. «Neuromancer» zeigte, was es in den 1980er Jahren bedeutete, ein Mensch zu sein. Zusammenfassend kann man sagen: Science-Fiction bedient sich der Sprache von Wissenschaft und Technik, um damit über die menschliche Natur zu sprechen…
… und den kritischen Blick auf die Welt zu schärfen?
Ja. Die reale Welt, so der Psychoanalytiker Jacques Lacan, kann nämlich unmöglich an sich verstanden werden. Man muss Symbole zwischen sich und sie stellen. Wir übertragen also Sci-Fi-Szenarien auf unsere Welt und sehen sie in der Folge anders. Bestenfalls.
Warum neigt zeitgenössische Science-Fiction eigentlich so sehr zum Pessimismus, zur Dystopie?
Die Dystopie gewann ab den 1920ern an Popularität, etwa mit «Wir» von Jewgeni Samjatin. 1932 folgte Aldous Huxleys «Schöne neue Welt» und 1948 George Orwells «1984». Der Hang zur Dystopie ist also keine neue Erscheinung. Und dass diese Werke ein grösseres Publikum erreichen, ist einfach zu erklären: Weil niemand Utopien lesen will. Sie sind langweilig. Richtig langweilig.
Ach ja? Wo doch sogar der gute Huxley eine Utopie, den Roman «Eiland», geschrieben hat…
… den kaum jemand kennt, während fast alle «Schöne neue Welt» kennen. Erfolgreiche Fiktionen steuern immer auf eine Katastrophe zu. Auch und vor allem im Genre der Science-Fiction, das sich eben mit möglichen «Zukünften» vor dem Hintergrund technologischer Entwicklungen und ihrer Bedrohungspotentiale beschäftigt.
Haben Sie darum theoretische Physik, Literatur und Philosophie studiert – um diese Verknüpfungen nachvollziehen zu können?
Ich las schon im Gymnasium viel über Einstein, der auch eine mässig gute Geige fiedelte. Oder über Heisenberg, der Kant las. Ich fragte mich, warum so viele Leute das Naturwissenschaftliche und das Geisteswissenschaftliche zu trennen versuchen. Kreativität beschränkt sich doch weder auf die eine noch auf die andere Sphäre. Ich habe nie verstanden, warum diese Domänen getrennt werden. Es ist unmöglich, ohne Kenntnisse der Geisteswissenschaften ein guter Physiker zu sein. Oder umgekehrt.
Wie wichtig ist Kreativität in den Naturwissenschaften?
Autoren sind an Menschen interessiert. Wissenschafter an Phänomenen. Science-Fiction-Autoren bringen beide Interessen zusammen: sie interessieren sich für Menschen, wissen aber, dass die Wissenschaft den Menschen formt. Es ist heute unmöglich, den Menschen zu verstehen, ohne zu verstehen, dass ein iPhone mehr ist als nur ein iPhone. Es ist eine Erweiterung von mir selbst. Darum gefällt mir auch Michel Houellebecqs Werk so gut: weil er nicht nur Science-Fiction schreibt, sondern vor allem begreift, dass sich der Mensch in den Schnittmengen zwischen Technik, Wirtschaft und Wissenschaft bewegt.
Heute reden ja alle vom «Second Machine Age» – also davon, dass Roboter uns unsere Jobs wegnehmen. Welchen Änderungen war das Image von Robotern in den letzten Jahren unterworfen?
Wir haben schon immer Maschinen gebaut, die für uns die Dinge erledigen, die wir selbst nicht tun wollen. Bereits seit der Antike haben wir Tiere eingesetzt, um uns die Landwirtschaft zu erleichtern. Trotzdem hat sich nie jemand beklagt, dass ihm ein Tier den Job wegnimmt. Denn: Es ist ja auch gar nicht der Roboter, der mir den Job wegnimmt! Roboter haben keinen Willen, keine Absichten, keine Moral. Sie sind nur Maschinen. Auf Tschechisch bedeutet «robota» «Frondienst» oder «Zwangsarbeit», auch «Arbeit» allgemein. Der Schriftsteller Josef Čapek prägte den Begriff neu für künstlich gezüchtete Arbeiter – eine Wortschöpfung, die sein Bruder Karel 1920 erstmals in seinem Theaterstück «R.U.R. – Rossum’s Universal Robots» verwendete: massenhaft in riesigen Wassertanks hergestellte Arbeiter, die den Menschen in der Industrie helfen sollten, dann aber gegen sie aufbegehrten…
Neuerlich gehen wir noch einen Schritt weiter und versuchen, selbst Roboter zu werden: Wir träumen den Traum des Transhumanismus, der Prothesen und der Medizin, den Traum der Überwindung der Gebrechen des menschlichen Körpers durch technologische Innovation. Wann wird das «Maison d’Ailleurs» eine transhumanistische Abteilung eröffnen?
Niemals. Transhumanismus ist nichts als Marketing, verbrämt als spirituelle Bewegung. Das Problem vieler Transhumanisten ist, dass sie die Metaphern der Science-Fiction wörtlich nehmen. Sie versprechen: «Wir entwickeln Nanoroboter, die deine zerstörten Zellen wieder aufbauen…» – Dumm nur, dass wir nicht wissen und nicht wissen können, ob es jemals möglich sein wird! Transhumanisten ficht das nicht an. Sie ähneln Madame Bovary oder Don Quijote und glauben, dass das, was in den Büchern steht, heute oder morgen auch im echten Leben geschehen wird.
Die Fiktion des ewigen Lebens als zum Scheitern verurteilter Masterplan für die Gegenwart?
Ja! Die Menschen wollten immer schon unsterblich werden, nicht erst seit «Doktor Faustus». Ich glaube zunächst einmal nicht, dass der Mensch ewig leben wollen würde. Wir lieben die Unsterblichkeit nur, solange wir sterblich sind. Und dann: Der wichtige Unterschied zwischen solchen populären Unsterblichkeitsmythen und dem Transhumanismus ist, dass letzterer uns weismachen will, dass sich erstere mittels Technik umsetzen lassen. Und das wird nicht der Fall sein.
Was macht Sie da so sicher?
Die Europäische Raumfahrtagentur ESA und ihr Forschungsprogramm. Sie hat vor wenigen Jahren mit dem «Maison d’Ailleurs» zusammengearbeitet. Wir haben gemeinsam untersucht, ob technologische oder wissenschaftliche Durchbrüche in der Science-Fiction «vorweggenommen» wurden, und fanden heraus, dass sich in der langen Geschichte der Science-Fiction nichts findet, das der Raumfahrtagentur vorab hätte helfen können.
Gar nichts?
Nun ja, Arthur C. Clarke, der Autor von «2001: Odysee im Weltraum» hat eine technische Innovation vorweggenommen: die Einführung eines Systems geostationärer Meteosatelliten. Allerdings war er auch beruflich als Ingenieur an der Entwicklung dieser Satelliten beteiligt. Sie sehen: Man kann sich eben nichts vorstellen, was noch in gar keiner Form existiert.