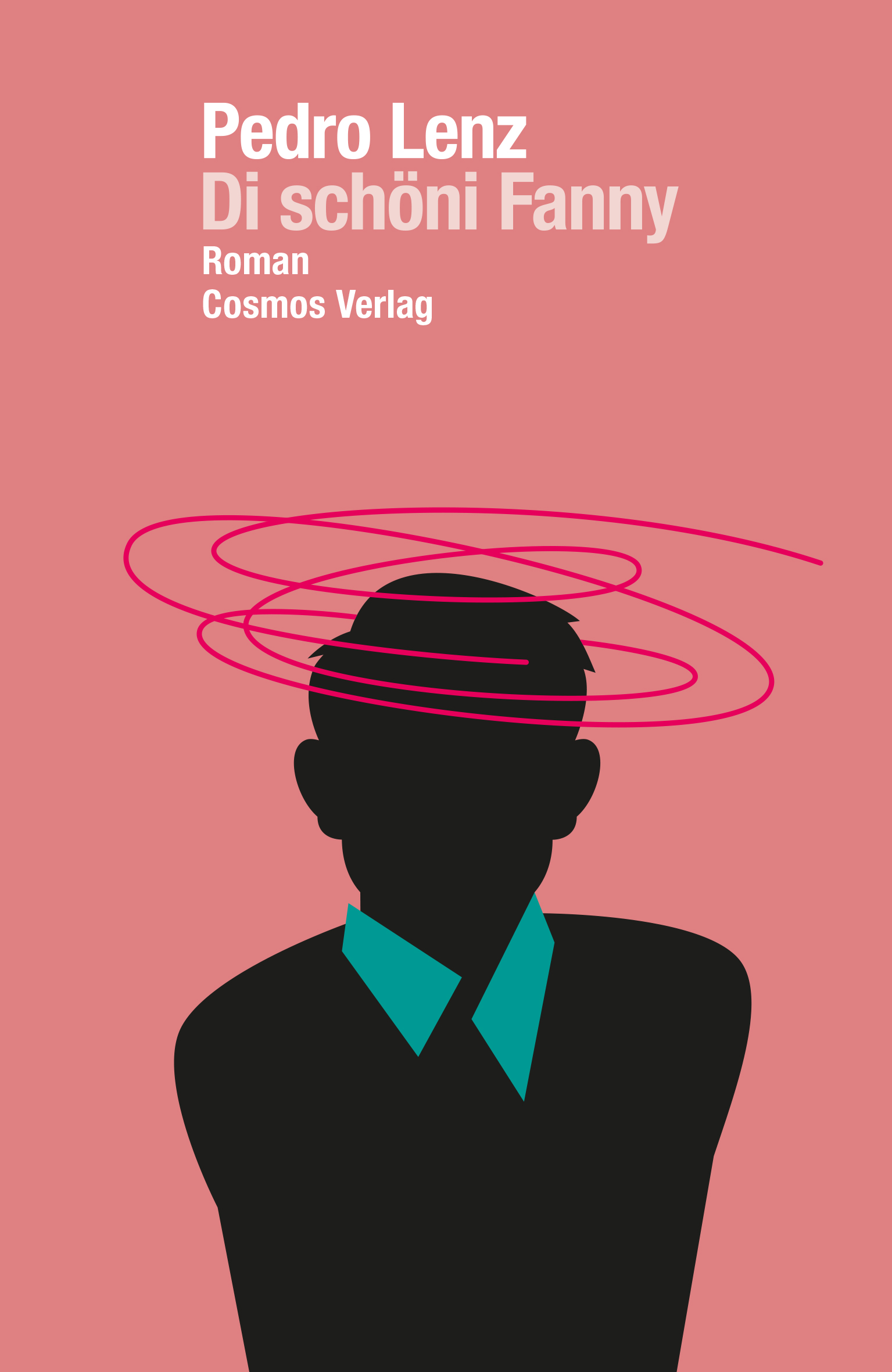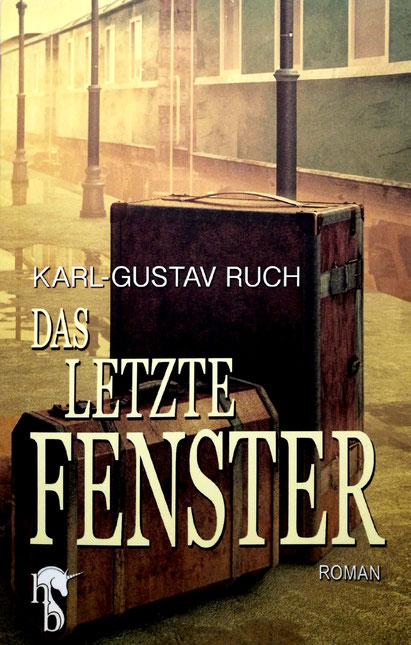Gesellschaftskritik als Groteske
Der Lausanner Quentin Mouron hat mit 30 Jahren schon sechs Romane veröffentlicht. Im französischen Sprachraum gefeiert, ist er hierzulande fast unbekannt. Ein Gespräch über das Groteske, den Roman noir und den Vorteil daran, unter dem Radar zu laufen.

Quentin, in deinem aktuellen Roman «Vesoul, le 7 janvier 2015» bricht in einer französischen Kleinstadt das Chaos aus – in Vesoul eben. Und dann trifft auch noch die Nachricht ein, dass die Redaktion von «Charlie Hebdo» von Terroristen angegriffen wurde. Warum hast du deine Geschichte gerade in dieser wenig glamourösen Stadt angesiedelt?
Warum Vesoul? Ehrlich gesagt spielt der Ort eine untergeordnete Rolle. Der Roman hätte fast in jeder Stadt spielen können. Hauptsache eine, die die meisten Leser nicht kennen, oder zumindest nicht gut.
Warum das? Sind «Otto-Normalverbraucher-Städte» in der Provinz besser geeignet, gesellschaftliche Entwicklungen zu erzählen?
Genau um das Zusammenleben der Menschen untereinander geht es mir – wie es scheitert und gelingt. Ich wollte den Roman so situieren, dass ich möglichst vermeiden kann, dass nachher nur über den Ort der Handlung gesprochen wird. Über den Inhalt meiner Bücher diskutiere ich gerne und jederzeit, auch mit kritischen Lesern. Nicht so grosse Lust habe ich auf Diskussionen darüber, ob ich auf Seite 57 diesen oder jenen Brunnen meine und ob ich die Farbe seiner Patina richtig beschrieben habe. Ich will keinen Roman über Paris und auch nicht über Vesoul schreiben, sondern darüber, wie Menschen miteinander umgehen. Eine weitgehend unbekannte Stadt wie Vesoul – viele Franzosen kennen nur das gleichnamige Chanson von Jacques Brel – ist die bessere Wahl als Paris oder Marseille, um den Fokus darauf zu lenken.
Könnte dein Vesoul auch in der Schweiz liegen, in der Deutschschweiz sogar?
Durchaus, warum nicht. Aber auch das hätte nicht unbedingt besondere Implikationen.
Interessiert es dich denn persönlich, Literatur aus bestimmten Kulturen zu lesen, oder Literatur, die an bestimmten Orten spielt? Konkret – unser Thema in diesem Heft ist der literarische Röstigraben: Hast du einen Deutschschweizer Lieblingsschriftsteller?
Ich habe viel Dürrenmatt gelesen – zunächst aus den falschen Gründen, in der Schule, wo er natürlich zur Pflichtlektüre gehörte. Ich war richtig schlecht in Deutsch und habe mich ganz schön mit ihm abgemüht, es war wirklich ein Alptraum. Zum Glück habe ich mich dann nach meinem Studium noch einmal intensiv mit ihm beschäftigt, dann nicht mehr nur viel, sondern auch sehr gern. Mein Lieblingsschriftsteller aus der Deutschschweiz ist aber wohl Friedrich Glauser.
«Scheint nicht gerade in der Übertreibung die Wahrheit manchmal deutlicher durch?»
Von dem hatte ich noch nie gehört, bis ein Buchantiquar in Lausanne ihn mir empfahl und mir dann nach und nach alle Bücher auf die Seite gelegt hat. Ansonsten lese ich schon am liebsten französischsprachige Autoren, da kann ich einfach mehr lernen – ich vergleiche mich sehr gern mit den grossen Stilisten aller Art.
Was genau hat dich an Glauser so fasziniert?
Vor allem seine Originalität. Die Analyse menschlicher Beziehungen ist extrem raffiniert, fein und präzise, ich habe in diesem Sinn etwas gefunden, das ich auch bei Simenon mag. Aber Glauser ist realistisch mit einer offenen Flanke für das Verrückte, für den menschlichen Wahnsinn. Ich erinnere mich an seitenlange, grosse Monologe von Menschen im totalen Delirium. Wie ein exzentrischerer, entfesselter Simenon. Mir hat das wahnsinnig gefallen.
Deine Bücher werden, wie u.a. auch die eines weiteren Lausanners, Joseph Incardona, als «Roman noir» vermarktet. Was soll das eigentlich genau sein?
Ach, das weiss ich auch nicht so genau, es ist auch kein Label, das ich selbst benutze. Ich habe kein Problem damit, meine älteren Romane als «Polars», als Kriminalromane, zu bezeichnen – bei Vesoul liegt das Ganze nun etwas anders, hier gibt es weder einen Detektiv noch einen zu lösenden «Fall».
Die Bezeichnung «Roman noir» als Abgrenzung zum Krimi als populäres, aber von der Kritik ungeliebtes Stiefkind? Ich dachte, diese Unterscheidung von hoher, ernster Literatur einer- und «nur» Unterhaltung andererseits sei eine rein deutschsprachige Diskussion.
Nein, nein, der Polar ist auch im französischen Sprachraum bei der Kritik verpönt. Ein Krimi würde niemals den Prix Goncourt gewinnen – oder überhaupt einen der grossen Buchpreise. Man denke nur an die Geschichte von Georges Simenon, dessen Maigret-Romane eigentlich bis zu seinem Lebensende von der Pariser Kritik nicht richtig ernst genommen wurden.
Noch ein Versuch: «Vesoul» beginnt mit zwei Männern in einem Auto, die beiden kennen sich nicht, es ist neblig, der Fahrer ist dem Ich-Erzähler irgendwie unangenehm – zumindest zunächst. Vielleicht ist diese Stimmung, was mit «noir» gemeint ist?
Was meine Bücher sicher gemeinsam haben, ist, dass ich Gesellschaftsanalyse und Gesellschaftskritik – und es ist bei aller Ironie und Überzeichnung immer mein Anspruch, gesellschaftliche Realitäten zu verhandeln – bevorzugt von unten betreibe. Ich beschreibe die Welt meist über diejenigen, denen es dreckig geht, vom Bodensatz der Gesellschaft aus.
Aus der Froschperspektive.
(Mouron lacht laut und lange) «Perspective de grenouille», das ist gut, muss ich mir merken. Ja, das trifft es. Ich glaube, wie es den unteren Gesellschaftsschichten geht, erzählt uns mehr über die Welt als Erzählungen über die Reichen und Schönen. Ich habe generell sicher keine besonders optimistische Sicht auf den aktuellen Zustand der Welt, und das spitze ich in meiner Literatur bewusst eher zu, als es beschönigen zu wollen.
Also auch keine Happy Ends, nichts, das sich am Ende in Wohlgefallen und Harmonie auflöst.
Keine Happy Ends, nein. Ich würde dieses Überzeichnen des Unschönen, Schmutzigen einfach auf meine Freude am Grotesken zurückführen, und in der Tat ist die Groteske wahrscheinlich mein liebstes Stilmittel. Scheint nicht gerade in der Übertreibung die Wahrheit manchmal deutlicher durch? Aber von mir aus sollen sie es eben «Roman noir» nennen.
Mich hat das Groteske, Absurde, Lakonische gerade in «Vesoul» immer wieder zum Lachen gebracht, die Lektüre hatte für mich nichts Bedrückendes. Fast ein Roman jaune!
Oder blanc… Ja, in «Vesoul» ist auch zum ersten Mal eine meiner Hauptfiguren ein Systemgewinner, ein Finanzheini, einer aus dem obersten Prozent der Gesellschaft. Und er spielt die Karte, dass bei ihm alles möglich ist, alles von selber geht, dass ihm alles leichtfällt, knallhart aus – auch wieder bis ins Groteske verzerrt. Vielleicht sorgt das für eine hellere Stimmung.
Ob nun noir, jaune oder wie auch immer: Du bist erst 30 Jahre alt und hast bereits sechs Romane veröffentlicht, und das äusserst erfolgreich. Hast du nicht nur mit dem Publizieren, sondern auch mit dem Schreiben früh begonnen?
Ich bin mit dreizehn Jahren aus Kanada in die Schweiz zurückgezogen…
…aus Notre-Dame-de-la-Merci, einer weiteren Kleinstadt, der du einen Roman gewidmet hast…
Genau. Und wie das so ist, wenn man der Neuankömmling in der Klasse ist: Ich war lange eher ein Aussenseiter. Als es dann losging damit, den Mädchen gefallen zu wollen, merkte ich, okay, der eine spielte Gitarre, ein anderer war gut im Sport, ein dritter machte im Theater mit.
All das kam für mich leider nicht in Frage, ich war völlig unmusikalisch, nicht besonders sportlich und auch kein Schauspieler. Ich musste mir etwas anderes einfallen lassen, um zu beeindrucken, also begann ich halt, mir Geschichten auszudenken und sie aufzuschreiben.
Es hat funktioniert.
Wenn ich das so erzähle, dann natürlich mit einem Augenzwinkern, aber ein Kern Wahrheit ist dabei. Jemand sein wollen, jemand, der etwas tut, und dafür wahrgenommen werden, die ganzen Identitätsfragen der Jugend halt. Und auf diese Fragen war Schreiben für mich eine Antwort, die «funktioniert» hat, ja, eine Form, mich als Individuum auszudrücken. Ich schreibe ja immer noch – mittlerweile, ohne jemanden beeindrucken zu müssen, einfach par amour de la littérature.
Du hast gerade Kanada erwähnt. Ein Land mit einem Sprach- und Kulturgraben, der noch tiefer ist als der schweizerische Röstigraben? Diesen Eindruck hat man zumindest, wenn man das Land aus der Ferne betrachtet.
Ich muss sagen, ich betrachte Kanada heute auch vornehmlich aus der Ferne und bin nicht mehr regelmässig im Land. An feinstoff-liche kulturelle Differenzen habe ich keine genaue Erinnerung. Aber ich würde generell zustimmen: Da wird ein Graben geradezu zelebriert – obwohl die Gesellschaft zu beiden Seiten der Sprachgrenze kaum kulturelle Unterschiede aufweist, beide sind sehr amerikanisch geprägt, und jeder Québécois spricht fliessend Englisch.
Manche sagen: besser als Französisch…
(lacht) Ja, vielleicht. Jedenfalls klingt im Französischen, wie es die Québécois sprechen, das Englische sehr deutlich durch.
Nochmals zurück zu den Schweizer Sprachgrenzen. Ist es für dich ein Ziel, wäre es in irgendeiner Weise eine «wichtige» Anerkennung, in der gesamten Schweiz von einem breiten Publikum gelesen zu werden, über die Sprachgrenzen hinweg?
Ich habe interessanterweise bei Lesungen in der Deutschschweiz, aber auch bei deutschsprachigen Kritiken meiner Romane die Erfahrung gemacht, dass diese Besprechungen oft ernsthaftere oder vielleicht tiefergehende Auseinandersetzungen mit den Texten waren als die französischsprachigen. Was die Autoren herausgeschält haben, war oft auch näher daran, was jeweils meine Intention war – wenn ich denn eine hatte (lacht).
Ein Anti-Röstigraben? «Verstehen» dich deutschsprachige Leser besser?
Meine Erklärung ist eine andere: Im französischen Sprachraum habe ich das Glück, mehr oder weniger davon ausgehen zu dürfen, dass die meisten Kulturredaktionen ein neues Buch von mir besprechen werden. Dass «man Mouron bespricht», bedeutet handkehrum aber, dass dies auch Redaktoren tun müssen, für die mein neuer Roman nur ein weiteres Buch unter vielen oder überhaupt nicht nach dem persönlichen Geschmack ist. Es gibt eine Debatte, man «muss» irgendwie mitmachen, und so klingen dann auch einige Kritiken. Das soll kein Vorwurf sein – aber bei deutschsprachigen Besprechungen hat sich ein Autor oder eine Redaktion in der Regel sehr bewusst unter sehr vielen anderen Büchern für die Besprechung gerade meines Buchs entschieden. Und weil noch weniger oder gar keine Debattenpflöcke eingeschlagen sind, entstehen überdurchschnittlich oft spannende, eigenständige Auseinandersetzungen, die ich sogar selbst gern lese (lacht).
Es hat also auch seine angenehmen Seiten, etwas weniger bekannt zu sein.
Absolut! Ich lese aber auch aus einem anderen, ganz profanen Grund sehr gern in der Deutschschweiz und würde es noch so gern öfters tun: Man erhält dort für die Lesung ein angemessenes, teilweise sogar gutes Honorar, Verpflegung und oft auch Unterkunft sind selbstverständlich. In der Westschweiz ist es immer noch so, dass es oft gar kein Honorar für Lesungen gibt.
Das überrascht. Auch hier ist oft von einem kreativen Prekariat die Rede, zu dem ganz klar auch Autorinnen und Autoren gehören. Niemand würde auf die Idee kommen, das Niveau gängiger Text- oder Lesungshonorare als hoch zu bezeichnen.
Mag sein, aber glaub mir, es ist wirklich nicht zu vergleichen. In der Westschweiz wird immer noch erwartet, dass ein Schriftsteller sich gratis drei Stunden lang bei schlechter Luft an einem Samstag in einen Buchladen setzt, liest, signiert und dabei immer schön freundlich lächelt. Da fühle ich mich in der Deutschschweiz als Autor ganz anders behandelt. Also, liebe Deutschschweiz, immer her mit den Lesungen!