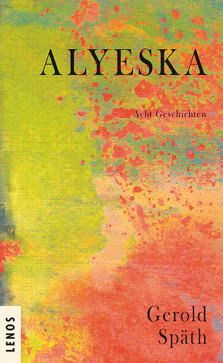Lesen Sie gerne Sexszenen?
Die Illustratorin Ulli Lust über die Unterschiede zwischen dem Zeichnen erotischer Szenen und dem Schreiben darüber.

Sexszenen gehören, wie Landschaftsbeschreibungen, zu den Stellen, die ich in Büchern häufiger überfliege als andere. Bei Landschaften wird vor allem meine Geduld strapaziert. Es braucht viele Worte, um die grossen und kleinteiligen Eindrücke aufzuschlüsseln, die, würden wir den Horizont tatsächlich überblicken, alle gleichzeitig sichtbar wären.
Die Probleme mit Sexszenen sind weitreichender, nicht immer liegen sie im Verantwortungsbereich der Autoren. Eine Landschaft sieht für uns alle ungefähr ähnlich aus, wir können sie nüchtern betrachten. Sexuelle Erfahrungen sind intim, manchmal widersprüchlich, wir haben unterschiedliche angeborene Bedürfnisse und sind zudem individuell konditioniert. Für meinen Geschmack können explizite Szenen in Texten gerne kurzgehalten werden. Manchmal ist es ein einzelner Satz, der mich in die passende Schwingung versetzt. Der die gefühlte Temperatur im Raum steigen lässt.
Das Davor und das Danach interessiert mich – in Romanen, nicht im richtigen Leben – viel mehr. Oder ist es der Logos, der beim Lesen von Worten ins Spiel kommt, der die Stimmung stört? Sexszenen in Bildern betrachte ich nämlich sehr gerne. Ich erinnere mich an viele delikate französische Comics, die ich genussvoll und langsam gelesen habe. Vielleicht stimulieren mich Bilder leichter, weil mein Sprachzentrum beim aktiven Sex nur eingeschränkt funktioniert. In diesem speziellen Bewusstseinszustand finde ich plötzlich eine vulgäre, einfache Sprache ungeheuer attraktiv. Es ist nicht nur in der Literatur eine Herausforderung, zur richtigen Zeit den richtigen Ton zu treffen. Als Bilderzählerin habe ich eine weniger grosse ästhetische Fallhöhe zu bewältigen. Erotische Bilder dürfen klassisch schön bleiben. Körperliche Schönheit und Sex sind eine natürliche Paarung. (Ich meine hier übrigens ausschliesslich Sexszenen, die von den Protagonisten als angenehm empfunden werden – «angenehm» ist wohl die zarteste Annäherung an den Rausch, der die eigentliche Gefühlslage ist.)
«Die persönliche Schamgrenze der Rezipienten
ist eine unwägbare Grösse.»
Wenn ich Sex zeichne, dann schwelge ich in Schönheit. In anderen Szenen dürfen meine Bilder gerne grotesk aussehen, hier nicht. Wenn die Helden der Geschichte ein vom Alter verbogenes und zerknautschtes Paar wären, würde ich zeigen, wie sie sich fühlen – und in diesen Momenten fühlt man sich schön.
Autoren von Texten müssen die Dinge beim Namen nennen. Doch eine Brust zum Beispiel sieht besser aus, als das Wort klingt. Busen, Titten, Duddeln … die Auswahl ist gross und dennoch beschränkt. Oder: Wie bezeichnet man das weibliche Geschlechtsteil? Scheide, Vagina, Vulva, Möse, Fotze klingen entweder nach medizinischen Fachbegriffen oder nach Schimpfwörtern. Geschmacksgrenzen sind schnell überschritten. Wenn allerdings im Kontext von Sex davon die Rede ist, vermute ich eine Verwechslung mit Schamgrenzen. Sex und Scham treten leider ebenfalls als Paar auf.
Die persönliche Schamgrenze der Rezipienten ist eine unwägbare Grösse. Beim Zeichnen von Sexszenen darf ich mich darum ohnehin nicht kümmern. Es wäre fatal. Ich würde aufhören, sie zu zeichnen. Den meisten Menschen sind sogar ihre eigenen Sexfantasien peinlich. Soll man sie deshalb in der Literatur aussparen? Sex muss so selbstverständlich wie das Davor und das Danach Gegenstand der Literatur sein. Eine Zensur aus ästhetischer Vorsicht ist genauso armselig wie eine aus moralischen Bedenken. Der Autor muss den Leser dazu verführen, die Empfindung von Scham abzustreifen bzw. sich an der Sensation der Überschreitung zu erfreuen.
Kurioserweise gefallen mir, einer durchschnittlich heterosexuellen Frau, Schwulencomics ganz besonders. Nicht die sogenannten Yaoi Mangas, in denen sich junge Leserinnen mit feminin wirkenden Jünglingen identifizieren, die es homoerotisch miteinander treiben. Ein interessantes Phänomen sind diese dennoch: Der Trend deutet darauf hin, wie schwer es jungen Frauen immer noch gemacht wird, ihre eigenen erotischen Bedürfnisse auch nur anzuerkennen. Um sich «zu trauen», müssen sie sich vorstellen, männlich zu sein; Männer dürfen mehr. Das macht wahrscheinlich Schwulencomics so faszinierend. Ich mag’s dabei kernig: Haare, Muskeln, Leder, Schweiss. Der japanische Mangazeichner Gengoroh Tagame ist ein Meister darin, diese maskuline Pracht zu feiern, und eigentlich auch der deutsche Ralf König, selbst wenn seine Figuren Knollennasen tragen. Ich halte es mit der sprichwörtlichen Tante Jolesch, die einst gesagt haben soll: «Alles, was ein Mann schöner ist als ein Aff, ist ein Luxus.»
Meine eigene Schamgrenze liegt wahrscheinlich etwas niedriger als die des Durchschnitts, aber nicht so tief, wie viele Journalisten offenbar vermuteten, die mich im Vorjahr zu meinem letzten Comic «Wie ich versuchte, ein guter Mensch zu sein» interviewten. Die Handlung benötigte ein paar saftige Sexszenen und ist autobiographisch. Noch dazu bin ich eine Frau. Die erste Frage lautete häufig: «Wie haben Sie es geschafft, so schamlos zu erzählen?» Meine erste Antwort war immer eine Lüge: «Interessante Frage.» Dann versuchte ich den Unterschied zwischen dem Schamgefühl einer Autorin und dem einer Privatperson zu erklären. Im dokumentarischen Comic gehört das Gebot der Ehrlichkeit zur künstlerischen Methode. Ich müsste mich schämen, wenn ich nicht versuchen würde, so konsequent wie möglich zu erzählen.