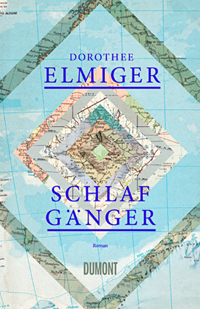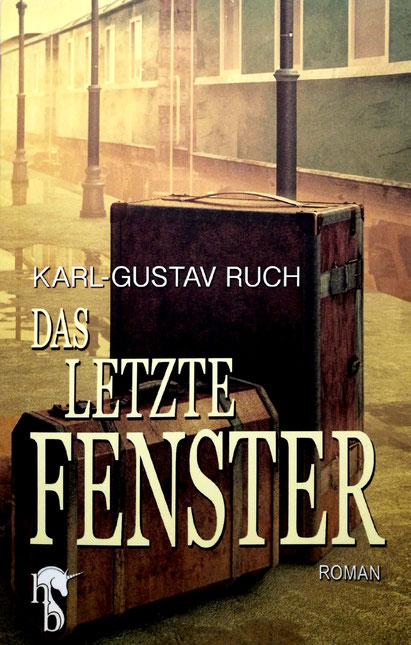What the f### U mean?
Oder: Was ist eine gute Übersetzung?
Es ist doch ganz einfach, im Lotto zu gewinnen: Man muss nur die richtigen Zahlen ankreuzen.
Es ist doch ganz einfach, die gute Übersetzung anzufertigen: Man muss nur die richtigen Wörter hinschreiben.
Nur: was sind denn die richtigen Wörter?
Die Frage nach der guten, der idealen Übersetzung lässt sich ganz leicht beantworten: Das, was das Original intendiert, wird im Übertragungsprozess umfänglich verstanden und in der Zielsprache adäquat und lückenlos wiedergegeben. Umberto Eco nennt das in seinem gleichnamigen Buch zum Übersetzen: «Quasi dasselbe, mit anderen Worten».
Es ist doch ganz einfach, im Lotto zu gewinnen: Man muss nur die richtigen Zahlen ankreuzen.
Es ist doch ganz einfach, die gute Übersetzung anzufertigen: Man muss nur die richtigen Wörter hinschreiben.
Nur: was sind denn die richtigen Wörter?
Ein paar Grundregeln
Natürlich gibt es Grundregeln, Leitsprüche, an die wir uns halten können, Dinge, die gute Übersetzer können müssen, und andere, die sie vermeiden sollten. Dies reicht von der Fähigkeit, Sprichwörter und Sinnsprüche der Ausgangssprache zu erkennen und in die Entsprechung in der eigenen Sprache zu übertragen, bis hin zu der Erkenntnis, dass sich die Satzmelodien in den verschiedenen Sprachen unterscheiden und nicht immer wortgetreu wiedergeben lassen (müssen).
Vor allem aber: jedes Buch hat seine eigenen Besonderheiten. Diese herauszuschälen und zu beachten, ist vorrangige Aufgabe einer guten Übersetzung. Dazu gehören etwa sprachliche Eigenheiten, das gesellschaftliche, historische und soziale Umfeld der Entstehung oder auch die wirtschaftlichen Bedingungen, unter denen Original und Übertragung entstehen. Nichtbeachtung dieser bestimmenden Faktoren kann meines Erachtens nicht zu einer guten Übersetzung führen. Auch Vorgaben durch den Verlag, wie eine Übersetzung klingen soll, können den Weg zu ihr nur behindern.
Die Liste mit Dos und Don’ts liesse sich fortsetzen, und kluge Köpfe haben sich ausgiebig über die besonderen Herausforderungen des literarischen Übersetzens ausgelassen. Ich verweise neben Umberto Eco auf Dieter E. Zimmers «Redens Arten» oder auf Karl Dedecius’ «Vom Übersetzen». Der Punkt ist: eine Checkliste genügt nicht. Denn der Weg zur guten Übersetzung führt über Fragen, über die bei jedem Buch neu (und keineswegs immer gleich) entschieden werden muss: Was mache ich mit Dialekten, die ich niemals ortsgetreu übertragen kann (Hamburg ist nicht New York, Bayern nicht Texas)? Was mit Soziolekten – spricht eine weisse Amerikanerin Hochdeutsch, der schwarze Amerikaner aber «Strasse»? Wie sieht es mit Anspielungen und rhetorischen Formen aus, mit Ironie und Sarkasmus? Will ich Wortwörtlichkeit, bilde ich also das Original mit all seinen grammatikalischen und syntaktischen Eigenheiten so genau wie möglich nach (weil diese Eigenheiten ja von Bedeutung sein könnten)? Oder suche ich nach einer Wirkungsäquivalenz, ohne z.B. der Reihenfolge der Wörter im Original sklavisch ergeben zu sein?1 Verlangt der Text in der Übertragung Verfremdung (um die Andersartigkeit des Textes zu bewahren) oder Angleichung (damit wir den Sinn besser verstehen)? Also: möglichst dem Original entsprechend oder möglichst deutsch, möglichst lesbar? Und was ist überhaupt übertragbar, was geht verloren, wo kann ich es andernorts retten?
Dass es auf all diese vielen Fragen nicht die eine, wahre Antwort geben kann, ist ja allein schon an ihrer schieren Menge erkennbar. Und es wird noch deutlicher, wenn ich betrachte, wie viele unterschiedliche Erzählweisen es auf der Welt gibt. Zudem: schon allein die Vorstellung, was eine gute Übersetzung ist, ist dem Lauf der Zeit unterworfen. Galt Heinrich Manns recht freie (und wunderbare) Nachdichtung von Choderlos de Laclos’ Briefroman «Gefährliche Liebschaften» 1905 noch als Übersetzung (auch in der Erstübersetzung von Mark Twains «Die Abenteuer des Huckleberry Finn» von 1890 wird sehr, sehr frei mit dem Original umgegangen), so wird heute stillschweigend gefordert, dass die deutsche Version so nah am Original sein soll wie möglich.
Wie kommt man also als guter Übersetzer, gute Übersetzerin in die Lage, diese Entscheidungen zu treffen? Unablässige Neugier, ja Wissenshunger und Interesse scheinen mir dafür unerlässlich. Suchen, suchen, suchen! Mit all den Hilfsmitteln, die sich für das Übersetzen anbieten (sie reichen von den grossen Enzyklopädien und Wörterbüchern der Jahrhunderte bis zu allen Suchmöglichkeiten des Internets und enden auch nicht an den Grenzen anderer Fachgebiete) und die all die Giganten vor mir entwickelt und verfeinert haben, bildet sich so im Laufe der Zeit ein ganz eigener Fundus an Möglichkeiten. Bildungs- und Fortbildungsangebote helfen dabei, sich diese Hilfsmittel schneller dienstbar zu machen, sind aber nicht zwingend notwendig, um meine Arbeit am Buch gut zu machen. Gute Übersetzerinnen und Übersetzer haben die unterschiedlichsten Lebenswege zu dieser Arbeit gebracht. Und ich finde, das sollte auch so sein: So wie die guten, die wichtigen Bücher sich aus vielen Lebenswegen entwickelt haben, so hilfreich kann es auch beim Übersetzen sein, aus eigenen Lebenserfahrungen schöpfen zu können.
In der Regel hilfreich dabei, zu verstehen, was der Text alles sagen will, ist auch der Kontakt zur Autorin, zum Autor des Originals. Es kann sogar dazu kommen, dass ich als Übersetzer Einsichten in den Ursprungstext gewinne, die selbst dessen Verfasser verborgen geblieben sind: Bei der Übersetzung eines Romans von Peter Carey fiel mir auf, dass – zwar nicht häufig, aber doch signifikant – christliche Symbolik im Text steckte. Auf meine Frage danach antwortete der Autor, dass ihm dies überhaupt nicht bewusst gewesen sei. So kann ich also durch guten Kontakt einen bedeutsamen Übertragungsfehler vermeiden: Ohne diese Antwort hätte ich womöglich darauf geachtet, diese Symbolik in der deutschsprachigen Fassung kenntlich zu machen.
Der Übersetzer ist nie unsichtbar
Was man bei aller Recherche, bei allen Bemühungen um Genauigkeit und «Sound» nie wird verhindern können: in der Übersetzung steckt auch viel vom Übersetzer. Natürlich möchte ich, dass Oscar Wilde auch in meiner Übertragung nach Oscar Wilde klingt und Irvine Welsh nach Irvine Welsh – und nicht beide nur nach Deutsch oder nach Peter Torberg. Aber ich kann mich als Übersetzer und Schöpfer der neuen Sprachfassung nicht vollkommen aus dem Prozess herausnehmen. Um zu einer guten Übersetzung zu kommen, muss das Original schliesslich durch mich hindurch. Wie schön doch die Geschichte von der Entstehung der Septuaginta, nach der zweiundsiebzig jüdische Gelehrte sich in Alexandria, jeder für sich, an die Arbeit machten, die fünf Bücher Mose aus dem Hebräischen ins Griechische zu übersetzen. Nach zweiundsiebzig Tagen hatten diese Gelehrten ebenso viele identische Übersetzungen angefertigt; der Heilige Geist, so die Legende, hatte sie ihnen eingegeben. Ich dagegen muss mich selbst darum bemühen, die Stimme des Originals auch im Deutschen wiederzugeben. Das erfordert für jedes Buch eigene sprachliche Mittel, in denen ich als Übersetzender wieder aufscheine. Ein anderer würde es sicherlich ein wenig anders machen. Mein Einfluss auf den Text ist unvermeidbar da, ich bin der Urheber der deutschsprachigen Fassung.
Das bedeutet aber auch: ein Original, das mich nicht berührt, packt, fesselt, anwidert und all das, kann ich nicht gut übersetzen. Ich übersetze es nur. Lesbar, korrekt, unterhaltsam und all das, aber das i-Tüpfchen fehlt. Es mag jedes Wort richtig übersetzt sein: aber Ulrich Blumenbachs Übersetzung von David Foster Wallace ist eben nicht Google Translate, sondern Kunst. So weit, wie es scheint, sind Schriftstellerei und Übersetzungswerk nicht voneinander entfernt. Und gerade mit der Frage nach dem künstlerischen Kern des Originals (dem «Sound», der Eigenart, der Einzigartigkeit der Vorlage) und dem Versuch, über eine lesbare, korrekte und unterhaltsame Übersetzung hinaus genau diesen zu transportieren, werden all die oben angesprochenen Punkte wichtig.
Gutes Übersetzen unter realen Bedingungen
Ja, im besten Fall wird aus Übersetzung Kunst. Übersetzer können sich aber gesellschaftlichen, sozialen und ökonomischen Zwängen nicht einfach entziehen. Die Leserschaft hat berechtigtes Interesse an einer guten Übersetzung. Der Auftraggeber, ob Verlag oder Theateragentur, ist daran interessiert, möglichst Geld mit dem Ergebnis zu erwirtschaften. Diese Interessen müssen nicht immer miteinander kollidieren. Dennoch: Sachzwänge, Zeitvorgaben, auch finanzieller Druck machen es einem manchmal nicht leicht, sich so umfänglich auf die Übersetzung zu konzentrieren, dass daraus eine gute Übersetzung werden kann. Die weitverbreitete Vorstellung vom Übersetzen als Tätigkeit im stillen Kämmerlein, fern aller Beeinflussungen, entspricht jedenfalls nicht der tagtäglichen Wirklichkeit. So wenig, wie es den aus sich selbst schöpfenden Dichter im Elfenbeinturm gibt, der schier aus der Luft ein Kunstwerk schafft, ohne auch nur im Geringsten von der Welt, in der er lebt, beeinflusst zu sein, so wenig habe ich als Übersetzer die Möglichkeit, mir alle Zeit der Welt mit diesem einen Buch zu lassen. Es kommt der Punkt, an dem ich meine Arbeit abliefern muss. Diese Rahmenbedingungen prägen natürlich auch das Ergebnis.
Glücklich die Übersetzerin, die in völliger Freiheit und ohne jeden wirtschaftlichen Zwang ein Buch übertragen darf. In den meisten anderen Fällen müssen es das berufliche Umfeld und die eigene Erfahrung richten, dass auch unter engen finanziellen und zeitlichen Vorgaben herausragende und kulturell wertvolle Arbeit zu leisten ist – einen entscheidenden Beitrag leistet auch die herausragende kollegiale Zusammenarbeit in unserer Zunft. Nicht nur im künstlerischen Umgang mit dem Original, sondern auch im täglichen Spannungsfeld der Arbeit plädiere ich klar für Pragmatik vor Dogmatik.
Wo stehe ich also in meiner Arbeit zwischen der Vorstellung Walter Benjamins von der idealen Übersetzung (der Bibel) und der Erklärung im Talmud: «Wer einen Vers wortwörtlich übersetzt, ist ein Lügner, wer ihm etwas hinzufügt, ist ein Gotteslästerer und Verleumder» (Qiddushin, 49a)? Im ersten Fall wären wir Sprachrohr Gottes, im zweiten hätten wir gar keine Chance, zu dem einen richtigen Ergebnis zu kommen. Aber haben wir die denn überhaupt? Beide Vorstellungen gehen von der Idee aus, dass es einen heiligen – oder: richtigen – Text in vollkommen unverfälschter Form gibt, der unverändert umgewandelt werden kann und der dabei alle Wortbedeutungen und Zusammenhänge zwischen den Wörtern wiedergibt. Eine ideale Vorstellung, doch wie viele Ideale unerreichbar: Worte verändern und verlieren ihre Bedeutung; sie werden in anderen Kulturen anders verstanden und anders bewertet; so manches Verständnis geht im Laufe der Jahre, Jahrhunderte verloren und wird durch neue Vorstellungen ersetzt, überlagert oder verdrängt. Meine Übersetzungen werden in ein paar Jahren, Jahrzehnten «veraltet» sein, Leser werden nach einer neuen Übersetzung rufen. Zu Recht.
Es bleibt dabei: die Antwort auf die Frage nach der guten Übersetzung kann nur heissen: Ich muss es in jedem einzelnen Fall ganz individuell entscheiden, es mit jedem neuen (guten) Original aufs Neue versuchen.
1 Ein schönes Beispiel dafür sind zwei Übersetzungen von Herman Melvilles «Moby-Dick», die 2001 recht zeitgleich erschienen: einmal in der Übertragung von Matthias Jendis, der stärker auf die Lesbarkeit achtet, zum anderen die Arbeit von Friedhelm Rathjen, der sich ganz dem Original verpflichtet fühlt und dem Wort folgt, was wiederum die Lesbarkeit stark beeinträchtigt. Die durch die direkte Vergleichsmöglichkeit angestossene Diskussion, welches nun die bessere sei, führte in der Welt der Übersetzerinnen und Übersetzer und der Literaturkritik zu langandauernden Debatten, wie es sie um Übersetzungen höchst selten gibt.
Peter Torberg
übersetzt aus dem Englischen (u.a. John le Carré, Irvine Welsh, Oscar Wilde) und lehrt an der Universität München. Zuletzt erschien u.a. seine Übersetzung von Garry Dishers «Leiser Tod» (Unionsverlag, 2018). Torberg lebt in Bad Griesbach.