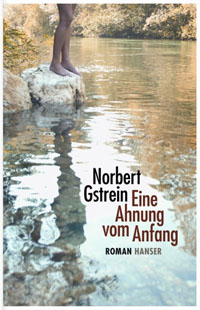Am Schreiben bleiben
Verzettelt sind sie alle – ob Petrarca oder Sargnagel. Ein Disput über Bilder von der Schriftstellerei, geführt mit Max Frisch aus der Tube.

In der Mitte meines Lebens wollte ich mir die Zähne putzen. Dass «Max Fresh» auf der Tube stand, schien mir am Anfang nicht viel zu bedeuten. Da stand ja auch «with cooling crystals» und «cool mint» drauf. Ich drückte drauf. Nichts. Ich wendete Gewalt an, galt es doch, saure Regenbogenstreifen, Kaffee- und Rotweinrückstände wegzuputzen. Gerade als ich dachte, jetzt platze sie gleich, zwängte sich ächzend ein Wanderer mit Stirnlampe aus der Tube. Es wurde taghell in der Berghütte.
«Wer sind Sie denn?», fragte ich. Der Mann, dessen Augen hinter einer dicken Brille verschwammen, mass mich mit einem kalten Blick und zerrte einen Koffer hinter sich her. «Was machen Sie in meiner Zahnpasta? Kommen die Geister schon nicht mehr aus Flaschen? Und was schleppen Sie da alles mit sich herum? Heda! He! Sie blockieren ja die ganze Hütte!»
«Ach was!», grantelte der Besucher. «Ich nehme nur das Überlebensnotwendige mit auf den Berg: ‹Campari, Veltliner, Wermut, Schreibmaschine, Tabak›1.» Der Besucher baute seine Schreibmaschine auf, stopfte eine Pfeife und machte sich einen Drink. «Manchmal», liess er mich wissen, «… denke ich, dass ich nicht mehr frisch bin. Sie verstehen. Dabei ist das doch meine Aufgabe! Und jetzt das: ich sass heute Morgen um halb sieben am Pult und brauchte unendlich lange, um unüblich farblose Sätze zu schreiben. Zum Davonlaufen. Dabei muss ich doch nur eine Einladung fertigschreiben. Gestatten, ich bin Architekt. Ich habe ein Gartenbad gebaut. Zur Eröffnung lade ich jetzt alle ein.2 Alles, was da im Betrieb kreucht und fleucht. Unbedingt dabei haben muss ich diesen Brecht. Un-be-dingt.»
«Aber warum tun Sie sich so schwer mit dem Schreiben einer Einladung?», fragte ich nach einer Pause. «Der Schreibmaschine und den Getränken nach geurteilt sind Sie doch Schriftsteller?»
«Wem sagen Sie das», gab er zurück. «Erst vor Wochen brachte ich ‹Tagebuch 1946–1949›, ein Füllhorn von Stoffen, in den Druck. Und jetzt schauen Sie mich an! Ich hadere bereits mit einer Einladung. Dabei suche ich gar keinen neuen Job, ich bin ja Architekt!» 3 Ich wollte ihn ablenken, als ich sagte:
«Gut, gut. Egal, wie Sie in meine Tube kommen. Ihr Hadern mit dieser Einladung macht Sie menschlich! Sie schweben zwischen Beruf und, das sage ich flapsig: Berufung. Die Frage lautet: ist es schlauer, sich die Schriftstellerei fremdfinanzieren zu lassen oder sie sich nebenberuflich selbst querzufinanzieren?» – Der Mann aus der Tube machte keine Anstalten, zu antworten; also fuhr ich fort: «Mich zog es neulich in dieser Frage mächtig zurück zu Petrarca. Irgendwo muss man ja anfangen. Und was lese ich dort? Eine Lobhudelei der Fremdfinanzierung! Einen Hymnus auf finanzielle Abhängigkeit und Uneigenständigkeit! Da schrieb dieser Bergsteiger an seinen Gönner, einen Kardinal in Avignon: ‹Alles schulde ich dir – meine geistigen Anlagen wie meinen schwachen Körper, den ich als Fremdling bewohne, und alle äusseren Güter, die mir je zuteil geworden sind. Denn dein Hofhalt hat ja meinem Geiste nicht weniger gegeben als meinem Körper und meinem Vermögen.›»4
«Typisch Petrarca!», stimmte der Besucher mir zu. «Sich aushalten lassen, Teil der Verwaltung werden, Kanzleileiter. Ausverkauf der künstlerischen Seele ist das.» Verärgert schob der Besucher seine Schreibmaschine zur Seite und putzte sich Zahnpasta von der Brille.
«Na ja», wandte ich ein, «heute sind ja die Schreibenden nicht mehr ganz so schlimm dran! Stellen Sie sich vor, vor einigen Jahren hat die NZZ die Schriftstellerei unter der Überschrift ‹Gesellschaft und Bildung›5 abgehandelt. Wenn das mal kein Grund zur Freude ist! Es beweist: Wer schriftstellert, ist mitten in der Gesellschaft! Er ist das Resultat einer gewissen Bildung.»
«Pfwz», frotzelte der Gast, der sich die Brille wieder aufsetzte, «wenn es nach denen geht, handeln sie die Literatur bald auf den Wirtschafts-, Gesellschafts- oder Kehrseiten ab.»
«Aber man muss Petrarca zugutehalten: ein Werk hatte der. Schreiben wollte der. Bereit war der, dafür zu verbluten: ‹Wie oft habe ich versucht, mich aufzuraffen, wie oft wollte ich etwas schreiben! […] Alles habe ich versucht, doch alles war vergeblich!›6 Das ist doch die Essenz aller Buchstabenschieberei!»
«Halt!», donnerte der Besucher, «woher kommen eigentlich all diese Zitate?»
«Aus Petrarcas gesammelten Briefen, geschrieben vor 600 Jahren. Die Ausgabe hab ich in Basel am Petersplatz erstanden, direkt neben dem Wurststand. An der Herbstmesse.»
«Na dann, halleluja. Bei Elisabeth Förster-Nietzsche.» Es entstand eine Pause: «Sie wissen ja: die Schwester von Nietzsche, die ihr Leben mit der Manipulation der Briefe ihres überm Denken und Schreiben umnachteten Bruders bestritt.7 Wie die Hand anlegte an die Schriften ihres Bruders. Was die eins schwärzte, abschabte oder unterschlug, wie viele Deutungen sie vorspurte. Wenn es nach ihr gegangen wäre, wäre es oberste Pflicht des Schreibenden, irgendwelchen Fremdzuschreibungen und Textverstümmelungen zu entsprechen!»
«Na ja», ritt es mich, zu bedenken zu geben, «des einen Umnachtung ist des anderen Nachlass! Sie haben ja seit 1991 auch nicht mehr die volle Kontrolle darüber gehabt, was in den Buchhandlungen unter Ihrem Namen firmiert.» Der Besucher schwieg garstig.
«Man muss es eben verstehen, rechtzeitig die Kurven zu kratzen. Wenn Sie wüssten, wie knapp ich 1945 die Kurve kratzte.8 Eigentlich hatte ich der Literatur ja abgeschworen. War Germanist geworden, dann Journalist, dann Architekt, dann Soldat. Ich hätte ja auch bis ans Lebensende Texte à la ‹Eine Stadt sucht einen Panther›9 schreiben können. Übrigens ein, wie ich finde, gelungener Text über den Ausbruch eines Panthers aus dem Zürcher Zoo.»
«Aber natürlich, Gebrauchsjournalismus10», erwiderte ich. «Egal, was in Sachen Autorschaft auch bisher geschah: niemand kann sich ohne ihn die dringlich nötigen künstlerischen Freiräume und Schneisen ins Leben hauen!»
«Sie beginnen mir leidlich zu gefallen», sagte mein Gegenüber. «Kennen Sie übrigens Peter Fischschwanz? Johann Schneider? J.S.? Nein? Aber dann kennen Sie ja vielleicht Hansjörg Schneider.»
«Natürlich! Aber warum hat der denn so viele so verschiedene Namen?», fragte ich.
«Das hat schon klügeren Köpfen als Ihnen zu denken gegeben», stichelte der Gast. «Von ihm selbst liest man entwaffnende Sätze hierzu: ‹Ich hatte einfach noch nicht die Entschlossenheit, zu sagen, so, voilà, das bin ich, Hansjörg Schneider. […] Das Selbstbewusstsein musste ich mir erst erkämpfen.›11 Er verwendete so viele Namen, um Grenzen zu ziehen zwischen Kolumnen, Journalismus, Theater und Prosa und was er sonst noch alles schreibt!»
«Das klingt nachvollziehbar, wenn auch verzettelt. Es zeugt mir von etwas gar viel Rollenbewusstsein. Als sei auch die Schriftstellerei nur eine Rolle, die es spielend auszufüllen gälte. Der es zu entsprechen gälte. Autorinnen und Autoren sollten doch aber Texte schreiben, nicht sich immerzu neue Pseudonyme überlegen!»
«Ach was», gab der Herr mit der Stirnlampe und den dicken Brillengläsern zu bedenken. «Ich kann nur sagen – lesen Sie nicht nur diesen Schneider, sondern auch einen anderen, den Urs-Peter Schneider. Der ist zwar deutlich weniger zugänglich, aber wenn Sie einmal drinnen sind, ist es ein Palast. Dort finden Sie die passende Medizin gegen Ihre noch etwas unausgegorene Rollenkritik: ‹ich spiele immer eine von vielen rollen, wichtig ist nur, ob ich sie zu wählen vermag.›»12
«Da halte ich es doch viel lieber mit Stefanie Sargnagel», fuhr ich dazwischen. «Eine junge Frau mit Mütze, Wienerin und Künstlerin, Schriftstellerin – in Aphorismen und Aperçu mal mehr, mal weniger zuhause! Sie schreibt: ‹Manchmal hab ich Albträume, dass ich eine Kunstfigur bin, die unter den Augen Hunderter Fremder ihr Leben dokumentiert.›»13
«Österreicherinnen waren mir stets lieb. Aber…», gab er Pfeife schmauchend zu bedenken, «… wie soll denn das überhaupt gehen? Eine Kunstfigur sein? Unter den Augen Hunderter sein Leben dokumentieren? Wollen Sie etwa am Strassenrand stehen und so lange die Luft anhalten, bis sich Hunderte dafür interessieren? Nein. Ich sage: So lange es noch ein bis zwei Jahre dauert, ehe ein Satz beendet und ein Buch in den Druck spediert ist – minimiert sich diese Gefahr von alleine. Auch die Medien werden doch wohl einen Künstler nicht ohne Weiteres zur Kunstfigur werden lassen, sondern auf seine Tatsächlichkeit ihn immer wieder behaften.» An dieser Stelle entstand ein etwas länglicher Austausch über Facebook, Twitter und Konsorten. Erwartungsgemäss tat sich mein Besucher, für den Dürrenmatts Floppy Disks höchstes aller EDV-Gefühle waren, damit schwer:
«Nun ja, Facebook, das ist gewissermassen ein computerbasiertes Lokalblatt, voll und ganz der Berichterstattung über Ihre eigene Person verschrieben. Ein Medium, um unter den Augen aller jeden Augenblick ein anderer zu sein.»
«Unter diesen Umständen hätte wohl auch ich Bedenken, ob ich nicht eher Kunstfigur geworden denn Künstler geblieben sei», dachte der Besucher laut vor sich hin. «Was ich wohl in dieses Facebook getippt hätte?»
«Jedenfalls stimme ich Ihnen ja grundsätzlich zu. Auch die Schriftstellerei ist nur eine Rolle. Kennen Sie das Gedicht ‹A Sofa in the Forties› von Seamus Heaney? Es geht um ein Sofa. Auf dem Sofa spielen Kinder Eisenbahn. Alles, was sie dazu brauchen: Phantasie und ‹chooka-chook›. Denn: ‹Our only job to sit, eyes straight ahead, / and be transported and make engine noise›.14 Ein Gedicht, das sich auch aufs Schreiben übertragen lässt. Denn alles, was Sie dazu tun müssen, ist, sich an einen Tisch zu setzen, Augen aufs Papier gerichtet, sich bewegen zu lassen und Dichtergeräusche von sich zu geben!» Hier zischte mein Besucher, als würde er gleich zurück in die Tube fahren; es stellte sich heraus, dass er sich verschluckt hatte.
«Das ist meine Frage, keine Frage. Das treibt mich seit Jahren um. Was soll das heissen – Schriftsteller sein? Neulich hörte ich ein Gespräch zwischen einem abgewirtschafteten französischen Schriftsteller und einem ebenso gezielt wie penetrant nachstossenden Befrager, André Müller. Michel Houellebecq hiess der Befragte. Er sagte etwas, was mich aufhorchen liess: ‹Ich habe so viel gelogen, dass ich nicht mehr weiss, was wahr ist, was nicht. Je älter ich werde, desto schlimmer wird es. […] Der Respekt vor der Wahrheit wird, wenn man Bücher schreibt, immer geringer.›»15
«Das sehe ich nun aber ganz anders», schimpfte ich. «Ich meine, die Sache mit dem Rollenspiel, okay. Das mag Teil des Dichterpensums sein. Aber das mit der Wahrheit? Ist etwa auf einmal nicht mehr ‹Don Quijote› der wahrhaftigste Roman? Also, ich halte es lieber mit dem mazedonischen Dichter Nikola Madzirov. Der dichtet: ‹Du schreibst. Über die Dinge, die bereits existieren / Und sie sagen, du denkst sie dir aus!›»16
«Ich denke», sagte der Besucher, «dass unser Säulenheiliger Petrarca Ihnen zustimmen würde. Wenn auch unter umgekehrten Vorzeichen: Petrarca dichtete sein ganzes Leben lang, bekam den Dichterlorbeer verliehen, und am Ende wussten die Leute nichts Besseres anzustellen mit ihm, als ihn um Rat zu fragen in juristischen Belangen. Petrarca wurde ja sogar vom Kaiser herangezogen, um über den Wahrheitsgehalt von Dokumenten zu urteilen, die ihm von einem Habsburger Emporkömmling namens Rudolf IV. vor den Latz geknallt worden waren. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: ein Kaiser lässt einen Dichter über den Echtheitsgrad gefälschter Dokumente urteilen.»17
«Na ja, solange man Petrarca für diese Expertisen schadlos hielt», wandte ich ein. «Am Ende aller Dichtung bleibt ja doch die mal mehr, mal weniger leidliche leibliche Existenz. Und gegen die an die Dichter herangetragene Erwartung, als Analytiker gesellschaftlicher Zusammenhänge verfügbar zu sein, kann man sich als grundsätzlich verführbares Wesen nicht wehren. Es bleibt die Frage des Grades, bis zu dem man sich mit diesen an einen herangetragenen Rollen identifiziert. Wie sehr man damit spielt. Sich verpuppt darin. Seine Metamorphosen damit treibt. Ich muss die ganze Zeit an Ihre Beschreibungen von Thomas Mann denken: ‹kostümierte Essayistik›18 haben Sie ihm attestiert, er sei einer, der enzyklopädische Romanpassagen vor eindrücklichen Bergkulissen schreibe, weil Romane viel häufiger gekauft werden als Aufsätze zu Zeit und Geist und Ungeist und Geschichte und Politik. Wie beissend. Wie nach dem Leben gegriffen. Bücher müssen zu den Leuten. Wenn das nicht Teil des Dichterpensums ist: sie dorthin zu bringen.»
«Dabei wäre vielen Schreibenden schon viel mit nur wenig Gelassenheit gewonnen. Kennen Sie Virgilio Masciadri?», wollte er wissen. «Das ist ein ganz Unglaublicher. Ich lernte ihn leider erst nach unser beider Lebzeit kennen. Bei ihm, wenn überhaupt irgendwo, finden Sie ein Dichtercredo: ‹und bei den / Trödlern am Jar- / din du Luxembourg blät- / terte nur die Bise in den aus- / gelegten Büchern.›19 Einer dieser Sätze zum Auf-die-Haut-Tätowieren. Dass am Ende lebenslangen Ringens um Worte und Sätze bloss stapelweise Papier bleibt, zusammengeklebt und zugenäht, mit Schutzumschlag und Barcode versehen und zugeschweisst und angepreist. Sie enden in den Mäulern der Schredder oder in den Auslagen der Bouquinisten. Den Elementen ausgeliefert, dem Wind. Veranschlagt für wenig mehr als den Wert des Papiers. Das kann man nun mehr oder weniger goutieren. Es indes zu akzeptieren käme dem Phantasma einer Dichterpflicht wohl am nächsten.»
«Ich weiss nicht», mäkelte ich, «das überzeugt mich nicht. Gerade auch, weil ja heute viele Schreibende schon gar nicht mehr in Buchform erscheinen, sondern zwischen Heften und Zeitschriften und Computern und Absichtserklärungen verzettelt bleiben. Wissen Sie was? Ich wünschte mir den Mumm einer Stefanie Sargnagel, die schreibt: ‹Schreiben ist eigentlich voll lustig, sollte ich öfter machen.›»20
«So hätte ich das nie formuliert. Mir scheint es aber, dass wir wenigstens eine Pflicht der Schreibenden festhalten können: ‹Schreiben heisst, sich selber lesen.›»21
«Das sagt sich leicht!», versetzte ich, «wenn man seinen Namen schon anglisiert auf Zahnpastatuben findet. Apropos: finden Sie es nicht an der Zeit, dorthin zurückzugehen? Ich bitte Sie darum – und machen Sie bei der Gelegenheit auch gleich den Deckel zu hinter sich! Denn Schreiben heisst am Ende ja auch nur ‹am Schreiben bleiben›!»
1 Constantin Seibt: Max Frischs «Tagebuch mit Murmeltier». In: Seibt, Seibt & Seibt: Familienbande. Bern: Stämpfli, 2012, S. 52.
2 Max Frisch. Tagebuch 1946–1949. München/Zürich: Droemer, 1967, S. 135.
3 Max Frisch: Schwarzes Quadrat – zwei Poetikvorlesungen. Hrsg. von Daniel de Vin. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2008, S. 21.
4 Hans Nachhod & Paul Stern: Briefe des Francesco Petrarca. Berlin: Verlag die Runde, 1931, S. 115.
5 Neue Zürcher Zeitung vom 21.03.2013.
6 Petrarca: S. 116.
7 Werner Fuld: Das Lexikon der Fälschungen. Frankfurt a.M.: Eichborn, 1999, S. 38.
8 Vgl. dazu «Literarischer Monat 29/2017», Interview mit Peter von Matt.
9 Daniel Foppa: Max Frisch und die NZZ. Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2003, S. 47.
10 Ulrich Weber: Die Geburt des Kriminalromans aus der Praxis des Lokaljournalismus – Hansjörg Schneider. In: Leuenberger, Müller et al.: Literatur und Zeitung. Zürich: Chronos, 2016, S. 157.
11 Hansjörg Schneider, zitiert nach Weber, S. 169.
12 Urs Peter Schneider: Schriften III, 2 Ichbuch C. In: ders.: Schriften I bis IV. Biel: die brotsuppe, 2016. Ohne Paginierung.
13 Stefanie Sargnagel: Statusmeldungen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2017, S. 57.
14 Seamus Heaney: The Spirit Level. London: Faber and Faber, 1996, S. 9.
15 Michel Houellebecq im Gespräch mit André Müller. In: André Müller: Sie sind ja wirklich eine verdammte Krähe – letzte Gespräche und Begegnungen. München: Langenmüller, 2011, S. 329.
16 Nikola Madzirov: Versetzter Stein. München: Hanser, 2011, S. 57.
17 Web: http://www.habsburger.net/de/kapitel/faelschung-nach-habsburgischer-art-das-privilegium-maius (Zugriff: 11. September 2017).
18 Max Frisch: Stichworte – ausgesucht von Uwe Johnson. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1975, S. 56.
19 Virgilio Masciadri: Allee ohne Laub – Gedichte aus dem Nachlass. Hitzkirch: edition bücherlese, 2017, S. 16.
20 Sargnagel, S. 133.
21 Frisch: Tagebuch, S. 192.