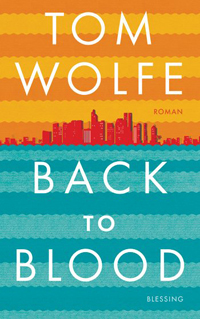
Tom Wolfe:
«Back to Blood»
Dass Tom Wolfe von der europäischen Kulturkritik nicht geliebt wird, hat einen einfachen Grund: Keiner hält der Hochnäsigkeit und Heuchelei der europäischen Intellektuellen mit so viel Spass an der Freude den schmutzigen Spiegel vor wie er. Wolfe ist inzwischen 82 und lebt in New York, der Stadt des Geldes, für die der legendäre Reporter steht wie kein anderer Erzähler unserer Zeit. Da ist es nur folgerichtig, dass sich Wolfe gegen Ende seines Lebens und in seinem mutmasslich letzten grossen Werk mit einem Bunga-bunga-Roman an seinen Kritikern rächt, 768 Seiten dick, wovon er sich angeblich jede einzelne vom US-Verlagshaus Little Brown mit 10 000 US-Dollar bezahlen liess.
Alles ist käuflich: mit dieser kapital-liberalen Grundthese reizt er seit Jahren die europäischen Feuilletons bis aufs Blut. Er schreibt grell und laut, seine Romane sind Blockbuster zwischen Buchdeckeln. Subtilität sieht Tom Wolfe als snobistischen Versuch, von der rohen Wirklichkeit abzulenken. Ja, Wolfe, der immer im weissen Smoking auftritt, ist dabei wertkonservativ, und es gibt tatsächlich bessere Persönlichkeitsprofile, um bei der progressiv-verbiesterten Kunst- und Kulturschickeria in Europa Lorbeeren zu ernten. Und doch muss jeder Kritiker einräumen, dass keiner vorher und nachher ein treffenderes Sittenbild der irrwitzigen Finanzbranche und der zerfallenden postindustriellen Gesellschaft gezeichnet hat als Wolfe 1987 in seinem Erstling Fegefeuer der Eitelkeiten.
Jetzt also Back to Blood, übersetzt: «Rückkehr zur Rasse». Ein Buch, dem latenter Rassismus und Sexismus vorgeworfen wird, weil es ein bürgerliches Gerechtigkeitsversprechen zerlegt: das Versprechen des sozialen Aufstiegs mit anderen Mitteln als Sex (Frauen) oder Kriminalität (Männer). Wolfe ist damit einmal mehr ein Sprengsatz gegen die politisch Korrekten gelungen, die beim gepflegten Tischgespräch den Multikulturalismus beschwören, aber noch vor dem Dessert wortreich begründen, warum sie ihre Kinder in eine Schule mit weniger Ausländern versetzt haben.
Schauplatz des Gemetzels ist Miami, wo die Latinos die Anglos, die weissen Amerikaner, verdrängt haben. Ganz unten: die crackdealenden Schwarzen. Ganz oben: die kunstsammelnden, sabbernden Russen. Gewohnt süffig, in der Tonalität gewohnt laut, bisweilen nah an der Schmerzgrenze, beschreibt Wolfe eine entlang der ethnischen Herkunft auseinandergebrochene Gesellschaft, in der sich das Zusammenleben der Kulturen in einem Satz beschreiben lässt: «Everybody hates everybody.» Wer in der Gesellschaftspyramide dabei gerade ganz oben oder unten ist, spielt für die Moral keine Rolle: Es geht überall nur um Geld, Macht und Sex. Und: Wer darin ein konservatives Manifest gegen den Multikulturalismus sieht, schliesst vor dem Spiegel die Augen.
Zur Bestform läuft Wolfe dort auf, wo er die Schicht der Seinen aufspiesst. Die Eitelkeiten und Abgründe des dauererregten Kunstmarkts an der Art Basel Miami Beach beschreibt Wolfe herausragend. Schwach ist er dort, wo seine Beobachtungen in peinliche Phantasien abgleiten, wenn sich zum Beispiel eine 20jährige nach dem «Vorbild von Posh Spice» aufsext, was ernsthaft kein Mädchen dieser Generation tut, weil kein Mädchen dieser Generation mehr die Spice Girls kennt. Da karikiert sich Wolfe selbst. Als dauererregten, alten Mann, der die fünfzehn Zentimeter hohen High-Heels-Absätze, die Shorty Shorts und Tangahöschen in den Pospalten der Mädchen wie ein YouPorn-Konsument nur noch durch eine undurchdringliche Glasscheibe wahrnehmen kann.
Wolfe nimmt es noch einmal richtig auf mit der Welt, sein keineswegs altersmüder Furor hat dabei so viel schmutzigen Charme, dass man ihm als Leser zeitweilige Schwächen leicht verzeiht. Und Tom Wolfe wäre nicht Tom Wolfe, wenn nicht auch sein zeitweiliges Versagen literarisch immer noch ganz grosses Kino wäre. Denn was trifft den Zeitgeist besser als die Beschreibung der Gegenwart als schlechter Porno?
Tom Wolfe: Back to Blood. München: Blessing, 2013.











