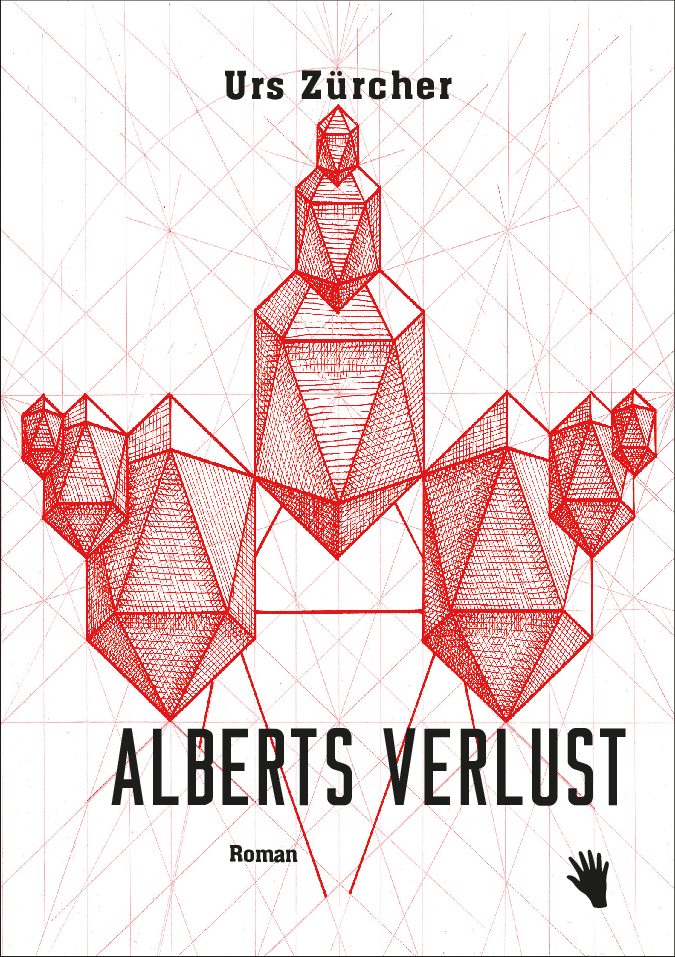Ich wollte immer
Skiliftbügelgeber werden
Für die eigene Mitte muss man manchmal am Rand stehen. Die einen nennen es selbstgewähltes Exil. Wahr ist: Wer sich finden will, muss weggehen. Nach New York, ans Meer – oder in das Häuschen eines Skiliftbügelgebers.
Ich wollte immer Skiliftbügelgeber werden. Was zusammen mit Clint Eastwood das Männlichste war, was ich mir als Kind vorstellen konnte. Braungebrannte, wettergegerbte Gesichter, immer eine Zigarette im Mundwinkel hängen und schweigsam wie die Berge. Gegen die war Hemingway nur ein geschwätziger Tourist. Diejenigen an der Bergstation hatten zudem diese kleinen, engen Holzhütten, in denen sie es warm hatten und wahrscheinlich Pornoheftchen lasen, während draussen ein Schneesturm am Gipfelkreuz rüttelte. War es sonnig, lümmelten sie vor der Hütte auf einem Holzstuhl, den sie in den Schnee gerammt hatten, neben sich ein Transistorradio, Popmusik dudelte modisch vor sich hin. Sie trugen verspiegelte Sonnenbrillen. Mädchen konnten doch gar nicht anders, als sich gleich nach dem korrekten Abbügeln in diese Bademeister der Berge zu verlieben. Als Junge waren sie meine Idole. Während andere Kinder davon träumten, Astronaut, Rockstar oder Geheimagent zu werden, wollte ich mein Leben lang Skiliftbügelgeber sein. Wie sich bald herausstellte, löste dieses Lebensziel nur Gelächter und Kopfschütteln aus, doch das war mir egal. Gleich nach der Schule wäre ich in den Beruf eingestiegen, hätte märtyrergleich alle Spötter ertragen und mein Leben der Coolness geweiht. Skiliftbügelgeber sind einsame Wächter des Tempels der Lässigkeit. Nicht mal die flotten Skilehrer konnten neben ihnen bestehen. Während diese Touristenflittchen mit deutschen Zahnarztgattinnen oder pubertierenden Skilagergruppen in Böglein die Pisten hinunterschönten, wartete der Skiliftbügelgeber auf seine Stunde. Er hatte Zeit. Nachdem der Tag vorbei war, die bunten Overalls von den Pisten verschwunden waren und die Hänge wieder den Bergdohlen gehörten, fand seine letzte Muratti ihr zischendes Ende im Schnee. Er war nun Urheber jeden Geräuschs. Ausser ihm Stille. Die Nacht nicht mehr weit. Ein letzter Blick auf den Skilift, der nun lebloser Teil der Dämmerung war. Die Bügel zuckten wie aufgehängte Skelette in elektrisch geladener Luft. Dann schnallte er die Skier an und schnitt durch den Schnee, den die Kälte wieder hart und harsch hatte werden lassen. Er verschwand im langsam vom Tal heraufziehenden Nebel. Oder in einer Berghütte, wo Bündnerfleisch gegessen und Schnäpse getrunken wurden. Ich hatte klare Vorstellungen und war vorbereitet auf ein ehrliches, einfaches Leben. Doch es kam alles anders. Erst wurden die Selbstbedienungslifte eingeführt, dann tauchten die Snowboarder auf. Und ich hatte gelernt, wie es sich anfühlt, wenn nichts je wieder so sein würde, wie es mal war.
Jahre später dann Hamburg. Eine derbe Stadt. Steter Regen und frischer Wind, die Hauswände verwaschen, das Kopfsteinpflaster blankgeschrubbt, bei Sturm fliegt ein Hund am Fenster vorbei. Keine gelbe, satte Sonne, sondern Fluten von Licht, wenn das Wetter wechselt. Über all dem ein Himmel, der jederzeit die Erde verschlingen könnte. Lodernde Schlachtengemälde gleich über der Dachrinne, gold, dunkelrot, tiefblaue Schlieren, und Sekunden später reisst das gigantische Gewölk auf und ein einziger Sonnenstrahl erleuchtet eine schäbige Häuserzeile, als würde in ihr der nächste Messias geboren. So etwas geschieht hier mehrmals täglich und zweimal hat mich die Liebe in diese Stadt geführt. Nach wenigen Monaten nimmt man den Regen nicht mehr wahr und spürt den Wind auch dann, wenn er nicht weht. Wer je in Hamburg gelebt hat, dem kommt jede andere Stadt stickig vor. Unten am Hafen gibt es einen Strand voller Glasscherben und Badetüchern und ab und zu schwimmt ein Hochhaus vorüber, flankiert von bulligen Schleppern, die im gewaltigen Industriegebiet für aller Herren Länder malochen. Ins Wasser geht hier keiner, das ist auch gar nicht nötig, das Strandleben ist das beste der Welt. Doch wieder kam alles anders.
Auf malerischen Fahrten durch deutsche Lande realisierte ich, dass mir grenzenlose Weiten nur grenzenlose Ödnis waren. Freiheit bedeutete für mich Aufbruch, Hindernisse und Grenzen zu überwinden, auf die andere Seite zu blicken. Was fing man da an mit einer Landschaft, in der ein jeder schon im Lehnstuhl erkennt, dass am Ende des Horizonts die gleichen uniformen Bäume stehen? Es war das Flachland, das mich zum Bergsteiger machte. Ich begann an einer acht Meter hohen Kletterwand in einem Eppendorfer Sporttempel, wo Models, Friseure und Werber an Maschinen um Fitness rangen und dabei fernsahen. Hinter ihnen in einer Ecke hing ich an zwei Fingern an einem Plastikgriff, hatte Todesangst, schwitzte, zitterte und fühlte mich am Leben wie schon lange nicht mehr. Die Berge, sie hatten mich eingeholt.
In diesen Tagen erhielt ich eine Anfrage aus New York. Die Bündner Künstlerin Leta Peer hatte aus der Erinnerung die Höhenzüge ihrer Heimat gemalt, gewaltig und schön, eingehüllt in schmutzige Nebel oder mit glühenden Flanken, unerbittlich realistischer, rasend schöner, schierer Fels. Für die Monografie sollte ich einen Beitrag verfassen, ich sei frei. Draussen verwehten die dumpfen Hörner der Frachtschiffe, und ich schrieb eine vage Kindheitserinnerung auf. Einen Monolog über Skiliftbügelgeber.
Zwei Jahre später war die kleine Hymne in einem Buch erschienen, vertont worden und Teil einer Ausstellung gewesen. Es gab nun Merchandising, Menschen, die T-Shirts mit Skiliftbügelgebern trugen, und für mich war es höchste Zeit geworden, persönlich nachzusehen, was dran war an dieser Nostalgie, die sich verselbständigt hatte. Ich nahm meine Kamera und machte mich auf in die Berge. Ich lebte längst wieder in der Schweiz.
Einer der ersten Arbeiter, den ich fragte, ob ich ihn und den Lift fotografieren dürfe, antwortete: «Manchmal scheint das Licht rosarot. Dann wieder ist alles so klar, es tut fast weh. Hier oben wirst du ruhig, ganz ruhig.» Sein Blick ging an mir vorbei in die Ferne. Ich dagegen lugte in den überquellenden Aschenbecher, um den Jointstummel zu finden. Ich traf einige, die sich in ihren Vogelhäuschen die Augen rot kifften und vom monotonen Klickern der Bügel ins Nirvana getragen wurden. Irritierender jedoch waren all die jungen Typen mit den Volcom-Käppis, den weiten Snowboardhosen mit obligatem Nietengurt und dem Hip-Hop im CD-Player, die, wenn sie den Mund aufmachten, langsame, überlegte Sätze sprachen über den Wildwechsel, die knisternde Luft auf 2500 Metern oder den Anblick des immer gleichen Bergs, der doch jeden Tag anders sei – für den, der sehe. Ich machte meine Fotos und den Skiliftbügelgebern zuliebe auch ein paar Aufnahmen der umliegenden Gipfel, die ich gleich wieder löschte. Sie waren nicht, weswegen ich gekommen war. Ich wollte Porträts, ich wollte echte Bilder, die meine romantisierende Projektion ersetzten.
Einen ganzen Winter verbrachte ich mit den kleinen bunten Pistenplänen, die mir anzeigten, wo überhaupt noch Schlepplifte in Betrieb waren. Ich stellte schnell fest, dass ich einer aussterbenden Art nachjagte.
Die Zukunft der Bergbahnen lag im flauschig gepolsterten Sessellift mit Sitzheizung. Bequemer und schneller schaufeln sie Wintersportler zu viert, zu sechst oder zu acht auf die Pisten, wo heute das Gedränge herrscht, das ich früher nur vom Anstehen am Skilift kannte. Als riesenhafte Ufos thronen die futuristischen Stationen auf den Gipfeln wie Träume von Ken Adams. Das hat eindeutig mehr Grösse als die lottrigen Lifthäuschen mit Sonnenbänklein davor. Nur leider sitzen darin keine Skiliftbügelgeber mehr, sondern Uniformierte mit dem leeren Blick von Fabrikarbeitern. Mit jeder Tageskarte, die mich solche Skisportanlagen traversieren liess, um zum letzten verbliebenen Skiliftbügelgeber zu gelangen, wurde deutlich, dass ich keiner persönlichen Reportage nachging, sondern der Dokumentation einer untergehenden Welt. Und dass ich mich besser mal beeilte.
Ergiebiger für meine Porträtsammlung waren die Skigebiete in den Ausläufern der majestätischen Berge. Hügel mit zwei Liften, deren Öffnungszeiten sich auf das Wochenende oder den freien Mittwochnachmittag beschränkten. Hier bügelten die Chefs noch persönlich. Meist freundliche Bauernsöhne, die den Lift aus Spass betrieben, wie andere Modelleisenbahnen. Natürlich bedienten sie eine ganz andere Klientel. Hier traf ich auf Familien, die ein Picknick im Weissen abhielten. Auf Senioren, die in Overalls aus den 80ern vorführten, wie elegant einst geschwungen wurde. Ganz selten, aber doch, tauchte auch ein Snowboarder auf, in Combathosen und schillernden Goggles, wie ein Ausserirdischer am Schwingfest. Zu Gesicht bekam man ihn nur am Lift, nie auf den Pisten. Einige dieser Gebiete waren die streng gehüteten Geheimnisse von ein paar Freeridern, die um nichts in der Welt ihre Abfahrten auf der unberührten Seite des Bergs verraten würden. The Beach in der Innerschweiz. Doch derlei kümmert die Skiliftbügelgeber wenig.
Sie bräunen sich auf Bürostühlen oder sitzen in eisenbeschlagenen Türmchen und blicken hinab auf die Comédie humaine. Bereits nach wenigen Wochen hatte ich über fünfzig Männer und drei Frauen porträtiert und immer noch nicht genug. Ich hatte Surfer kennengelernt, Älpler, Herrgottsschnitzer, Traveller, Aussteiger jeder Sorte, Handwerker, alles in allem die entspanntesten Menschen der Welt. Mit heiligem Ernst gingen sie den Obliegenheiten eines Schleppliftbetreibers nach, niemals nachlässig und mit aufmerksamem Humor. Ungerührt legten sie ihre Lassiter-Lektüre beiseite und liessen sich ablichten. «Ich sitze den ganzen Tag hier und komme sowieso zu nichts. Da stellt sich immer jemand neben mich und redet über die Börse, die Frau oder den Berg.» Ob sie nun nach der Arbeit die Kühe versorgten oder an die Pimpsʼn’Players-Party gingen, eines hatten sie alle gemeinsam: Nachteile des Jobs waren ihnen unbekannt. Kein Wort über Monotonie, Langeweile, arrogante Touristen oder die Zerstörungswut von Skilagerklassen. Nichts, was meine schwärmerische Kindersicht hätte erwachsener machen können. «Ein guter Beruf», «Herrliche Arbeit», «Schon schön», «Also ich bin gern hier oben».
So kam ich nicht weiter. Bis mir einer zuraunte: «Das wär was für einen Schreiber wie dich. Die Ideen, auf die du hier oben so kommst…. crazy maaahn.» Worte, die mich ahnen liessen, wo der wahre Zauber dieser Hütten lag. Einmal entdeckte ich zwar ein Set Schiffeversenken, das über Funk gespielt worden war, aber sonst: Nachdenken, Nachdenken, Schneeflockenmeditation und das Meer der Ruhe. Einzig unterbrochen von der Sehnsucht, gegen die nur der Stihl-Kalender hilft. Bikinigirls mit Laubgebläse, Tangas zu orangen Schutzgummistiefeln und eindeutige Posen mit Motorsäge. Doch der wahre Freund in diesen einsamen Stunden schien der Kugelschreiber zu sein. Überall wucherten sie hervor, blaue Kritzeleien, kleine Nymphen an Wänden, Decken, Lampen, Tischen. Zwischen Fotos von Kühen und Pistenbullys, neben Häkeldeckchen und auf der «Schweizer Illustrierten». Frauen in Blau. Für einen kurzen Moment stand ich wieder am Hafen, sah die Zeichnungen im Schaufenster der Ältesten Tätowierstube Deutschlands und St. Paulis erste Instanz für Seemänner und deren Romantik. Noch so Leute, die immer wegmüssen, um zu werden, wer sie sind.
Der Turm, auf dem wir standen und über die wallenden Nebel und den Skilift blickten, schwankte und ächzte leicht. Auf einmal wurde mir auch klar, weshalb ein kleiner Junge in den Leuten am Skilift so viel mehr sehen konnte als im Skilehrer, dem fidelen Hüttenwirt und den anderen Klischees der Alpenwelt.
Skiliftbügelgeber sind die Matrosen – nicht die Stewards.