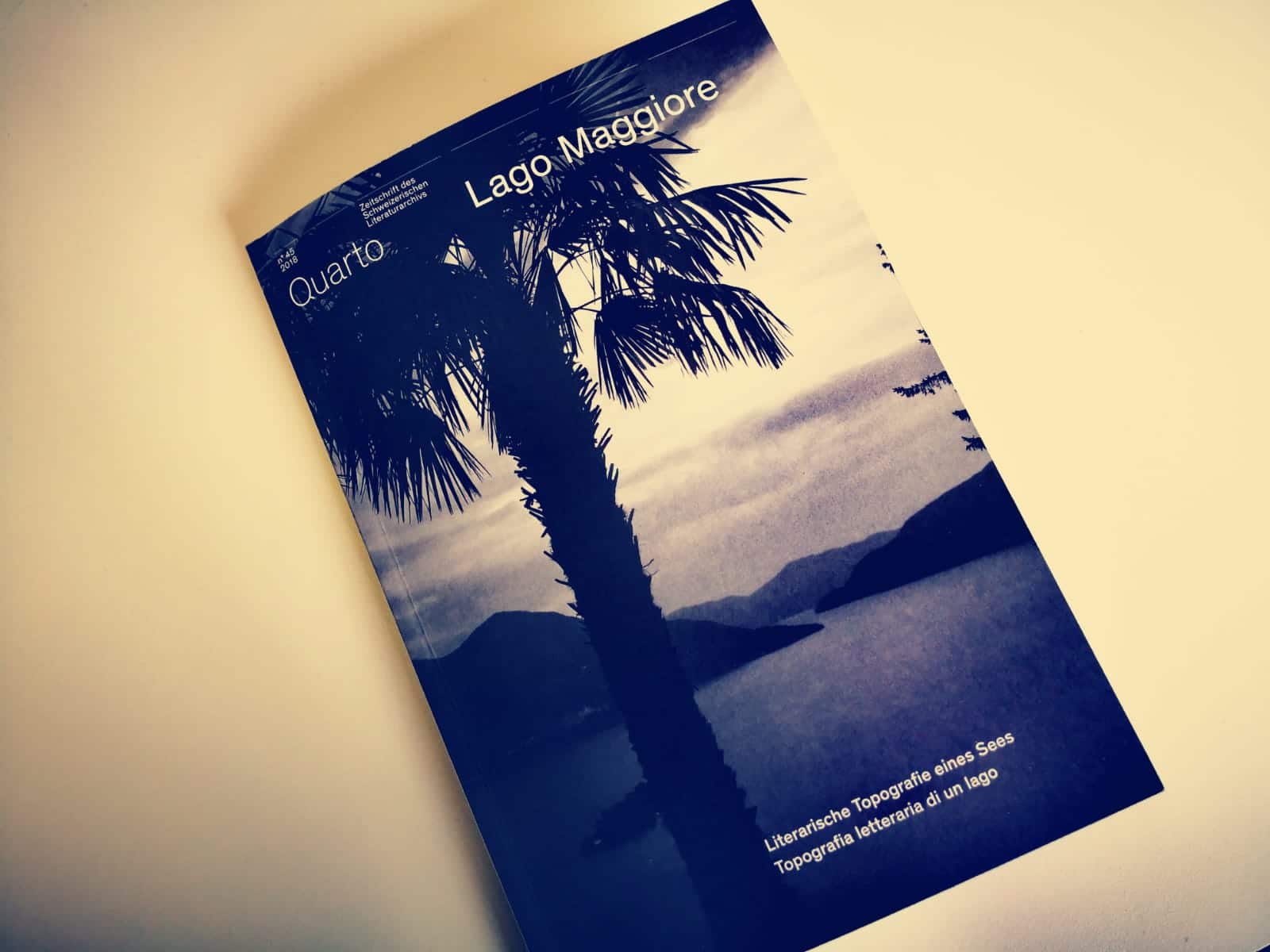Ohne Westschweizer Standpunkt
Der literarisch-politische Röstigraben gehört zur Schweiz. Das Problem ist, dass dort nicht mehr gestritten wird. Debatten und Dynamik sind der Gleichgültigkeit gewichen. Das kann auch eine verfehlte Kulturpolitik nicht beheben.
Wenn in Zukunft die Züge Verspätung haben, hat das mit unserem einzigen Literaturnobelpreisträger zu tun. Denn auch «für uns als SBB CFF FFS» bleibt Carl Spitteler «täglicher Ansporn, unser Bestes zu geben». Die dreisprachige Bundesbahn ist als Sponsorin im Patronatskomitee «100 Jahre Nobelpreis», das sich unter der Präsidentschaft von Alain Berset seit Beginn des zu Ende gehenden Jahres mit den Feierlichkeiten befasst, vertreten. 1918, am Ende des Ersten Weltkriegs, war die höchste literarische Auszeichnung nicht vergeben worden. Spitteler bekam sie laut offizieller Begründung für sein Werk «Olympischer Frühling» – zweifellos aber genauso für seine Rede «Unser Schweizer Standpunkt», die er bei Ausbruch des Kriegs auf Einladung der Neuen Helvetischen Gesellschaft gehalten hatte. Auf sie und Spittelers «Kohäsionsgedanken» berufen sich die SBB in ihrem verdienstvollen Bemühen um den Zusammenhalt der Nation.
Zum Auftakt des Zentenariums hatte Alain Berset eine Rede über Spitteler gehalten: «Betrachtungen eines Politischen». Gemeint waren wohl beide, als Motto für die Feierlichkeiten wählte Berset einen Satz aus «Unser Schweizer Standpunkt»: «In der Schweiz sehen wir von niemandem ab. Wäre die Minorität noch zehnmal minder, so würde sie uns dennoch wichtig wägen.» Natürlich, so Berset, «ist diese Aussage Spittelers von 1914 auch heute noch gültig».
Nur hat sie das Patronatskomitee mit seinen Phrasen und seiner Agenda auf peinliche Weise ad absurdum geführt. Insgesamt sind zwanzig Persönlichkeiten, die Carl Spittelers Verdienste um den gesamtschweizerischen Zusammenhalt in einem historischen Moment existentieller Bedrohung beschwören, in ihm vertreten. Doch es fehlen jegliche Schweizer aus Genf, der Waadt, Neuenburg, Jura, Wallis – und der westlichste Vorposten der Veranstaltungen scheint La Neuveville am Bielersee zu sein. Eine Generation nach der Abstimmung über den EWR-Beitritt, die dem Land die schwerste Belastungsprobe seit dem Auseinanderdriften im Ersten Weltkrieg bescherte, zelebriert die Deutschschweizer Mehrheit die wiedergefundene Einigkeit und ihren Schweizer Standpunkt unter Ausschluss der Romandie.
Nobelpreisträger Spitteler: Literatur als Realpolitik
Im ominösen Jahr 1992 dachte kein Mensch an Carl Spitteler. Nicht einmal die SVP, die in der Westschweiz über ähnlich wenige Anhänger verfügte wie in der Kulturszene, hatte ihn in Erinnerung. Die Schweiz, spottete der grosse Historiker Jean Rudolf von Salis am Ende des Kalten Kriegs, habe sich aus der Geschichte verabschiedet. Untergangsfantasien wie der Vergleich mit dem Stück Zucker, das sich im Wasser auflöst, oder einem Gefängnis, das von lauter Freiwilligen bewohnt wird (Dürrenmatt), machten die Runde. «La Suisse n’existe pas» lautete das Motto, unter dem sich die Schweiz 1992 an der Weltausstellung in Sevilla präsentierte. Die Neutralität war zum Papiertiger verkommen – Spitteler hatte sie ins Zentrum seiner Rede gestellt, als die «Stimmungsgegensätze» innerhalb des Landes eine existentielle Bedrohung darstellten. Die Deutschschweiz sympathisierte mit den Deutschen, die Welschen hielten es mit Frankreich. Spittelers Rede, gehalten am 14. Dezember 1914 in Zürich, ist zweifellos der wichtigste Beitrag, den je ein Intellektueller zur Neutralität leistete.
«Unser Schweizer Standpunkt» ist kein pazifistisches Manifest; noch ist niemandem bewusst, in welche Schlachterei der Krieg münden wird. Genauso wenig ist die Rede ein Plädoyer für die Abschottung von der Welt und den Rückzug in ein «Réduit» als Strategie der militärischen und geistigen Landesverteidigung. «Unser Schweizer Standpunkt» ist eine durch und durch realpolitische Analyse: «In der Tat lässt sich die ganze Weisheit der Weltgeschichte in einem einzigen Satz zusammenfassen: Jeder Staat raubt, so viel er kann. Punktum.» Der Autor analysiert die Beziehungen der Schweiz zu fremden Staaten – auch England und Serbien – und legt dar, warum sie nicht unsere Feinde sind. Aber nie werde man Freunden und Nachbarn unbegrenzt vertrauen können. Andere Länder mögen sich durch «Diplomatie, Übereinkommen und Bündnisse einigermassen vorsehen», der Schweiz, «die ja keine hohe auswärtige Politik betreibt, fehlt dieser Schutz der Rückversicherung».
Auch die «politische Einheit» im Innern des Landes kann diesen Schutz nicht garantieren. Aber in Zeiten des nationalistischen Wahns und Imperialismus ist sie eine Voraussetzung für das Überleben des Kleinstaats, in dem sich drei grosse europäische Kulturen überschneiden: «Wir haben nicht dasselbe Blut, nicht dieselbe Sprache, wir haben kein die Gegensätze vermittelndes Fürstenhaus, nicht einmal eine eigentliche Hauptstadt.» Gegen diese «Elemente der Schwäche» hisst er «die eidgenössische Fahne» als Symbol der Schicksalsgemeinschaft: «Die Deutschen sind unsere Nachbarn und die Welschen unsere Brüder, die auf unserer Seite wären, falls die Nachbarn Lust verspüren könnten, über unsere Zäune zu klettern.»
Mit vollem Risiko in die öffentliche Arena
Historisch war der Moment, aussergewöhnlich die Wirkung. Spitteler ging ein gewaltiges Risiko ein und wusste es. Ferdinand Hodler war wegen seiner Kritik an der Bombardierung der Kathedrale von Reims in Deutschland in Ungnade gefallen. In der Schweiz hielt sich die Zahl von Spittelers Lesern in Grenzen. Aus Deutschland aber, wo er verlegt wurde, «blüht mir Sympathie und Zustimmung wie ein Frühling entgegen, unabsehbar, unerschöpflich».
Ausführlich befasst sich Alfred Berchtold, der grosse Historiker der Schweizer Kulturgeschichte, in seinem nie ins Deutsche übersetzten Standardwerk «La Suisse Romande au cap du XXe siècle» (1964) mit dem 1845 in Liestal geborenen Spitteler, der sich im Alter von 17 Jahren dafür entschied, «Dichter – europäischer Dichter» zu werden. Dem Dialekt verweigerte er sich, auch privat sprach er nur Hochdeutsch. Er soll sogar erwogen haben, seinen ersten «Prometheus» auf Hebräisch zu schreiben. Spitteler ging es laut Berchtold «in der Nachfolge von Keller und Gotthelf um ‹ein Los von Seldwyla› und neue Horizonte».
Auch mit Charles-Ferdinand Ramuz vergleicht er ihn. Beide richteten ihre ganze Existenz auf das Schreiben aus: «Sie entfernen sich vom klassischen Modell des in die Gemeinschaft integrierten, dem pädagogischen, politischen und sozialen Apostolat geweihten helvetischen Schriftstellers.» Nur einmal, so Berchtold, ist Carl Spitteler, dieser «Exilierte im eigenen Land», von seinem Olymp in die «öffentliche Arena heruntergestiegen, um eine einstündige Rede zu halten». Er «hat mit seinem Text gekämpft, jedes Wort abgewogen und später keines bereut». Wie Hodler geisselte Spitteler den deutschen Einmarsch in Belgien, das die Schweiz «an sich nichts, dagegen durch sein Schicksal ausserordentlich viel» angehe. Umgehend schlug ihm eine Welle der Empörung entgegen. «Spitteler wird bei uns nie mehr die geringste Rolle spielen», drohte das «Stuttgarter Neue Tagblatt»: Schon im anstehenden Weihnachtsgeschäft werde man ihm den Affront heimzahlen.
In der Deutschschweiz stiess die Rede keineswegs nur auf Zustimmung. Die welsche Presse hingegen verklärte Spitteler umgehend zum «grand homme, grand citoyen, grand poète» (Berchtold). Die Genfer Schriftsteller bereiteten ihm einen «triumphalen Empfang», bei dem Grussbotschaften führender französischer Intellektueller wie Henri Bergson und Edmond Rostand verlesen wurden. Die Franzosen, die ihn bislang ignorierten, begannen sich für ihn zu interessieren, einzelne seiner Werke wurden übersetzt. Spitteler selbst regte an, ein Westschweizer möge sich in gleicher Weise an seine Mitbürger wenden. Paul Seippel, der Redaktor beim «Journal de Genève» war und als Romanist an der ETH Zürich lehrte, nahm sich der Aufgabe an – und löste ebenfalls heftige Kontroversen aus. Seippel war mit Romain Rolland befreundet, der die Kriegsjahre in der Schweiz verbrachte und im «Journal de Genève» die berühmt gewordene Artikelserie «Au-dessus de la mêlée» – über dem Kriegsgetümmel – veröffentlichte. Rolland, der grosse Versöhner zwischen Deutschland und Frankreich, hatte den Nobelpreis 1915 bekommen und setzte sich für die Vergabe an den Schweizer Dichter ein. Seippel und Spitteler engagierten sich nach dem Weltkrieg für den Beitritt der Schweiz zum Völkerbund, den die Siegermächte begründeten, die nach «aufwendigen Verhandlungen die Neutralität der Schweiz anerkennen werden», berichtet Berchtold, der in späteren Jahren Bücher über Wilhelm Tell, Jacob Burckhardt, Pestalozzi oder «Basel und Europa» schrieb.
Hürlimann und Walter: ratlos am See
1992, als die neue Schweizerische Volkspartei einen Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum EWR zur Frage von Anpassung oder Widerstand hochstilisierte, sassen Thomas Hürlimann und Otto F. Walter, der wenige Jahre zuvor seinen Weltkriegs- und Familienroman «Zeit des Fasans» veröffentlicht hatte, am Vierwaldstättersee. Genau hundert Jahre zuvor hatte Spitteler seinen Lebensmittelpunkt nach Luzern verlegt, wo seine wichtigen Werke entstanden und er seine Rede schrieb. Auch für die beiden politisch engagierten Schriftsteller blieb Spitteler, der im Nachkrieg wegen seiner Instrumentalisierung durch die geistige Landesverteidigung in Ungnade gefallen war und von der Germanistik nach Emil Staiger ignoriert wurde, bei ihrer Schweizer Standortbestimmung für Europa jenseits des Horizonts.
«Walter war krank bis auf den Tod, aber dennoch liess ihn das Schicksal des Landes nicht los», beschrieb Hürlimann in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» ihren Nachmittag. «Hoben wir den Blick, sahen wir zur Terrasse herüber, wo vor gut hundert Jahren der grosse Keller sass.» Alfred Berchtold porträtiert ihn im Vergleich zu Spitteler als «Handwerker-Poeten, Schriftsteller-Bürger, Beamten-Dichter». Zu Kellers Siebzigstem hatte der Bundesrat ein Telegramm geschickt. «Dann loderten auf allen Höhen die Feuer, sie feierten ihn, den Staatsdichter, und erinnerten Keller an seine ursprüngliche Absicht, den ‹Martin Salander› mit einer Brandkatastrophe enden zu lassen.»
«Wie hätte er gestimmt?», fragten sich Hürlimann und Walter am Ende des Kalten Kriegs. Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt waren 1991 und 1992 gestorben. Sie hätten den Nobelpreis verdient, den ersten nach dem Zweiten Weltkrieg hatte der Wahlschweizer Hermann Hesse bekommen, im Jahr der EWR-Abstimmung ging er an Elias Canetti, einen aus Bulgarien stammenden jüdischen Dichter englischer Staatsbürgerschaft, deutscher Sprache und mit Schweizer Wohnsitz. Wie Dürrenmatt, Frisch oder Spitteler abgestimmt und Canetti argumentiert hätten, interessierte die ratlosen Schriftsteller am Vierwaldstättersee nicht. Von Gottfried Keller wollten sie es wissen: «Und waren der Meinung, dass die Schweiz nochmals den Mut zum Sonderfall haben müsste. Die Eurokratie lehnten wir ab. Unsere Bürgerrechte wollten wir bewahren. Sollte es uns gelingen, die jüngste Geschichte aufzuarbeiten, würden wir eine Chance haben, die real existierende Schweiz ihrem Ideal näherzubringen.»
Rhetorischer Bürgerkrieg zu intellektueller Neutralität?
Unmittelbar allerdings löste der hauchdünne Ausgang der Abstimmung – im Sinne der Intellektuellen Walter und Hürlimann – einen rhetorischen Bürgerkrieg aus. Denn die Westschweizer Kantone hatten mit bis zu 80 Prozent für den Beitritt gestimmt, und bei der Aufarbeitung der Kriegsvergangenheit, die erst so richtig in Gang kam, bremste am meisten die SVP, die aus der EWR-Abstimmung als führende Partei und ideologische Bewegung hervorging.
Hat sie inzwischen auch die klugen Köpfe der Intellektuellen kolonialisiert? Die junge welsche Literaturvermittlerin und Übersetzerin Camille Luscher hat den besten Beitrag zum Nobelpreisjubiläum vorgelegt: einen auf Italienisch, Deutsch und Französisch erschienenen Sammelband «Neue Schweizer Standpunkte: Im Dialog mit Carl Spitteler» (Rotpunktverlag). «Jedenfalls war ihr Verfasser Europäer», hebt Adolf Muschg in seinem Beitrag zu dessen Standpunktrede hervor. Zur Illustration der Deutschschweizer Deutschtümelei erinnert er an den Besuch von Kaiser Wilhelm 1912 und empfiehlt Meinrad Inglins «Schweizerspiegel» zur Lektüre: «Auch meine Mutter», so Muschg, «berichtete noch schamhaft von einer grossen Frontkarte im elterlichen Schlafzimmer, auf der der Vater den Vormarsch deutscher Truppen mit Fähnchen absteckte und deren Siege er durch Erfüllung ehelicher Pflicht mitfeierte.»
Als Appell zur «Brüderlichkeit» will Muschg die einflussreichste Rede, die je ein Schweizer Schriftsteller hielt, verstehen. Ein «Phantom der Literatur» sei sie geblieben, und damit erklärt er, warum «Spitteler nicht zu unseren Klassikern» gehört: «Spitteler zeigt sich engagiert, in dem er sich nicht engagierte.» Als «naheliegend, aber taktlos» stuft Muschg Spittelers Vereinnahmung durch die geistige Landesverteidigung ein. Seine Fahne habe nichts mit jener gemein, «um die die Landesausstellung von 1939 ihr ‹Schweizervolk› scharen wollte». Für Muschg evoziert sie vielmehr «das Kreuz, das sehende Mitbürger mit der Schweiz haben». Oder: hatten? Die Genfer Schriftstellerin Pascale Kramer ist «Eine ewig Fremde in Frankreich» geblieben und hält an ihrer schweizerischen Distanziertheit, die ihr anlässlich des Attentats auf «Charlie Hebdo» erst recht bewusst wurde, bange fest: «Wie lange werde ich mich noch weigern können, einen Feind zu bezeichnen?»
Der Genfer Schriftsteller Daniel de Roulet will erzählen, «warum ich Hodler und Spitteler schon so lange bewundere»: für ihren Mut zur Neutralität und zum Protest gegen Deutschland. Hodlers Bilder seien nach seinem Aufruf in der «Tribune de Genève» aus den Museen entfernt, seine Fresken übermalt worden. Ramuz und andere welsche Intellektuelle hielten sich bedeckt – im Gegensatz zum Dirigenten Ernest Ansermet: «Wenn es darum geht, ein Ideal zu verteidigen, sind die Musiker und die Maler zuverlässiger als die Schriftsteller.» Im Zusammenhang mit der Vergangenheitsaufarbeitung kann er sich einen Seitenhieb auf Adolf Muschgs «Auschwitz in der Schweiz» nicht verkneifen: «Mir war der Satz von Denis de Rougemont näher: ‹Als hätte sich der Kapitalismus nichts vorzuwerfen.›»
De Roulets Familiengeschichte ist eng mit beiden Weltkriegen verknüpft, Brüder standen sich in feindlichen Armeen gegenüber. Daniel war militanter Atomkraftgegner, befürwortete die Abschaffung der Armee und bekämpfte den Faschismus nicht nur mit Worten: Weil er den «Bild»-Verleger Axel Springer – im Bewusstseinsstand der Achtundsechziger – für einen Nazi hielt, fackelte er das Chalet im Berner Oberland ab. Inzwischen spricht de Roulet fast schon wie ein Nostalgiker der Mobilmachung: Im Kalten Krieg dann war «meine Generation an der Reihe». Er erzählt, wie er beim Besuch von General Westmoreland in Bern Molotowcocktails auf die amerikanische Botschaft warf, und sei heute, «mit 75 Jahren, überzeugt, im Geiste von Hodler und Denis de Rougemont» gehandelt zu haben. Hodlers Protest stilisiert er zu «einer Geste künstlerischer Kohärenz»: Treue zum Ideal bekunden, Distanz signalisieren. Von Spitteler zitiert er Zeilen, die er bei einem Besuch des Museums in Liestal notiert hatte: «Dass wir als Unbeteiligte manches klarer sehen, richtiger beurteilen als die in der Kampfleidenschaft Befangenen, versteht sich von selbst» – Daniel de Roulets Kommentar: «Man könnte meinen, er spreche vom Handwerk des Schreibens: von der Parteinahme für die Nichtparteinahme.» Nach der Epoche des Engagements hat die Neutralität – wieder – in den Köpfen der Intellektuellen Einzug gehalten.
Kein Streit, keine Debatten, keine Dynamik
Nach der EWR-Abstimmung konnte sich die SVP sogar in der Westschweiz ausbreiten. Es gibt heute keinerlei Differenzen, die den nationalen Zusammenhalt bedrohen – und das ist durchaus erfreulich. Wir haben eine funktionierende Infrastruktur, die den Kulturaustausch fördert. Der Robert-Walser-Preis in Biel/Bienne entdeckt regelmässig neue Autoren und ist keineswegs auf die Literaturen der Schweiz beschränkt. Genauso ist der Prix Lémanique in Lausanne eine Drehscheibe. In Solothurn werden beim Filmfestival wie bei den Literaturtagen die guten Beziehungen gepflegt – auch zwischen der Kulturszene und der Kulturpolitik.
Aber so ganz ohne «Stimmungsgegensätze» – kann so eine echte Auseinandersetzung miteinander aussehen? Ist das «gesamtschweizerischer Zusammenhalt»? Wann gab es den letzten Skandal? Nicht einmal der Ausverkauf praktisch der gesamten Westschweizer Presse nach Zürich, an Ringier und Tamedia, die am Röstigraben ein ordentliches Blutbad anrichteten, hat die Intellektuellen aus ihrem Schlaf aufgeweckt. Es gibt keinen Streit und keine Debatten, keine Differenzen und keine Dynamik.
Die CH-Reihe der Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit, die seit 1974 literarische Übersetzungen zwischen den Landessprachen fördert, existiert weiterhin, aber hat sie jemals einen Schweizer Schriftsteller über die Landesgrenze hinaus zu vermitteln vermocht? Selbst in der Schweiz gelingt es ihr nicht mehr, neue Autoren jenseits der Sprachgrenze durchzusetzen. Dabei gibt es sie in erfreulicher Zahl – von Elisa Dusapin über Jérôme Meizoz und Noëlle Revaz bis Jean-Pierre Rochat, um nur die Romandie zu erwähnen.
Wie begrenzt die Möglichkeiten der Kulturpolitik sind, zeigt das Beispiel des 1958 geborenen Yves Laplace. Er hat ein imponierendes, nicht immer einfaches Gesamtwerk vorgelegt, das in renommierten Pariser Verlagen erscheint. Ihm wurde 2016 einer der Schweizer Literaturpreise vergeben, die eine Teilübersetzung und eine Lesereise beinhalten – richtig vorbildlich. Laplaces preisgekrönter Roman «Plaine des héros» handelt zudem von einem sehr aktuellen Thema, dem Genfer Faschisten Georges Oltramare. Trotz all dieser Pluspunkte bleibt er unübersetzt und «Ein vorbildlicher Mann» (Lenos, 1994) das einzige auf Deutsch verfügbare Werk des auch politisch sehr brisanten Schriftstellers, der sich mit seinen Stellungnahmen zu Tariq Ramadan wie Peter Handke einen Namen machte – aber eben nur im französischsprachigen Raum.
Die Epoche, in der Corinna Bille, Alice Rivaz, Catherine Colomb, Anne Cuneo, Jacques Chessex oder Maurice Chappaz in der Deutschschweiz bekannte und gelesene Schriftsteller waren, ist vorbei. Nur Daniel de Roulet wird in beiden Landesteilen einigermassen zur Kenntnis genommen – er ist perfekt zweisprachig. Es gibt dafür vielerlei Gründe: Der Vormarsch des Englischen als «fünfte Landessprache der Schweiz» («Le Temps»), die Ausdünnung der Feuilletons wie der Verlagslandschaft. Die legendären «Welschland»-Korrespondenten Marcel Schwander («Tages-Anzeiger») und Otto Frei (NZZ) haben keine Nachfolger gefunden.
Alain Claude Sulzer wurde in Frankreich dank seines französischen Verlags und eines angesehenen Literaturpreises als «écrivain suisse» bekannt – und auf dem Umweg über Paris auch in der Romandie rezipiert. Martin Suter brauchte keine Unterstützung der eidgenössischen Kulturpolitik. Noch weniger wird Joël Dicker, dessen Romane internationale Bestseller sind, als «Schweizer Schriftsteller» wahrgenommen: Ihn hat das Lausanner Haus L’Age d’Homme mit seinem Pariser Partnerverlag lanciert. Und schon mal was von Max Lobe gehört? Er stammt aus Kamerun, lebte im Tessin und jetzt in Genf, wo seine Bücher erscheinen. Lobe ist ein Star nicht der welschen Literatur, sondern der weltweiten Frankophonie: Für beide ist das Interesse in der «Suisse allemande» beschämend gering.
Man könnte diese Liste schier ewig fortschreiben. Hat hierzulande jemand zur Kenntnis genommen, dass «Im Bauch des Wals» des bald neunzigjährigen Aargauer Dichters Paul Nizon von «Le Monde» auf die Liste der hundert besten Bücher seit Bestehen der Zeitung gesetzt wurde? Eine Liste, auf der weder Frisch noch Dürrenmatt zu finden sind. Nizon, der sich der helvetischen «Enge» und ihrem Diskurs verweigerte, hat seine literarische Utopie im Ausland, in Paris, und weitgehend ohne Dialektik mit der Heimat verwirklicht. Falls ihn Nizon – oder der 94jährige Philippe Jaccottet, der ebenfalls in Frankreich lebt – nicht bald bekommt, werden wir sehr viel länger als ein Jahrhundert auf das zweite Zentenarium eines Schweizer Literaturnobelpreises warten müssen.
Geht nach den Parlamentswahlen des Herbsts 2019 die SVP-Sonne im Westen unter? Kehrt unser Land in die Geschichte zurück? Noch immer gehen die Schweizer Uhren anders. Wir leben in Frieden miteinander und die Kluft zwischen der Politik und der Kultur ist heute so untief und unproduktiv wie der Röstigraben. Der Gottfried-Keller-Preis wurde nicht geteilt, sondern doppelt in Minne vergeben an Thomas Hürlimann und Adolf Muschg, die Fahnenträger der einstigen Europadebatte, die inzwischen richtig anachronistisch anmutet. Das ist, hundert Jahre nach Spitteler, die real existierende Schweiz: tödliche Gleichgültigkeit und Ignoranz haben die «Stimmungsgegensätze» abgelöst. Alfred Berchtold, der Spitteler für einen Klassiker hielt, ist Ende Oktober verstorben. Kein Deutschschweizer Medium hat ihn, Irrtum vorbehalten, mit einem Nachruf gewürdigt.