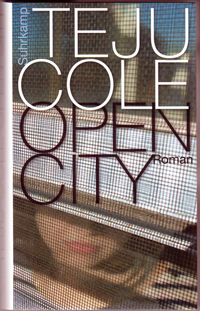
Allein unter vielen. Blick in die Dunkelkammern New Yorks
«Walk around with nowhere to go.» Bob Dylan – Talkin’ New York
Wir stadtwandern mit Julius, einem jungen Schwarzen am Ende seiner Ausbildung zum Psychiater, die Stadt heisst New York – manchmal auch Brüssel. Der Zufall aber, der wird viele Gesichter haben. Richtungslos bahnt sich Julius durch das gläserne Grossstadtdickicht, spurt Wege durch Menschentrauben, geht mit ihnen mit, im Gleichschritt, doch anders. «Anfänglich erlebte ich die Strassen als eine unaufhörliche Geräuschkulisse, ein Schock nach der Konzentration und relativen Ruhe des Tages, so als zerrisse jemand die Stille einer abgeschiedenen Kapelle mit einem dröhnenden Fernseher.»
Anfangs streifen wir – als Einübung in die Sinne – durch die ruhigeren Strassen der Upper West Side. Julius verwebt Schichten vorbeiströmender Menschen. Seine Andersartigkeit zeigt sich uns in Gestalt des Einsamen in der Menge, aber auch in seiner Hautfarbe, die in der Geschichte eine subtile Rolle spielt. Fünf Jahre sind seit dem 11. September 2001 ins Land gegangen, die Verheissung «change and hope» ist allgegenwärtig, kann aber nicht über die Topographie seiner Einsamkeit hinwegtäuschen: «Unter freiem Himmel teilte ich meine Einsamkeit mit Tausenden, in der U-Bahn, in unmittelbarer Nähe fremder Menschen, einander rempelnd im Kampf um Platz und Luft zum Atmen.» Seine innere Verfasstheit wird in den Begegnungen mit anderen Menschen und ihrer transzendentalen Obdachlosigkeit – äusserlich – in den klaffenden Narben Manhattans gespiegelt. Das Aufeinandertreffen mit anderen zeichnet einen soziologischen Querschnitt New Yorks. Das Treffen mit Farouq, einem marokkanischen Betreiber eines Internetshops, das zufällige Wiedersehen einer Jugendfreundin, die in überraschender Wendung in die Dunkelkammern der Hauptfigur leuchtet. Der Flug von New York in die belgische Hauptstadt, ein figuratives Übersetzen von der neuen in die alte Welt, wird ein Höhepunkt des Lesens. Im Flugzeug schliesst er Bekanntschaft mit einer amerikanischen Chirurgin – Dr. Maillotte. Mit ihr führt er – in der Raum/Zeit-Krümmung über den Wolken – Gespräche über das Anderssein qua Hautfarbe oder über die USA für sich und ihren abblätternden Glanz.
Die Scharen von Vögeln, die Ende des 19. Jahrhunderts – als die Fackel von Lady Liberty noch den Schiffen den Weg in den Hafen Manhattans wies – in die Irre gelenkt und durch den Aufprall verendet waren, stehen als traurige Allegorie des Unfassbaren von 9/11 am Schluss des Romans, der vieles offen lässt – im besten Sinn.
Zusammen etwa mit Chad Harbach (Die Kunst des Feldspiels) oder Kevin Wilson (Die gesammelten Peinlichkeiten unserer Eltern) wird Cole als «neue Stimme eines anderen Amerikas» kolportiert. Was auffällt: die grossen Themen der amerikanischen Gegenwartsliteratur haben sich verlagert. Der Gigantismus ist dem gewichen, was vor unser aller Augen liegt: der Sehnsucht nach dem Glück im Einfachen.
Teju Cole: Open City. Berlin: Suhrkamp, 2012.











