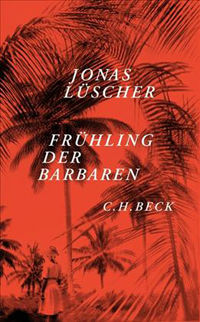
Jonas Lüscher:
«Frühling der Barbaren»
«Dass Geld nicht für sich selbst steht, lag in der Natur der Sache, das war die Idee dahinter. Warum nur versuchen sie, uns das als ihre eigene Entdeckung zu verkaufen, und warum glaubten sie, würde das irgendetwas besser machen?» Derart engagierte Gedanken gehen dem namenlosen Ich-Erzähler in Jonas Lüschers Frühling der Barbaren durch den Kopf, während er mit einem älteren Schweizer spazierengeht, der CHF 15 000 pro Tag bloss an seinen Firmenanteilen verdient, aber keine Ahnung hat, woher sein Geld eigentlich kommt. Item, wie der «Unternehmer» Preising während des Spaziergangs gern sagt. Hauptsache, es ist da, das Geld. Hauptsache, man weiss es irgendwo sicher.
Preising berichtet dem Namenlosen von einem Urlaub in der tunesischen Wüste. Vom Thousand and One Night Resort, wo der prototypisch knausrig-zurückhaltende Schweizer zufällig einer Hochzeit unter Londoner Jungbankern beiwohnt, die das exakte Gegenteil von ihm sind: schnittige Typen beim Geldverjubeln in bunten Designerbadeshorts, die «hübsche junge Dinger» zum Feiern einfliegen, deren Höschen ähnlich knapp bemessen sind wie ihr intellektueller Horizont. Die Eltern des Paares, ein Soziologe und eine Englischlehrerin, ein Gewerkschafter samt Hausfrau, betrachten das Treiben ihrer Nachkommen mit geringschätzigem Kopfschütteln, sie können intuitiv wenig mit dem verschwenderischen Habitus der Zahlenschieber anfangen. Müssen sie auch bald nicht mehr: noch in der Hochzeitsnacht meldet England den Staatsbankrott an, zu viele Banken mussten gerettet, verstaatlicht und entschuldet werden. Auf der ganzen Welt werden innert Minuten alle Vermögen in Englischem Pfund abgestossen, Bankruns erschüttern Grossbritannien bis in die sonst verschlafene Provinz. Noch bevor das verkaterte Partyvolk am Morgen seine Zelte verlässt, sind seine Millionen in die Wertlosigkeit inflationiert, Kreditkarten gesperrt, alle Jobs gekündigt. Gerade haben sie all das über ihre Blackberrys erfahren, da wird den Bankstern auch schon das Netz abgestellt. Und als die Resortleiterin sie ohne richtiges Frühstück vor die Tür setzt, wissen sie nicht einmal, dass auch ihre Rückflüge längst storniert wurden. Was tun also britische Jungbanker, wenn ihnen nichts mehr bleibt von Wohlstand und Weltbild? Richtig, sie bedienen ein weiteres Klischee und also sich am Kühlschrank, besaufen sich mit geklautem Dosenbier, kriegen Sonnenbrand am Pool. Enthemmung allerorten, eine (Un-)Kultur bricht in sich zusammen: Wenig später ermorden die Derivatehändler Teile des Resortpersonals mit Tennisschlägern, schlachten zum Spass Kamele und Hunde, brennen die Oase nieder.
Das Dominospiel zusammenklappender Finanzinstitute und Staaten ist in dieser Novelle bloss das Bühnenbild. Im Zentrum steht eine situierte Gesellschaft, deren Mitglieder sich im unhinterfragten Wohlstand eingerichtet haben, eine Gesellschaft, die bezüglich der Herkunft ihres Reichtums «die falschen Fragen stellt», aber doch «immer geahnt» hat, dass irgendetwas in der Finanzwelt nicht mit rechten Dingen zugeht. Durchexerziert werden die Folgen der tatsächlich völligen Ahnungslosigkeit an klischierten Projektionsflächen, Lüschers Protagonisten, die aus unterschiedlichsten Milieus und sozialen Schichten stammen, sich in ihrem Unwissen um die eigentliche Fragilität ihres vermeintlich sicheren Wohlstandes und des damit verbundenen Friedens aber seltsam ähneln. Dass Jonas Lüschers Debüt in den mannigfachen Charakter- und Feindbildklischees nicht untergeht, verdankt sich einerseits seinem cleveren Aufbau: Lüscher versteht es, zunächst zwei Erzähler so prominent zu inszenieren, dass einem ein bald hinzukommender dritter erst in der zweiten Hälfte des Buches überhaupt auffällt. Während erst nur der naive Preising und ein pointiert kommentierender Ich-Erzähler auftreten, wird Lüschers Novelle durch diesen dritten, allmählich lauter werdenden, herzhaft bösen und zunehmend auch sarkastischen auktorialen Erzähler zu einem runden Ganzen. Je mehr er sich als ordnende Stimme artikuliert, desto offensichtlicher kippt das leise Kammerspiel in ein karikaturistisches Weltuntergangstheater, das geschliffener kaum erzählt sein könnte. Der «Tipping Point», an dem aus Kultur urplötzlich Barbarei wird, stellt – bis auf Preising, der sein Geld in Schweizer Franken anlegte und also nie wirklich betroffen ist – den Soziologen, den Banker, die Englischlehrerin, den Gewerkschafter und auch den Leser vor drei existentielle Fragen: Was ist, wenn Märkte tatsächlich immer nur so viel wissen, wie die Menschen, die sie bedienen? Was ist, wenn uns alles, was wir immateriell wie materiell sicher glaubten, genommen wird? Und was, wenn das schon heute nacht passiert?
Jonas Lüscher: Frühling der Barbaren. München: C.H. Beck, 2013.











