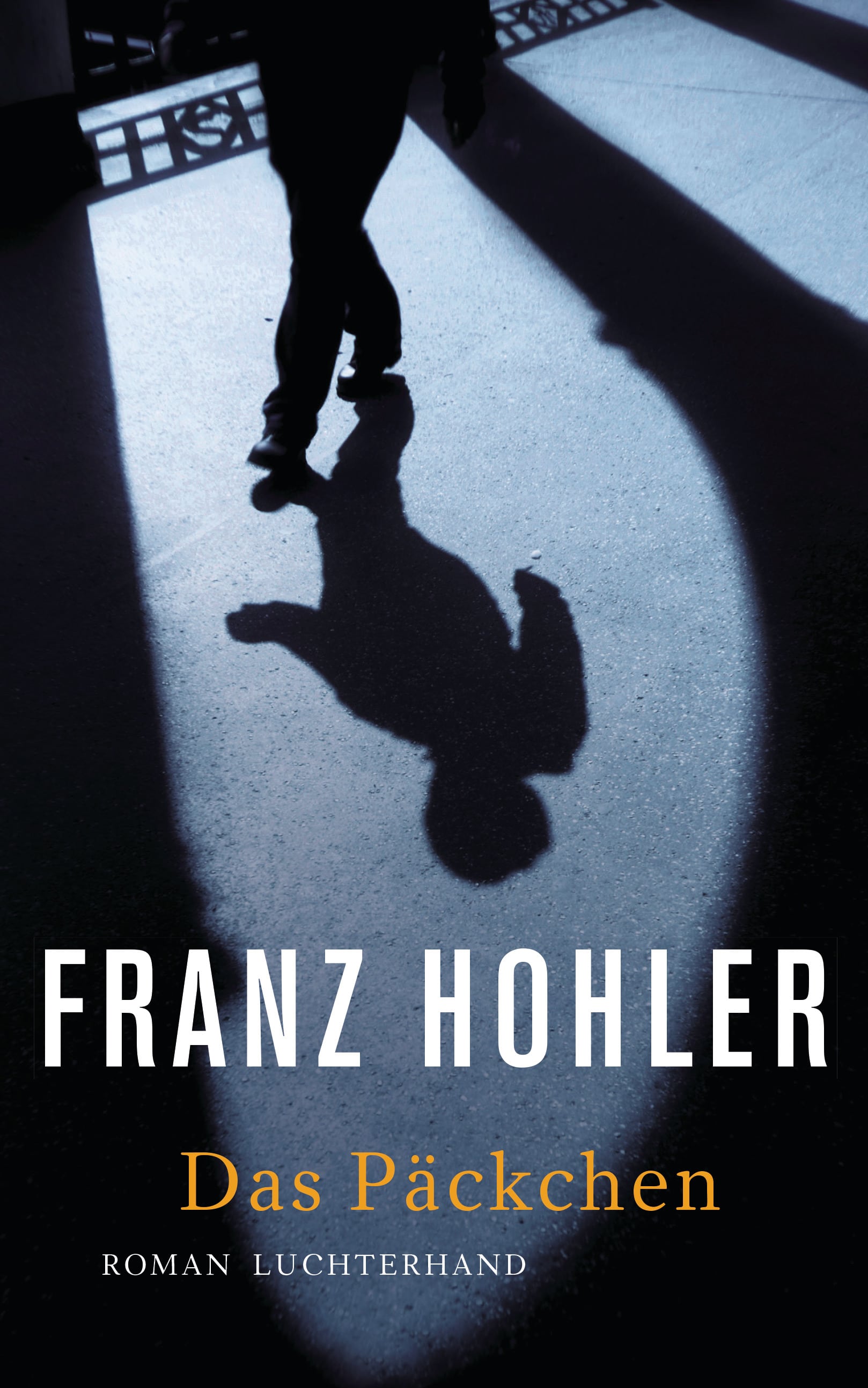Und wenn es nicht die Wahrheit ist, so ist es doch gelogen
Wie sich Geschichte und Literatur gegenseitig befruchten und ins Gehege kommen.

Der altbekannte Kinderreim von der «Kuh, die sass im Schwalbennest» behält auf jeden Fall recht mit seiner paradoxen Schlussfolgerung: «Und wenn das nicht die Wahrheit ist, so ist es doch gelogen.» Denn die Phantasie hat immer ihre Finger im Spiel. Nicht nur, wenn Kühe in Schwalbennestern hocken und Esel übers Haus fliegen. Es gibt keine Rede, keinen noch so sachlichen Bericht, in dem nicht das eine oder andere Detail perspektiviert, rekonstruiert oder akzentuiert wäre. «So wahr mir Gott helfe», schwört die Zeugin bei ihrer Vereidigung, auch wenn das hohe Gericht natürlich weiss, dass Gottes Hilfe bei der Rekonstruktion von Tatsachen nur bedingt tauglich ist.
Wer erzählt, erfindet auch. Wer sich sprechend auf die Wirklichkeit bezieht, gebraucht seine Vorstellungskraft, seine Phantasie. Er nimmt die Dinge mittels Sprache wahr. Erzählungen sind keine plumpe Wiedergabe der Realität, sie stiften Sinn, indem sie Ereignisse in einen Zusammenhang bringen. Doch wie verträgt sich diese Tendenz mit dem Anspruch auf Wahrheit und Wahrhaftigkeit? Taugt Scheherazade zur Historikerin?
Dem hätte Platon vehement widersprochen. In seinem berühmten Dialog «Politeia» (Der Staat) lässt er Sokrates mit einer fundamentalen Kritik an der Dichtkunst auftreten. Dichter seien Lügner und daher aus einem utopischen Idealstaat zu verbannen. Denn sie sprächen über nichtwirkliche Dinge so, als seien diese wirklich. Christliche Autoren pflichteten Platon später bei, und bis heute herrscht bei diversen Tyrannen die Auffassung, Schriftsteller seien, sofern sie nicht die «Wahrheit» des jeweiligen Regimes besingen, gefährliche Aufwiegler und Schmarotzer. Zensur vermeintlich lügenhafter Werke und die Verhaftung regimekritischer Autorinnen und Autoren sind nach wie vor weltweit an der Tagesordnung.
Doch schon Platons jüngerer Kollege Aristoteles machte solchen apodiktischen Bannsprüchen ein – theoretisches – Ende, indem er ein paar grundsätzliche Unterscheidungen vornahm. In seiner «Poetik», der weltweit ersten bekannten Schrift über die Dichtkunst, erläutert er den Unterschied zwischen einem historischen und einem fiktionalen Geschichtenerzähler: «der eine erzählt, was geschehen ist, der andere, was geschehen könnte.» Während die Historikerin sich strikt an Fakten hielten und dabei auch zufällige und bedeutungslose Ereignisse berücksichtigen müssten, dürften die Dichter ihrer Phantasie freien Lauf lassen, um das Symbolische und Allgemeine einer Geschichte herauszustellen. Ganz so frei ist die dichterische Freiheit bei Aristoteles allerdings nicht. Denn der Dichter hat zwar einen grösseren Gestaltungsraum als die Historikerin, er muss sich dabei aber an das halten, was möglich und wahrscheinlich ist. Die Gesetze der empirischen Wirklichkeit, die natürliche und soziale Ordnung gelten auch für die Dichtung. Für Ammenmärchen und phantastischen Wunderkram hat seriöse Dichtung keinen Platz. Heute würde man eine solche Einstellung vermutlich als naiven Realismus bezeichnen.
Denn moderne Leserinnen und Leser wissen, dass das, wovon Literatur erzählt, nicht in allen Punkten exakt der Wirklichkeit entspricht. Zwischen Autor und Leser besteht diesbezüglich eine Art unausgesprochener «Vertrag». Damit wird es möglich, Literatur auch als Darstellung von etwas zu verstehen, das bisher noch nie erfahren wurde, vielleicht sogar jenseits des sinnlich Erfahrbaren liegt, also im Bereich des Wunderbaren, Utopischen oder Futuristischen. Eine Schlussfolgerung, die in dieser Radikalität dann aber erst in der Romantik gezogen wurde.
Wie wichtig dieser implizite Vertrag zwischen Autor und Leser ist, aber auch wie empfindlich die Literaturszene auf Regelverstösse gegen diese Übereinkunft reagiert, zeigte vor zwanzig Jahren der Fall des Schweizer Schriftstellers Binjamin Wilkomirski, der 1995 seine Autobiographie unter dem Titel «Bruchstücke. Aus einer Kindheit 1939–1948» publizierte. Er schildert dort seine Kindheit in verschiedenen deutschen Konzentrationslagern. Das Buch war zunächst sehr erfolgreich und wurde in neun Sprachen übersetzt. Bis sich herausstellte, dass die von Wilkomirski behaupteten Fakten in Wirklichkeit reine Fiktion waren. Vor der Enthüllung war Wilkomirskis Text von der Literaturkritik ein besonders hohes Mass an Authentizität zugesprochen worden. Davon konnte nun keine Rede mehr sein: Der Text erwies sich als reiner Pastiche, als aus anderen, im dokumentarischen Sinne authentischen Zeugnissen zusammengestelltes Machwerk, das gängige Motive und Erzählweisen von Erinnerungsliteratur geschickt nachahmt. Solange es für authentisch gehalten wurde, feierte man «Bruchstücke» als besonders eindrückliches Beispiel für Holocaust-Literatur. Nach der Enthüllung war eine solche Lektüre nicht mehr möglich. Rückblickend könnte man sich fragen: Hätte das Buch als fiktionaler Roman eine Chance auf dem Buchmarkt gehabt, oder wäre es als zu klischeehaft und, gemessen an den grauenhaften Ereignissen, die es erzählt, geschmacklos abgelehnt worden?
Manchmal entscheiden die Gerichte, ob ein Text fiktional ist oder nicht. Problematisch wird es, wie der Fall Wilkomirski zeigt, immer dann, wenn jemand einen Text, etwa eine Autobiographie oder eine Reportage, als authentisch und wahr ausgibt, dessen Inhalte sich als fingiert erweisen. Doch auch der umgekehrte Fall ist juristisch von Belang: Wenn Autoren darauf beharren, ein Text sei fiktional, obwohl darin mehr oder weniger eindeutig reale Personen dargestellt sind. Ein frappierendes Beispiel bietet hier der Fall der Basler Autorin Birgit Kempker und ihres wunderbaren, 1998 erschienenen, inzwischen aber verbotenen Buches «Als ich das erste Mal mit einem Jungen im Bett lag». In Kempkers Text fällt circa 300mal der einleitende Satz: «Als ich das erste Mal mit einem Jungen im Bett lag, war es mit C.B.» – den vollständigen Namen sparen wir aus gebotenen Gründen aus. Der reale C.B. fühlte sich in dem kunstvoll wortspielerischen Prosagedicht identifizierbar dargestellt und somit in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt. Es folgte eine Klage, das Gericht gab ihm recht, Kempker und ihr Verlag wurden auf 5000 DM Schadenersatz und zur «Vernichtung» der noch vorhandenen Exemplare verurteilt. Für die Richter entscheidend waren nicht die lyrisch surrealen Beschreibungen von C.B., die den Grossteil des Textes ausmachen, sondern wenige Einzelaussagen, die auf C.B. als reale Person zutrafen.
Man könnte das Urteil durchaus als einen Angriff auf die Kunstfreiheit werten, ein Grundrecht, das aber mit anderen Grundrechten, zum Beispiel dem Persönlichkeitsrecht, in Konflikt geraten kann. Um dieser Grundsatzdebatte zu entgehen, einigt sich das Feuilleton in ähnlichen Fällen meist darauf, es handle sich bei der betreffenden Publikation nun mal um Fiktion, die per se nichts Faktisches behaupte. Im vorliegenden Fall hiesse das: der echte C.B. könne sich gar nicht beleidigt fühlen, schliesslich sei der «C.B.» des Buches eine nur aus Sprache bestehende Kunstfigur. Hier könnte man nun aber die Gegenfrage stellen: Woher wissen wir eigentlich, dass es sich um einen fiktionalen Text handelt – nur, weil er poetisch formuliert ist? Und: wieso sollte sich Kunstprosa nicht auf die Wirklichkeit beziehen können? Ist Fiktionales etwa prinzipiell so beschaffen, dass davon niemand belästigt werden kann? Fiktionale Texte können sehr reale Wirkungen (und sehr reale Beleidigungen!) verursachen. Mit der reflexhaften Verteidigung von kontroversen Texten als «bloss fiktional» ist strategisch also nicht viel gewonnen, was allerdings nicht bedeutet, dass das Urteil in diesem Einzelfall wirklich sinnvoll war. Denn könnte Fiktion sich auf unsere Welt nicht in irgendeiner folgenschweren Form beziehen – sie wäre belanglos und letztlich nicht der Rede wert.Bei der Rede von «fiktionaler Literatur» gilt es zunächst, einigen alltäglichen Missverständnissen zu begegnen. Eine gängige Vorstellung ist etwa, Fiktionalität wäre an bestimmten stilistischen Merkmalen eines Textes erkennbar. Typischerweise ist das auch so: ein Zeitungsartikel liest sich anders als eine Novelle. Es ist aber problemlos möglich, einen Roman über einen erfundenen Menschen im Stile einer Fachbiographie zu schreiben, wie dies etwa Wolfgang Hildesheimer mit «Marbot. Eine Biographie» (1981) getan hat und worauf einige der ersten Leserinnen und Leser prompt hereingefallen sind. Fiktionale Texte können also wie Sachtexte aussehen. Umgekehrt gilt: betont «literarische» Texte, etwa lyrische Prosa oder Lyrik, müssen nicht fiktional sein. So kann man zum Beispiel – sofern man das Talent dazu hat – seiner Familie auf einer Postkarte einen faktisch korrekten Ferienbericht in Gedichtform zukommen lassen oder bei einer Jubiläumsfeier einen Lebenslauf in Versen darbieten.
Dichtende und Denkende haben sich Jahrhunderte lang die klugen Köpfe zerbrochen, in Momenten höchster theoretischer Not bisweilen gar gegenseitig eingeschlagen, um zu klären, wie viel Wirklichkeit in einen Text gehört, wie viel reales Engagement nötig beziehungsweise legitim sei. Um diese grundsätzliche Frage nach dem Verhältnis von Phantasie und Wirklichkeit, Fakten und Fiktion ging es im späten 19. Jahrhundert auch im Streit zwischen französischen Naturalisten und Symbolisten. Soll die Literatur die Wirklichkeit möglichst naturgetreu, also mimetisch exakt, abbilden, wie die «Realisten» und «Naturalisten» behaupteten? Oder hat die Literatur im Gegenteil die Aufgabe, die Wirklichkeit zu transzendieren, auf quasi sakrale Höhen zu transportieren, wie die Symbolisten meinten? Literaturgeschichtlich ist um 1890 hier wohl kein grösserer Gegensatz denkbar als der zwischen dem naturalistischen Romancier Émile Zola und dem symbolistischen Lyriker Stéphane Mallarmé. Während Zola versuchte, die Prinzipien des wissenschaftlichen Positivismus in die Literatur einzuführen, um diese möglichst dicht an die empirische Wirklichkeit zu rücken, bemühte Mallarmé sich um die «höheren» Wahrheiten einer poetisch verrätselten Welt. Zola habe ästhetische «Prinzipien, die ihm das Gehirn schrumpfen lassen», urteilte Gustave Flaubert über seinen Zeitgenossen, während Bert Brecht, als typischer Vertreter einer politisch engagierten Moderne, die Symbolisten als «Dichter des französischen Kleinbürgertums» beschimpfte.
Die Gemüter haben sich seitdem leicht beruhigt. Heute weiss man, dass Literatur vieles kann und fast alles darf. Fakten und Fiktion gehen dabei die verschiedensten Allianzen ein. Selbst ein kontrafaktischer Roman wie Christian Krachts «Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten» (2008), in dem erzählt wird, wie Lenin seine kommunistische Revolution 1917 nicht in Russland, sondern in der Schweiz durchführt, enthält gewisse historische – allerdings ironisch verfremdete – Wahrheiten. Unzählige Beispiele historischen Erzählens zeigen, wie gross die Palette insgesamt ist. Sie reicht von einem dokumentarischen Verfahren, wie etwa in Peter Weiss’ Dramatisierung der Auschwitzprozesse in «Die Ermittlung» (1965), über literarische Reportagen, wie wir sie von Heinrich Heine und Joseph Roth, in der Schweiz von Blaise Cendrars, Annemarie Schwarzenbach, Niklaus Meienberg oder Anne Cuneo kennen, bis hin zur Spiegelung sehr privater Erlebnisse in Ereignissen der Literatur- und Kulturgeschichte in Adolf Muschgs neuem Roman «Der weisse Freitag». In seiner grundlegenden Studie «Wahrheit und Erfindung» (2012) vergleicht der Konstanzer Literaturwissenschafter Albrecht Koschorke diese Pendelbewegung zwischen Fakten und Fiktion mit einem narrativen «Wirbel», in dem «Elemente von Wahrheit, Anschein, Hörensagen, Unwissenheit, Irrtum und Lüge» sich ständig aufs neue vermischen.
Seit der Abwendung von einer konventionellen Ereignisgeschichte im Kontext der legendären «École des Annales» in den 1930er Jahren und der Herausbildung einer narrativen Mentalitäts- und Sozialgeschichte gewinnt das Erzählen als wissensbildendes Medium auch in den Geschichtswissenschaften an wissenschaftlicher Plausibilität. Mit dem «New Historicism» der 1980er Jahre konnte sich die Erzählung dann endgültig als wissenschaftliche Methode etablieren. Kulturwissenschafter sprechen in diesem Zusammenhang vom «narrative turn». Darunter verstehen sie sowohl die erzählerische Darstellung historischer Entwicklungen wie auch die Analyse narrativer Strukturen in historischen und politischen Zusammenhängen, beispielsweise die diskursanalytische Interpretation nationaler Gründungsmythen oder geschichtsphilosophischer Narrative wie der «Aufklärung» oder des Untergangs des Römischen Reichs. Um erzählte Geschichte handelt es sich auch, wenn sich der deutsche Osteuropaexperte Karl Schlögl in seinem neuen Buch «Das sowjetische Jahrhundert» auf fast tausend Seiten mit den vermeintlichen Nebensächlichkeiten des sowjetischen Alltags befasst, mit Etagentoiletten, Stalins Kochbuch, verseuchter Luft und Urlaub am Schwarzen Meer. Oder wenn sein Wiener Kollege Philipp Ther, um ein zweites aktuelles Beispiel zu nennen, in «Die Aussenseiter» (Berlin, 2017) die Geschichte der Migrationen in Europa erzählt und dabei ausführlich auf Details eingeht, etwa auf die Aufnahme von 100 000 hugenottischen Flüchtlingen durch die – kleine – Stadt Frankfurt im Jahr 1685.
Historische Darstellungen oder Biographien werden üblicherweise als Sachtexte verstanden, das heisst, der Autor oder die Autorin haftet für darin enthaltene Behauptungen. Ein Roman dagegen darf sich Erfindungen und Ausschmückungen erlauben, ohne Sanktionen befürchten zu müssen. Ein historischer Roman muss sich nicht für Abweichungen von der Realgeschichte rechtfertigen – niemand würde C.F. Meyers Novelle «Das Amulett» vorwerfen, historische Unwahrheiten zu verbreiten. Trotzdem freut man sich bei Meyers literarischer Darstellung der Bartholomäusnacht darüber, einiges über die Hugenottenkriege zu erfahren. Neuere Fiktionstheorien suchen deshalb nach Erklärungsansätzen für das Verhältnis von «Wahrheit und Dichtung», die nicht mit Form, Stil und Inhalt argumentieren, sondern den jeweiligen Kontext in den Blick nehmen. Manche suchen den Ausgangspunkt fiktionalen Sprechens beim Autor: Als fiktional gilt hier, was er als Fiktion verstanden haben möchte. Andere wiederum schieben die Verantwortung dem Rezipienten zu: Fiktional ist, was die Leser als fiktional verstehen. Die literaturwissenschaftliche Fachdiskussion spielt sich weitgehend zwischen diesen Extrempolen ab, doch benötigen beide Positionen Zusatzkriterien, da weder ein einzelner Leser noch die jeweilige Autor willkürlich entscheiden können, was für sie Fiktion ist oder nicht. Viele Theorien beschreiben Fiktionalität daher als soziale «Institution», als eine Art gesellschaftliche Konvention, die sich an mehr oder weniger transparenten Regeln orientiert. Schwierigkeiten bereitet jedoch nach wie vor die Frage, wann, wie und unter welchen Umständen diese soziale Praxis greift: Spielt die Autorintention überhaupt eine zentrale Rolle? Und: inwiefern sind solche Zuweisungen kulturell und historisch geprägt, wie der französische Historiker Paul Veyne 1987 in seinem berühmten, altertumswissenschaftlichen Buch «Glaubten die Griechen an ihre Mythen?» gefragt hat.
Freilich wird die Unterscheidung von Fakten und Fiktion in einer Zeit, in der sich die Realität zunehmend in mediale Simulationsräume verlagert, immer schwieriger. Hatte es sich die Moderne zum Ziel gesetzt, das naiv realistische Verständnis von Kunst und Literatur auszuhebeln, indem ganz gezielt fiktive und phantastische Gegenwelten oder neue poetische Sprachsysteme entworfen wurden, so geht die Postmoderne heute einen Schritt weiter, wenn sie die Wirklichkeit an sich als sprachliches und mediales Konstrukt, als Simulation und damit letztlich als Fiktion begreift. Die Gefahren eines solchen Wahrheits- und Wirklichkeitsrelativismus liegen auf der Hand. Denn öffentlich gelogen wird nach wie vor. Nur scheint man sich kaum noch darüber zu wundern. Doch ob man deswegen – gewissermassen als ironische Pointe der Postmoderne – Fake-News und «alternative Fakten» nun einfach als neue Variante eines grossen literarischen «Erzählspiels» (nach Koschorke) betrachten soll, darf bezweifelt werden.
Sabine Haupt
ist Schriftstellerin, Publizistin und Literaturkritikerin. Sie lehrt an der Universität Fribourg. 2018 erscheint ihr Roman «Der blaue Faden» bei die brotsuppe
Tobias Lambrecht
ist Literaturwissenschafter, Hörspielautor, Dramaturg und Lektor sowie Senior Research Fellow an der Universität Wien.