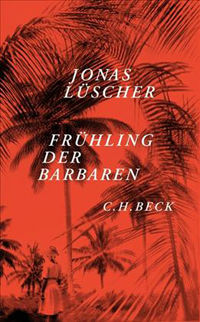Urban Games
«Wenn ich eine Geschichte erzählen müsste über diesen Ort, würde ich sie so erzählen», sagte er, «man findet sich schneller mit ihm ab als erwartet, man geniesst es sogar ein wenig, die Ruhe, die Natur, das Unfertige, die kaputten Fenster, die Viecher – und dass man im Geheimen Sex haben muss. Baby, das macht mich gerade scharf.» Er fuhr mir mit der Hand unter mein schwarzes, kurzes Kleid, unter dem ich nichts trug, der Hitze wegen. Und weil es praktisch war, da es keine Toilette gab, und für die Spontanpenetration.
«Die Geschichte», drängte ich und schob seine Hand weg. Er fuhr fort: «Selbst mit der nicht vorhandenen Dusche und der nicht vorhandenen Toilette findet man sich ab – für ein paar Tage. Und dann besucht man am dritten Abend das Nachbar-Architektenpärchen mit ihrem sanft und nachhaltig renovierten Hipsterhaus mit drei Badezimmern, schliessbaren Fenstern und Türen, einer Küche wie in einem Grandhotel, Wasch-, Abwaschmaschine, Tumbler und WLAN und muss auf einmal sofort weg von hier, zurück ins Tal.»
«Nicht schlecht», sagte ich.
«Ich weiss», sagt er, «du würdest ein Drama erzählen, vor der Kulisse des Steinbruchs vielleicht, nicht wie ich äussere Banalitäten.»
«Genau, und eine Beziehungskrise natürlich», sagte ich. Er lachte und griff nach einer Weile zu seinem Smartphone, vermutlich um zu überprüfen, wer seine neuste Instagram-Story gerade gelikt oder mit Herzen überschüttet hatte. «Wir haben aber keine Beziehungskrise», sagte ich, mehr um mich selbst davon zu überzeugen. Er verdrehte übertrieben die Augen, legte das Telefon mit dem Bildschirm nach unten neben sich zur Seite, küsste mich auf die Stirn, fuhr dann mit der Hand unter mein Kleid, zwischen meine Beine, und ich liess ihn gewähren.
Es war der dritte Abend, den wir bei K.s Aussteigerfreunden in diesem Ruinennest in den Bergen kurz hinter der Schweizer Grenze verbrachten. Und der Abend versprach nichts Gutes. Wir hatten zum ersten Mal seit unserer Ankunft zwei Stunden Ruhe vor Barbara, der Gastgeberin, lagen in den beiden Liegestühlen unter dem Feigenbaum, rauchten und tranken Cynar mit Eis. K. hatte mir gerade gesagt, dass er zuvor beim Sex den Gedanken gefasst hatte, dass er mir nun eigentlich ein Kind machen könnte, als Barbara kam und uns ungefragt mit ihrem Gerede über Ziegen, Zwiebeln und Pflanzensetzlinge in Beschlag nahm. Nicht zum ersten Mal. Es sei ganz grauenhaft, meinte Barbara, die ich seit meiner Ankunft nur die Pack-an-Frau nannte, und machte ein betroffenes Gesicht. Sie meinte die beiden Ziegen, die sie von einem Bergbauern gerade übernommen hatten – aus reinem Altruismus, selbstredend (und gegen zwei Dutzend Kilo Ziegenfleisch). Die Tiere seien wohl seit längerem völlig vernachlässigt worden. Das Muttertier habe ihr Junges verstossen und gebe keine Milch ab. Die beiden Ziegen seien «völlig verstört». «Das Schlimmste ist», sagte die Pack-an-Frau, «die Mutter riecht nach Leiche, der ganze Stall riecht nach verdorbenem Menschenfleisch und nun muss ich das arme Jungtier alle zwei Stunden mit einer Milchflasche füttern wie ein kleines Baby.» Und das alles jetzt, wo ihr Freund Pan ein paar Tage in Bern war, um als Tontechniker an einem World-Music-Festival zu arbeiten. K. machte ebenfalls ein betroffenes Gesicht. Ich trank meinen Cynar aus, um mir den nächsten einzuschenken. Ich konnte das Gerede über Ziegen, ihre syphilisähnlichen Krankheiten, ProSpecieRara, den ökologischen Klärabwassertank und das Haus, das sie und Peter Pan für 50 000 Euro gekauft hatten, nicht mehr hören. Mein Aggressionspotenzial war innerhalb dieser drei Tage beachtlich gestiegen und bezog sich mittlerweile nicht nur auf die Pack-an-Frau, sondern auch auf meinen Freund, der ihr und ihrem Gerede stets freundlich Aufmerksamkeit schenkte, nett lächelte und immer wieder interessierte Fragen einwarf, als wäre er bei einem Vorstellungsgespräch.
Statt dass K. und ich nun ein Gespräch über Verhütung, die Bedeutung des Wortes «eigentlich» in seinem Ein-Kind-machen-Satz und mögliche Namen für unsere möglichen Kinder führten oder einfach hemmungslosen Sex im Garten hatten, sprach K. mit Barbara über die Mutterkuh, das erbarmungswürdige Jungtier, Muttermilch und den Bergbauern, der Barbara und Pan über den Tisch gezogen hatte. Ich dachte an die in der Küche über dem Schüttstein nach ihrer Grösse geordneten, aufgereihten Messer und flüchtete mich in Gewaltfantasien. K. legte seine Hand auf mein Knie und suchte Augenkontakt, vermutlich um sich zu versichern, dass alles «easy» war. Ich verweigerte es ihm trotzig, seinen Blick zu erwidern.
Dann krachte es, als ginge aus heiterem Himmel das brachialste Sommergewitter der Menschheitsgeschichte über uns nieder. Mir war, als würde die Welt untergehen, und mein Unterleib schmerzte, als gebäre ich ein zu gross geratenes Kind. Aber es war nur der lächerliche Eisprung, der mir alle vier Wochen in Erinnerung rief, dass von anfänglichen dreihunderttausend Eifollikeln inzwischen noch etwa die Hälfte übrig war und dass die Abnahme ihrer Quantität auch mit der Abnahme ihrer Qualität einherging, bis die verbliebene ovarielle Reserve irgendwann zu nichts mehr von Nutzen war.
Das Krachen kam vom Steinbruch, wenige Kilometer vom Haus entfernt. Die Pack-an-Frau hatte uns bereits belehrt: über den Gesteinsabbau, die Arbeiter, die Abwanderung der Bergbewohner vor fünfzig Jahren, weil ihnen durch die Gemeinde Angst eingejagt worden war. Der Weiler sei von Murgängen und Steinschlägen bedroht, sei behauptet worden, und jedem männlichen Bewohner sei eine Abfindung bezahlt worden, wenn er sein Hab und Gut hinter sich liess und ins Tal zog. Die Gefährdung sei natürlich nur behauptet worden, um die Bewohner dazu zu bewegen, unten im Tal in der Fabrik zu arbeiten und die Kaufkraft zu steigern; die Gefahr durch Murgänge und Steinschläge sei absolut vernachlässigbar.
Von weitem sah ich Marc-Andrea auf uns zukommen. Der tüchtige, talentierte Marc-Andrea, der Nachbarsarchitekt, von dem Barbara schwärmte und dem sie gerne wortgetreu nachplapperte (zum Beispiel die Steinbruch- samt Abwanderungsgeschichte). Ich dachte daran, wie Marc-Andrea mir am vorigen Tag vom benachbarten Dach des Hühnerstalls zugewunken hatte, als ich gerade nackt mit der Gartenschlauchdusche zugange gewesen war, und legte meine Hand auf K.s Knie. Ob wir alle zum Essen kommen wollten, fragte Marc-Andrea. Ein befreundetes Paar sei auch zu Besuch. Tizia mache frittierte Salbeiblätter aus dem Garten. Wein gebe es natürlich auch, und danach könnten wir alle zusammen ins benachbarte Dorf fahren zu einem kleinen Openairfestival. Da gebe es heute eine «Vertical-Dance-Performance» am Fels von einem Tanzkollektiv aus den Abruzzen. Barbara nickte begeistert und warf K. und mir einen aufmunternden Blick zu. «Ihr müsst das Haus sehen, es ist wunderbar.» K. sah mich fragend an, ich zuckte mit den Schultern, schwieg und dachte an den Wein und die frittierten Salbeiblätter, die ich seit dem Tod meiner Grossmutter nicht mehr gegessen hatte. «Wir kommen!», sagte die Pack-an-Frau nachdrücklich und zog sich eifrig in die Küche zurück, um irgendetwas zum Mitbringen vorzubereiten.
«Ist alles in Ordnung, Hedda?», fragte K.
«Ja.»
«Wirkt nicht gerade überzeugend.»
«Zu diesem Vertical-Dance-Dings geh ich nicht. Ich hasse Openairs. Ich hasse Tanz-Performances. Und Vertical-Dance am Fels klingt nach einer Potenzierung von alledem.»
K. lachte und küsste mich auf die Stirn.
«Da müssen wir ja nicht hin. Aber ist doch nett, dass sie uns einladen, und das Haus möchte ich auch gern sehen.»
«Ich möchte nur die Salbeiblätter.»
K. lachte und biss mich sanft in die Nase.
«Eben, siehst du.»
Das Haus von Marc-Andrea und Tizia hatte etwa zehn Zimmer, drei Badezimmer, zwei grosse Küchen, einen Garten und eine Terrasse und war mit allen erdenklichen Schikanen ausgestattet. Das Haus war schön. Ob «Schöner wohnen» schon vorbeigekommen sei, fragte ich bei der Führung durch die Räume. «Nein», sagte Tizia (sie hatte es offenbar nicht so sehr mit der Ironie). K. kniff mich in die Taille, ich stöhnte leise auf. Wir setzten uns draussen auf die Terrasse unter die Pergola und rauchten, während Tizia, Barbara und Marc-Andrea in der Küche fuhrwerkten.
«Ah», seufzte K., «so müsste man wohnen.»
«Ja», sagte ich, «aber nicht in diesem Ruinennest und mit diesen Nachbarn.»
«Sei doch nicht immer so böse, Hedda, wir kennen sie ja noch gar nicht.»
Ich legte meine Stirn in Falten und schaute so böse, wie ich konnte.
K. lachte und biss mich in den Nacken.
Dann kamen die Gäste des Architektenpärchens auf die Terrasse heraus. Die beiden waren vermutlich knapp dreissig. Sie stark gebräunt, schwarzhaarig, vollbusig, von allem etwas zu viel. Er sehr schmal, blond, bleich, blauäugig und jungenhaft. Antonella war aus Apulien, Hendrik aus Rotterdam, die beiden führten seit zwei Jahren eine Fernbeziehung und seien gerade frisch verlobt, erfuhren wir. «Gratuliere», sagte K. höflich. Ich konzentrierte mich darauf, keine weiteren ironischen Bemerkungen fallenzulassen. Marc-Andrea kam mit dem Wein heraus, die beiden Frauen mit den Tellern und Schüsseln. Das Essen war gut, der Wein in Ordnung – ausser dass wir ihn aus kleinen Gläschen, die mich an die Becherchen aus der Krippe meiner Tochter erinnerten, trinken mussten. Die Gespräche waren förmlich und langweilig, drehten sich um das Essen, das Geschirr, das Haus, den nachhaltigen Sanierungsbedarf und die Renovationsarbeiten. Ich schwieg und beobachtete Antonella. Sie umfasste ihr Weingläschen mit beiden Händen, trank in winzigen Schlucken, lächelte und gab ab und zu ein entzücktes «Ah» von sich, wie es kleine Kinder aus reiner Gefallsucht tun.
Dann wurde das Gespräch maximal persönlich: «Und was macht ihr so?» Ich schenkte mir zum vierten Mal Wein nach (der Nachteil kleiner Gläschen war auch, dass man sich als solide Trinkerin zwangsläufig zu erkennen geben musste) und hörte K. zum x-ten Mal dabei zu, wie er von seinen Bands und seiner anstehenden Tour erzählte. «Nice», sagten Antonella und Prinz Rotterdam, und Marc-Andrea und Tizia nickten anerkennend. Was ich denn so täte? «Ich schreibe», sagte ich. «Great», sagte Antonella. Und so ging es weiter: K. fragte die beiden Verlobten, was sie denn so täten und wo sie sich eigentlich kennengelernt hätten. Sie hätten beide «Nachhaltigkeit» studiert, erfuhren wir. Ich liess es bleiben zu fragen, wie nachhaltig denn ihre Fernbeziehung Rotterdam-Apulien sei. Kennengelernt hätten sie sich bei «Urban Games» in Süditalien. Was denn «Urban Games» seien, fragte K. Ich biss nervös auf meiner Unterlippe herum, im Wissen darum, dass K.s freundlich gemeinte Rückfrage mir nun einige Minuten Fremdschämen mit damit einhergehenden Symptomen wie Augenzucken, Herzflattern und Wadenkrämpfen bescheren würde. Ich setzte mich etwas abseits auf die Steinmauer, rauchte und hörte Prinz Rotterdams Ausführungen über Urban Games zu, die (welche Überraschung!) letztlich zum Zweck hatten, den Tourismus zu fördern. Ein Home-Team und auswärtige Teams, zusammengesetzt aus Studierenden, müssen in einem Provinzdorf verschiedene Aufgaben lösen, etwas bauen, renovieren oder Essen zubereiten zum Beispiel, werden bei jedem Schritt geratet, und am Ende gebe es zwar ein Gewinnerteam, aber keine wirklichen Verlierer, weil der Hauptgewinn sei für das Dorf und nenne sich Aufwertung (auch Prinz Rotterdam hatte es nicht mit der Ironie).
Immerhin, dachte ich, waren Antonella und Prinz Rotterdam gleichermassen bieder. Die beiden hatten sich verdient. Mein Wohlwollen für diese Verbindung war aufrichtig. Ich fragte mich nur, woher K. Geduld und Nerven aufbrachte, sich in solche Gespräche verwickeln zu lassen, und wusste nicht, ob ich ihn für seine Social-Small-Talk-Skills bewundern oder verachten sollte, befand aber, dass es ihm – so oder so – an Haltung fehlte.
Von den Urban Games führte der Weg zu Gesprächen über Airbnb, Super Hosts und Top-Ratings, und Prinz Rotterdam gab seine Tips zum besten, wie man es zu einem hohen Rating brachte. Tizia und Marc-Andrea überlegten nämlich, gemeinsam mit Barbara und Pan Airbnb anzubieten, mit Frühstück aus lokalen Produkten natürlich und flexiblen Möglichkeiten für Residencies, Workshops und Retreats. K. könne ja einmal einen Impro-Workshop im Steinbruch anbieten und an einer Gartenparty mit seiner Band spielen, meinte Barbara begeistert.
Ich blieb auf der Steinmauer sitzen, trank und rauchte. Barbara warf mir ab und zu Blicke zu, von denen ich nicht sagen konnte, ob sie Überheblichkeit, Abfälligkeit oder auf eine übergriffige Art und Weise Besorgtheit ausdrückten. K. setzte sich kurz zu mir, rauchte eine mit, versuchte, Kontakt zu mir herzustellen, scheiterte, gab auf, setzte sich zurück an den Tisch und unterhielt sich mit Marc-Andrea und den anderen beiden Nachhaltigen. Ich hörte derweil Barbara und Tizia zu, die sich über anstehende Vorbereitungen unterhielten. Wer bringt Bier und Wein, wer backt Zopf und Kuchen, wer fährt mit dem Auto ins Tal einkaufen, wer transportiert was wohin. Es ging um die bevorstehende Gartenparty. Wenige Minuten später unterhielten sie sich über weitere anstehende Vorbereitungen. Wer bringt die Blumen, wer backt Zopf und Kuchen, wer fährt mit dem Auto ins Tal einkaufen, wer transportiert was wohin. Es ging um die bevorstehende Abdankungsfeier einer gemeinsamen kürzlich jung verstorbenen Freundin.
Ich stand auf, allmählich leicht betrunken, sagte irgendetwas von Übelkeit, ging hastig die Steintreppen hinunter, an den eingestürzten Steinhäusern vorbei zum Haus, in dem wir untergebracht waren. Ich wusste, K. würde mir folgen. Ich wusste, er würde mich fragen, ob alles in Ordnung sei. Und dann würde ich laut schreien, wir würden tags darauf abreisen und nichts würde mehr sein wie vorher.