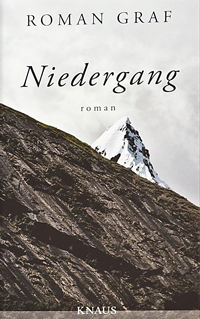Vom Holzen und Stocken
Alles hat gut angefangen, das Sprachgarn aufgespannt in Reih und Glied. Dann ein gut gewobener erster Satz. Einer, der sitzt, ein Beau in messerscharfen Bügelfalten. Alle, die ihm folgen sollen, stechen gemeinsam in See: Sie wollen vom grossen Ozean der Verzettelung erzählen. Der Beau strahlt. Der Grössenwahn hält alle Fäden in der Hand.
Kann ja nichts mehr schiefgehen. An diesem Punkt walzert in schwarzem Kleid der Stalker Zweifel übers Parkett. Mit starkem Schritt führt er die nackte Angst und ist bereit, was anzuzetteln. Der Zweifel fragt:
«Wer spricht überhaupt? Das lyrische Ich, die Domina mit Spazierstock und deutscher Dogge? Oder das therapeutische Wir an Krücken? Das Du vielleicht als primäres Ich im Selbstgespräch? Und was soll das werden, Gedicht oder Glosse?»
Hans was Heiri, Hauptsache, man fällt nicht unter das eigene theoretische Niveau. Nur so nebenbei, wer hat das janusköpfige «Man» in diesen Text gelassen? War es die Frist, die sich in diesem Augenblick die Henkerhaube aufsetzt? Hold your horses, deadline!
Erst muss einmal geklärt werden, zu welchem Soundtrack hier geschrieben wird und in welcher Sprache. Sogleich verliert sich das Ich als Du in den Tiefen von unendlichen SoundCloud-Scroll-Funktionen et dans les dictionnaires. Die Polyglossie als Fluchtauto, denkst du leicht panisch.
Cave singt: «There she goes my beautiful world», und du fährst unangeschnallt und mit 331⁄3 min−1 in den Good Old Surrealismus rein. Weil es keine eigene Sprache gibt, nur Klang und Rhythmus und diesen traurigen transitorischen Leib. Vielleicht wird das hier ja ein Nachruf. Aber bitte nicht in Kauderwelsch. Und ohne dadaistische Geste der Negation.
Dafür mit Reim und Restnarration. Du denkst an den Text als Ereignis, an den Auftritt und an Masturbation. Allen Blödsinn muss man selber machen. Jetzt klopft es an der Tür des Produktionscockpits. Du spürst die nahende Katastrophe im Anschlag, öffnest trotzdem.
Die Stimme tritt ein. Sie hat Serres an der einen und Barthes an der andern Hand, plappert Mundart und spricht von Fleisch und Anwesenheit in der Abwesenheit. Die deutsche Dogge beisst die Stimme in die Wade. Die Stimme schreit. Die Domina stöhnt: «Mundart und Franzosen haben in diesem Text nichts verloren, er wird gelesen, nicht gesprochen.» Sie schlägt das unter Schock stehende therapeutische Wir aus lauter Gewohnheit mit dem Spazierstock.
Du denkst: So kommt man vom Hölzchen aufs Stöckchen, und siehst, wie Barthes und Serres im Notausgang verschwinden, während die Mundart die deutsche Dogge international hinter den Pflug spannt. Oui, oui, le dialecte met la charrue avant le dogue allemand oder anders ausgedrückt: The dialect puts the cart before the Great Dane. Die Dogge ist jetzt Däne, proverbially, not metaphorically spoken.
Das therapeutische Wir schluchzt unter den Schlägen der Domina: «Wer holt die Leserschaft so spät noch ab?» Du fauchst: «Abholen? Womit denn bitte? Dem dramaturgischen Taxi?» Und da erinnerst du dich an ein theatertheoretisches Lehrbuch von Matzke und prokrastinierst einige Stunden erfolgreich, bis es dunkel ist.
Die Nacht liegt vor Anker. An Bord sind alle eingeschlafen. Du ersäufst den Zweifel und die Angst und denkst an all die Lieder übers Liederschreiben. Dann schüttest du Wein in die Maschine und beginnst mit einem Refrain.