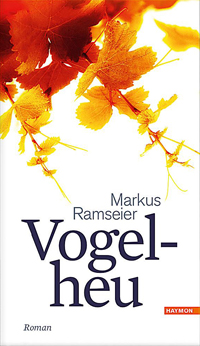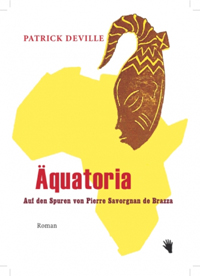Die Sprache des Zorns
Wer spricht sie? Und wie? Fest steht: um eine Landessprache handelt es sich nicht. Warum die Stimmen von Empörung, Wut und Protest der helvetischen Enge nicht entkommen können.
«Nun führ ich mich / hin zu den Stimmen / den im Zorn erwachten.»
Mariella Mehr
Zorn ist ein Gefühl, das den Körper in Unordnung bringt, noch bevor es irgendwo draussen Schaden anrichtet. Die Farbe der Haut, die Haltung des Körpers, der Fluss des Blutes, alles, was sich in ruhigen Zeiten dem langsam dahingleitenden Körperstrom unauffällig einfügt, wird vom Zorn verkratzt, verdreht, verwandelt. Der Körper sticht auf einmal aus der Masse heraus. Das Gesicht sieht aus, als fliege es mit dreifacher Überschallgeschwindigkeit, als reite man auf einem wild gewordenen Meteor über brüchige Welten. Zorn ist fleischgewordene Mach-3. Seine Farbe ist Rot-Bleich-Schwarz. Wer sich mit der Ikonographie des nichtgebändigten Körpers beschäftigt, kommt um den Zorn nicht herum.
Zorn stösst aus der epistemischen Dunkelheit hervor, durchbricht die Gehege der landesüblichen Sittlichkeit. Wer ihn moralisch bewertet, hat ihn nicht verstanden. Wer ihn therapieren will, wird von ihm vernichtet. Wer meint, ihn gebändigt zu haben, hält lediglich schlaffen Verstand in Händen. Manchmal kündigt er sich an, brummt und stottert wie ein Motor, der nicht in die Gänge kommen will, bis er jäh hervorbricht und ringsum nichts anderes zu hören ist als sein Schrei. Zuweilen wird Zorn ankündigungslos Zorn. Kein Warnsystem vermag den Zorn vorherzusehen, der, hat er die inneren Gemächer verlassen, Herr ist über das ganze Haus.

Nach dem Tod Gottes, der Verwurzelung der Psyche in der dunklen Welt der Triebe, der Agonie der reinen Erkenntnis und dem Auseinanderfallen des Subjekts ist es der Zorn, dem man die Repräsentation von Wahrheit irgendwie zutraut. Gerade weil er aus dem unzugänglichen, labyrinthischen, vordiskursiven Höhlensystem der Affekte emporsteigt, scheint er Echtes und Wahres an die von Kontingenz und Ironie verseuchte Oberfläche zu schleudern. Dabei übersteigt er nicht nur das, was Körper und Psyche genannt wird, sondern vereinigt beides zu einer ebenso neuen wie rätselhaften Form. Und diese Form kann aufbrausen, kann toben, kann Reste von Stolz und Scham enthalten, kann gewalttätig sein, kann töten, kann heilig sein. Gäbe es Feiertage des Zorns, locker übers Jahr verstreut, wäre der heilige Zorn der höchste davon. Mit ihm hat der Zorn die Klimax erreicht. Danach zerbröselt er, stirbt ab. Oder fällt zurück ins Grab der Traurigkeit.
«Wer Zorn moralisch bewertet, hat ihn nicht verstanden.»
So sehr Zorn ein Gefühl ist, das den Körper unmittelbar bestimmt, überrumpelt und nicht selten gefangennimmt, so sehr kann Zorn zur Sprache finden. Es ist hier nicht vom Zorn die Rede, der behauptet oder beschrieben wird, sondern vom Zorn, der selber spricht. Doch was ist das überhaupt, die Sprache des Zorns? Wer spricht sie? Und wie? Ich richte meinen Blick auf das, was unscharf als Schweizer Literatur bezeichnet wird, weil der Begriff nicht mehr zu bieten hat als eine geographische Einordnung. Die Suche gestaltet sich schwierig, denn so viel steht fest: Die Sprache des Zorns ist keine Landessprache.
Burger: Feuerzeichen aus Schilten
Tief im Aargauischen lebt ein Mann, der den Beruf des Dorfschullehrers ausübt und in einem zornigen Monolog der Inspektorenkonferenz die Schiltener Lehr- und Lernverhältnisse entgegenschleudert. Der Schildknecht’sche Monolog, bei dem es sich um Feuerzeichen eines auf einer einsamen Insel ausgesetzten Menschen handelt, ist in einer ausschweifenden, bizarren Einzelheiten entlangwandernden, neubarocken Sprache verfasst, die da und dort an Thomas Bernhard erinnert, den österreichischen Altmeister des Zorns. Im Unterschied zu Bernhard, der den Zorn des Autors (der zuweilen ins Sauertöpfische, Misanthropische kippt) mehr oder weniger ungebremst und ungebrochen seinem Personal in den Mund legt, ist die Differenz zwischen Hermann Burger und seinem Protagonisten grösser. Schildknecht ist zornig, sein Schöpfer nicht. Armin Schildknecht ist einer der wenigen aus (traurigem) Zorn gebauten Figuren der Schweizer Literatur.
Angst: ein Loch im Totenreich
Fritz Zorn ist keine Figur, kein Held, auch kein tragischer, sondern das Pseudonym von Fritz Angst und «Mars» der Titel seines Buchs, mit dem er Ende der 70er Jahre die bürgerliche Schweiz aufschreckte und der antibürgerlichen einen unverstellten Blick in das Interieur einer Villa an der Zürcher Goldküste offerierte. Mit dem kalten Atem des Kriegsgottes bläst Zorn der satten und selbstzufriedenen Bourgeoisie die Kleider vom Leib. «Ich bin jung und reich und gebildet; und ich bin unglücklich, neurotisch und allein», lautet der Eingangssatz, dem eine schonungslose Entblätterung seiner selbst und seiner Familie folgt, bis sich am Schluss die gediegene «Ruhe ihres Hauses» in die Ruhe der Toten verwandelt hat. Der Krebs ist das Instrument, mit dem Fritz Zorn die bürgerliche Welt seziert, ihre Schädel-, Brust- und Bauchhöhle öffnet, sämtliche Organe freilegt und am Schluss die Knochen auskocht. Und der Krebs ist die Krankheit, an der Fritz Angst stirbt, bevor das Buch publiziert wird. Zorn bezeichnet den Krebs als «verschluckte Tränen» und bringt so sein seelisches Leid in ursächlichen Zusammenhang mit dem Krebs, weil er die Tränen in seinem «Leben nicht geweint hatte und nicht hatte weinen wollen». Was damals nicht nur als symbolische Kausalität galt und widerständisches Potenzial hatte, ist heute fester Bestandteil im Katechismus der Selbstregulierungs-, Selbsterfahrungs- und Selbstheilungsgemeinschaft und bringt jeden Onkologiekongress in Rage. Man mag es als bittere Ironie oder als Internalisierung ökonomischer Prozesse betrachten, dass die von Fritz Zorn so sorgfältig rückgebauten Bürger und Bürgerinnen heute längst das Stadium der durchgefühlten, selbstoptimierten Lifestyle-Bourgeoisie erreicht haben und mit einem wohligen Schauder auf die Tee- und Zigarrensituation von damals zurückschauen. Schreiben als Selbsterfahrung war Zorns Sache nicht, vielmehr wollte er sich von den qualvollen Selbsterfahrungen, die er spät als Fremderfahrungen identifizierte, befreien, wenigstens im letzten Akt seines kurzen Lebens mit dem Hebel der Sprache ein Loch ins Totenreich reissen. «Denn das ist meine Aufgabe: mich von der erdrückenden Qual meiner Vergangenheit zu befreien.»
Fritz Zorn hat diese Aufgabe mit einer Sprache gelöst, die im Gegensatz zu seinem Namen nie zornig ist, nie aus der Haut fährt, nie die Grenzen des Anstands verletzt, sondern stets im Rahmen einer nüchternen Sektion bleibt. Zorn hat es nicht zum Zorn geschafft, sein «Mars» ist der traurige Protestsong eines tödlich verletzten Menschen.
Hohl: Spiessbürger unter Beschuss
Nicht tödlich, eher intellektuell verletzt ist Ludwig Hohl. Jahrzehnte vor Fritz Zorn leidet Hohl an der helvetischen Enge, einem Amalgam aus Selbstgerechtigkeit, Duckmäusertum, Ignoranz und Geldgier, die ihn ins Exil und schliesslich in die berühmte Genfer Kellerwohnung trieb. Hohl ist der Schweizer Meister in der Fabrikation von Aphorismen, mit denen er sein Denken in gebündelter Form zum Ausdruck bringt. Und weil sein Denken stets das Ganze sucht, ist es schwer zu verorten. Hohl ist ein Allesüberdenker.
Mit der Figur des Apothekers hat Hohl eine idealtypische Figur erschaffen, um an ihr seinen Zorn loszuwerden. Der Apotheker ist ein Spiessbürger in kristalliner Form: Hohls liebste Zielscheibe. Im Apotheker-Kapitel der Notizen schreibt er: «Die Schweizer haben ein Gehör von der Art eines Balkens. Lawinen, Bergstürze und ähnliche Naturerscheinungen müssen ihnen das angerichtet haben.»1 Was Hohl sagt, ist nicht Ausdruck von Empörung, Wut, Betroffenheit und schon gar kein Protest, sondern gebündelter Zorn. Und wenn Hohl, dessen «Bergfahrt» einer der grossen Bergbesteigungstexte der alpinen Zone ist, schreibt: «Die Schweizer sind stolz darauf, so schöne Berge geschaffen zu haben»2, dann ist unter der geglätteten Oberfläche des Satzes der Zorn zu spüren, der jederzeit hervorbrechen und alles mitreissen kann.
Hohls Tonlage reicht von munter bis manisch. Das Apotheker–Kapitel ist nur ein kleiner Ausschnitt seines literarisch-philosophischen Schaffens, zeigt aber exemplarisch, wie komplex und originell die Sprache des Zorns sein kann.
Koster: Wörter wie Steine
Der Zorn, der in Dora Kosters Texten aufblitzt, ist pure kinetische Energie, dem Asphalt des Zürcher Niederdorfs entsprungen. Koster sammelt Wörter auf wie Steine und schmeisst sie gegen die Fensterscheiben der Bürger, Freier, Politiker, Verleger und manchmal auch gegen Freunde. Ihr Debüt und einziger Verkaufserfolg «Nichts geht mehr» ist die Geschichte ihres Lebens vom Aufwachsen mit ihrem geliebten Stiefvater und
ihrer verhassten Mutter, ihren Aufenthalten in Heimen und Internaten, ihrem erster Freier, ihrem ersten Zuhälter. «Nichts geht mehr» ist ein Männerbuch. Koster zieht den Männern die Seele aus dem Leib und hängt sie vor uns an die Wand. Kein schönes Bild. Auch wenn sich die Sprache des Zorns aufdrängt, hält sich Koster zurück, sie bilanziert, beschreibt, kommentiert, bleibt nüchtern.3 Doch zwischen den Zeilen, oder vielmehr unter den Zeilen, ist das Pochen des Zorns zu vernehmen. Weniger nüchtern sind ihre Gedichte, Pamphlete, ihre kurzen Texte ausserhalb einer grossen Erzählung. Da blüht sie auf, die Sprache des Zorns, zuweilen mit Ironie oder Sarkasmus gepudert, aber doch unverkennbar zornig. «Der Dreck an mir / stammt von Euren Füssen.»4 Dora Koster hat zornige Samisdat-Literatur verfasst, wie sie in der Schweiz selten vorkommt. Keines ihrer Bücher ist lieferbar.
Mehr: auf dem Weg zur Poesie
Mariella Mehr wurde in den eidgenössischen Verliesen der barmherzigen Brüder und Schwestern von St. Anna bis St. Zacharias vergewaltigt und gefoltert. Das ist bekannt. Bekannt ist auch ihre Biographie. Im Gegensatz zu Tausenden anderer Opfer christlicher Nächstenliebe, die wegen Haltlosigkeit, Kriminalität, Pauperismus, Renitenz, Schwachsinn, Trunksucht, Unzucht, Vagantität, Verwahrlosung oder Minderwertigkeit ganz allgemein in einem weit verzweigten, amtlich zumindest geduldeten eugenischen Programm unterkamen (für das 1945 keine Zäsur bedeutete), entwickelte sich in ihren Händen ein Instrument, mit dem sie sich gegen das Verstummen zur Wehr setzen konnte: die Sprache. Aus ihren belächelten ersten Schreibversuchen5 vermochte sie eine Waffe zu schmieden, die, wie sie schreibt, «sich gegen alles richtet, was den menschen am menschsein hindern will».6
Ihr Erstling «steinzeit» ist ein Panoptikum der Unmenschlichkeiten, ein Dokument des Grauens, aber auch ein herausragendes Beispiel dafür, was die Sprache des Zorns zu leisten vermag. Der Zorn ist ihre erneuerbare Energie, mit der sie die Sprache erst hervorbringt, die sie dann mit ihren Händen gestaltet, in Schwingung bringt, in eine Ästhetik der Macht und Gewalt, aber auch des Widerstands umformt. Mariella Mehr verwandelt in ihren Romanen, Gedichten und Bühnentexten Zorn in Poesie. Sie ist die Meisterin des Zorns. Zuweilen, in nichtfiktionalen Texten, bleibt der Zorn auf dem Weg zur Poesie stecken, trifft sein Objekt mit voller Wucht. Etwa wenn sie den «Herren Dichtern»7 zürnt: «da sasst ihr und ich hätte jeden von euch fragen wollen, mit welchem selbstverständnis ihr euch erlaubt, das publikum mit derart mittelmässiger, provinzlerischer und sexistischer Literatur zu beleidigen, doch ihr sasst so selbstgerecht hinter euren gläsern, befriedigt von eurem billigen onanierreigen, dass mir kotzübel wurde.»8 Oder wenn sie Hermann Burgers «Künstliche Mutter» und Jürg Federspiels «Geographie der Lust» als frauenverachtend identifiziert. Inzwischen sind solche öffentliche Angriffe gegen Schriftstellerkollegen undenkbar geworden, heute sitzen die Autor/innen gemütlich zusammen wie beim «Donnschtig-Jass» und wenn zwei mal anderer Meinung sind, wittert das Feuilleton einen Literaturstreit.
Protest, Wut und Empörung
Zorn ist Teil eines weiten, unübersichtlichen Feldes von Gefühlen, die insgesamt nicht den besten Ruf haben, weil sie den Menschen dazu verleiten, im besten Fall das durch eine Vielzahl von Codes abgesteckte Gebiet des guten Benehmens zu verlassen, im schlimmeren Fall nicht nur Verhaltensregeln, sondern Gesetze zu verletzen oder sich gar zu versündigen. Der Zornige verletzt die Regeln des Anstands, des Staates und
Gottes selbst. In seinem Refugium haben Sanftmut, Gnade und Yoga nichts zu suchen. Lässt sich das Gefühlsfeld ordnen? Wie unterscheidet sich der Zorn vom Protest, von der Wut, der Empörung?
Protest ist die gepflegte, kontrollierte Form des Zorns. Findet er auf der Strasse statt, braucht er im Gegensatz zum Zorn die Masse, ohne die er gar nicht zustande kommt. Ein einzelner Protestierender wirkt manchmal traurig, lächerlich, meistens aber hilflos und verloren. Strassenprotest will Aufmerksamkeit, Reform, Umsturz. Zorn hingegen will nichts als sich selber loswerden. Die Weltverbesserung hat ihm zu viel Restsüsse. Der Protest lebt vom Echo, strebt vom Keimling zur vielgestaltigen Form, während der Zorn im Moment der höchsten Entfaltung schon die Zeichen seines Zerfalls in sich trägt. Nebst dem Massenprotest, der möglichst laut sein muss, existiert der stille Gruppenprotest, der die Masse in schriftlicher Form (Communiqué, Flugblatt, Mail, Inserat) erreichen will. Die Schlussversion des Protests ist das Ergebnis von Sitzungen oder Vollversammlungen so mühsam wie die Durchquerung der Sahara. Der zornige Ursprung des Protests hat sich in gereizte Ermattung verwandelt.
«Nährboden der Empörung ist Betroffenheit.»
Im Unterschied zum Zorn und Protest, die irgendwann im Pleistozän entstanden sind, existiert der Intellektuellenprotest seit 120 Jahren, ist also eine historisch neue Erscheinung. Er wird am Schreibtisch verfasst. Der Intellektuelle hat die bildungsbürgerliche Masse im Blick, die er kraft seines Namens und seiner Gedanken in Bewegung, das heisst in die weltanschaulich richtige Richtung, versetzen will. Der intellektuelle Protestierende wägt ab, bevor er sich zur Tat entscheidet. Er ist ein Lauerjäger. Und wenn, dann verwandelt er höhlengereifte Gedanken in einen gut lesbaren, gleichwohl maximal scharf verfassten Text, denn die Öffentlichkeit reagiert nun mal auf scharfes Zeug. Beliebte Objekte des Protests, die eine reiche Ernte an bildungsbürgerlichen Likes einbringen, sind die Banken, der Populismus oder der Neoliberalismus; lediglich die Kämpfer fürs ordoliberale Kalifat der «NZZ» schauen grimmig. Andere intellektuelle Protestierende schreiben ununterbrochen das, was sie angeblich nicht schreiben dürfen. Es sind die Könige im Reich der wahren Volksvertreter.
Ein paar Tropfen Ressentiment
Der Zorn verbrennt den Zornigen. Demgegenüber ist der Protest – vergleichbar der Religion – eine Ressource im Kampf um Identität. Er verspricht Halt und Sammlung in einer zerklüfteten, hybriden, von Millionen Stimmen durchschallten Welt. Und er generiert Distinktionsgewinne. Zorn und Wut sind miteinander verwandt, wollen aber nichts miteinander zu tun haben. Während der Zornige durch seine Eruptionen einen Boden legt, der keine andere Funktion hat, als ihn mit der Welt zu verbinden, betrachtet der Wütende mit dem Opernglas das Geschehen, das er unablässig beschimpft, verunglimpft, verteufelt. Der Wütende ist ein Kritiker ohne Verstand. Wutbürger suchen, finden, verbinden sich und pusten sich gegenseitig heisse Luft ins Gehirn, was ihnen ein ewiges Leben sichert. Zornbürger hingegen findet man nirgendwo. Der Zornige sucht nicht seinesgleichen, sondern ist auf sein Objekt ausgerichtet, und hat er sein Magma in die Atmosphäre geschleudert, dampft und stöhnt er noch eine Weile, kommt dann bald zur Ruhe. Zorn ist maximale Intentionalität, Wut wummert ziellos. Zorn will rasch an ein Ende kommen. Wut will das ewige Leben, aber keine Erlösung.
Der Zorn ist ein Auslöschungsvorgang, weil er das, was ihn hervorbringt, zwar nicht vernichtet, so doch aus dem Blickfeld und sogar aus dem Gedächtnis verbannen kann. Ist das der Fall, könnte man von einem gelungenen Zorn sprechen. Droht die Wut zu erlahmen, reichen ein paar Tropfen Ressentiment und schon läuft die Maschine wieder auf Hochtouren.
In Wutgewittern
Wer mit Zornigen oder Wütenden zusammenlebt, hat Grund zum Jammern. Beide sind zuweilen laut, unanständig, inkorrekt, sie schwitzen und schäumen und sind näher an der Pathologisierung, als sie sich denken können. Demgegenüber sind die Empörten beliebte Zeitgenossen, weil sie unaufhörlich zum Ausdruck bringen, dass ihre Moral eine höhere ist als die herrschende. Die Rede ist hier nicht von jenen Empörten, die sich über Grillgeruch, den Schiedsrichter oder die Tischsitten chinesischer Touristen entrüsten, sondern von denen, die den Zustand irdischen Seins und all seiner Manifestationen grundsätzlich beklagen. Im Gegensatz zum Zornigen, der ungern, weil von der Not getrieben, aus dem heimischen Gehäuse ausbricht, trägt der Empörte seine Empörung auf einer langen Fahnenstange vor sich her. Er meint, der Unempörte sei unsensibel für Ungerechtes, Ungeheuerliches, weil er eine zu dicke Haut oder ein zu dünnes Herz habe.
Nährboden der Empörung ist Betroffenheit. Sie ist die anthropologische Grundkonstante unserer Zeit, der Resonanzraum für Zeichen und Stimmen aller Art, grösster gemeinsamer Nenner der vernetzten Gesellschaft und ein Rohstoff von unermesslichem Wert. Je mehr er abgebaut wird, desto grösser sein Vorkommen. Die Empörung ist der moralische Flügel der Betroffenheit, die niemals zum Zorn heranwächst, während die Empörung unentwegt Signale aussendet auf der Suche nach empörtem Leben. Und es findet und abbildet: Empörung ist instagrammable.
So wie der Zorn kein Modus des Willens ist, ihm aber den Weg bahnt, so ist die Sprache nicht Zorn selber, aber doch seine Vollstreckerin. Anders gesagt: Zorn als Affekt, der dem vegetativen Urschlamm zu entstammen scheint, mündet in Sprache und findet erst in der Sprache zu dem, was er ist. Gewiss, die Sprache des Zorns ist gröber gewirkt als eine Tapisserie, ihre Zerstörungskraft grösser als die eines Ziselierhammers und nicht selten kommt sie etwas einfältig oder vulgär daher, trotzdem bedeutet sie nicht die Perversion oder Abwesenheit des Verstandes, sondern seine maximale Transformation. Mit anderen Worten: Zorn ist ein Mittel der Erkenntnis. Kondensierte Seelenflüssigkeit, die zur Sprache findet. Der Zorn schiesst also nicht aus dem Nichts hervor, sondern aus dem Boden sedimentierter, inaktivierter Erfahrung und Reflexion.
Jahrzehnte nach Burger, Hohl, Koster und Mehr, Jahrzehnte nach dem Aufstand gegen die eidgenössische Enge hat sich die Asche des Zorns übers Land gelegt. Hin und wieder ist ein weltmännischer Protest zu hören. Ein kleines Wut-Gewitter am Twitter-Himmel. Insgesamt ist die Tonlage eine nüchterne, manchmal traurige, manchmal komische, sehr oft eine lakonische und meistens pulsiert im Untergrund die leidende Dissidenz. Wer jemals vom Zorn getroffen wurde, wird ihn nicht vermissen. Die Zornerprobung steht weit unten auf der Liste der kompetenzorientierten Lerninhalte. Richten wir unseren Blick auf die Erkenntniskraft des Zorns, seine bis zum Äussersten geschärfte Sprache, mit der er etwas aufbrechen und in Bewegung bringen kann, vermissen wir ihn vielleicht doch ein bisschen.
Ludwig Hohl: Die Notizen oder Von der unvoreiligen Versöhnung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981, S. 509. ↩
Ebd., S. 507. ↩
«Irgendein Verleger hat zu mir gesagt: Mensch, Sie haben so einen sensationellen Stoff und schreiben das mit so einer Nüchternheit nieder! So muss es auch sein, gab ich
zur Antwort, das gehört zu meiner Persönlichkeit.» In: Dora Koster: Nichts geht mehr. Zürich: Unionsverlag, 1980, S. 13. ↩Stefan Howald: Worte wie Bomben. Der Eigensinn der Dora Koster. In: WOZ Nr. 3, 18.1.18, S. 15–17. ↩
In einem Bericht zuhanden der Pro Juventute heisst es: «Sentimentales unaufrichtiges Zeug. Mit etwas Fleiss würde das jeder zustandebringen. Ausserdem sei sie davon überzeugt, dass M. viele Texte einfach abgeschrieben habe. Aber Frl. … meint, man
solle ihr die Illusion lassen, eine grosse Schriftstellerin zu sein. So falle sie dem Teufel vielleicht nicht ganz vom Karren.» In: Mariella Mehr: Kinder der Landstrasse. Bern: Zytglogge, 1987, S. 87. ↩In: Pro Helvetia (Hrsg.), Zwischenzeilen. Schriftstellerinnen der deutschen Schweiz, Bern 1995. ↩
Gemeint sind H.C. Artmann, Walter Kauer, E.Y. Meyer, Paul Nizon und Otto F. Walter. ↩
«gopferdeckelduseckel». In: Mariella Mehr: RückBlitze. Bern: Zytglogge, 1990, S. 143. ↩