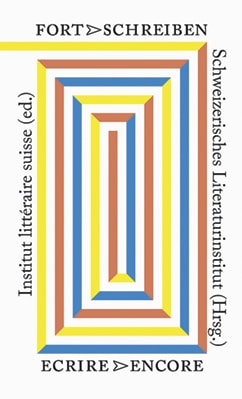Heimaten, die [Pl.]
Budapest, Luzern, Rom – drei Orte, dreimal ein Zuhause.
Was bleibt, wenn man sich verpflanzt?
Ein Gespräch über ein Gefühl.
![Heimaten, die [Pl.]](https://literarischermonat.ch/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/01984dcdd92115a003bb1ef227c0bb10446a77c4-27x20.jpg)
Frau Viragh, Sie sind 1960 mit Ihren Eltern in die Schweiz gekommen. War das eine bewusste Entscheidung?
Ja, mein Vater war ein grosser Fan der Schweiz und irgendwie auf sie geprägt, schon von Jugend auf. Noch vor dem Krieg hat er hier Ferien gemacht. Und er hatte einen guten Freund in Luzern, der uns auch geholfen hat, aus Ungarn herauszukommen. Es war eine bewusste Wahl, ja, jedenfalls vonseiten meiner Eltern.
Was haben Sie über die Schweiz gehört, bevor Sie hingezogen sind?
Nichts. Ah, nein, doch, ein klein wenig. Die Leute zum Beispiel verwechselten jeweils, ob wir nach Lausanne oder nach Luzern gehen würden. Und: ein Herr aus Luzern kam jeweils zu Besuch – ein Freund dieses Freundes –, der mir Kaugummi mitbrachte. Dazumal, im kommunistischen System, war das eine Rarität. Mir wurde zwar schlecht von den Kaugummis, aber immerhin konnte ich die Schweiz an diesen Mitbringseln des Herrn aus Luzern festmachen.
Dieser Tage jährt sich der Ungarische Volksaufstand von 1956 zum 60. Mal. Ist Ihre Familie auch im Zuge dessen ausgewandert?
Erst 1960, aber doch aus diesen Gründen. Meine Eltern hatten Glück, weil sie nicht nur den Freund aus Luzern kannten, sondern auch andere Leute, noch aus der Zeit, als mein Vater im Ausland gearbeitet hatte. Alle zusammen haben dann an den Fäden gezogen, damit wir noch herauskamen. Denn 1960 konnte man ja nicht mehr einfach so über die Grenze spazieren, wie an den wenigen Tagen 1956, als man wirklich zu Fuss das Land verlassen konnte.
Man liest im Zusammenhang mit den Gedenkfeiern, dass 1956 im heutigen Ungarn ein grosses identitätsstiftendes Moment zukomme. Wie ist Ihr Blick auf solche Mythen? Können Sie als Schriftstellerin nachvollziehen, dass diese eine so tragende Funktion einnehmen?
Ja, sicher braucht es Mythen, das wissen wir. Vielleicht müsste man in diesem Fall fast sagen: leider.
Wieso leider?
Sagen wir es ruhig: 1956 wird heute beschlagnahmt von der gegenwärtigen, unsäglichen Regierung. Die Erinnerung an die Revolution soll die nationalistischen Gefühle anheizen. Die damaligen Proteste aber waren das genaue Gegenteil, es war ein Aufstand gegen Gewalt und Unterdrückung. Die heutige Regierung hingegen schwenkt immer mehr auf die Linie der Diktatur ein. Für mich, für mein ganzes Leben, hat 1956 eine grosse Bedeutung, nur schon als persönliches Erlebnis. Dazu kommt die Idee, dass man sich gegen Tyrannen erheben soll und kann.
Sie übersetzen aus dem Ungarischen unter anderen Imre Kertész und Péter Nádas. Beide beschäftigen sich in ihren Büchern mit der Geschichte Ungarns, besonders des Zweiten Weltkriegs. Waren diese Themen mit ein Grund, diese Übersetzungen anzugehen? Im Sinne einer Wiederaneignung, obwohl Sie draussen waren aus dem ungarischen Kontext, die Geschichte irgendwie wieder erfahrbar zu machen – für sich?
Ja. Ich sitze gerade an Nádasʼ neustem Buch, da ist es noch mehr so. Es ist eine Autobiographie, Memoiren, in denen er viel vom Zweiten Weltkrieg spricht und von den Jahren danach. Ich höre hier wieder, was meine Eltern vielleicht nicht einmal erzählten, aber was rundherum, wie soll ich sagen, der «Text» war, ihre Welt und ihr mentaler Hintergrund. Dieses Buch erhellt mir das alles wieder. Und ich staune manchmal, wie sehr seine Beschreibungen meinen Erinnerungen gleichen, zum Beispiel, was damals der Ton war, wie die Leute miteinander umgingen. Das kommt mir alles sehr bekannt vor.
Woher kommt es, dass man sich in seinen Büchern mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzt? Sie haben ja die Emigration immer wieder zum Thema gemacht.
Bei mir ist es so, und vielleicht ist es bei anderen auch so, dass etwas einfach nicht ganz geklärt ist. Dass etwas weg ist. Und man möchte es noch einmal aufleben lassen. Nicht aus Nostalgie, sondern weil man wissen, noch einmal hinsehen will. Besonders wenn man sein Land verlässt, entsteht ein krasser Bruch. Wir waren wirklich Flüchtlinge, auch wenn wir relativ sanft aus Ungarn herausgekommen sind. Da ist etwas Unklares zurückgeblieben, etwas nicht Einsehbares, auch für mich nicht. Und für meine neue Umgebung erst recht nicht, die hatte davon keine Ahnung. Man will also das Ungeklärte doch nochmals hinstellen und sehen und es auch andere sehen lassen.
Weil Ihnen die Möglichkeit fehlte, das aus erster Hand nachvollziehen zu können?
Ja, das ist es vielleicht: dem Fehlenden eine Realität geben, auch wenn sie fiktiv ist. Und in dieser Realität nochmals wohnen. Wenn man schreibt, wohnt man ja in seinem eigenen Text. Ich wollte diese Realität nochmals um mich haben, um zu wissen, wie es war – auch wenn sie rein subjektiv ist, und relativ. Durch das Schreiben erhält diese Realität aber doch drei Dimensionen und ist nicht mehr nur vage Erinnerung, sondern etwas, das für mich selbst greifbarer wird. Das hat noch seine besondere Dringlichkeit, wenn man an einem Ort aufwächst, der nicht dasselbe erlebt, sondern seine eigene Vergangenheit hat.
Vom stürmischen Budapest kamen Sie in die beschauliche Stadt Luzern. In Ihren Büchern kommt diese Region immer wieder vor, erscheint mitunter etwas trostlos, abweisend. Gleichzeitig lesen sich Ihre Texte aber auch humorvoll, Situationskomik folgt auf Schicksalsschlag.
Das ist für mich die Realität, realistisches Schreiben. Das eine kommt nie getrennt vom andern vor, selbst in den ärgsten Situationen nicht. Manchmal reicht auch nur ein Perspektivenwechsel, dass sich etwas ins Komische verkehrt. Man kann die Tragödie nicht von der Komödie trennen.
Sehen Sie in Ihrem Schreiben gewisse stilistische Heimaten? Etwas, das Sie dem Ungarischen oder dem Schweizerischen zuschreiben würden?
Ja, vielleicht kommt meine ironische Ader von meiner Budapester Kindheit her. Ich habe die Stadt zwar früh verlassen, aber atmosphärisch von meinen Eltern doch mitbekommen: die Budapester Intellektuellen sind sehr ironisch. Ironie ist Teil ihres Nachdenkens über die Dinge. Ist wohl ihre Art, die wirklich nicht einfache Geschichte Ungarns zu verarbeiten. Man muss die Dinge auch von ihrer komischen Seite sehen können, sonst geht es nicht weiter. Aber ich will keinen Gegensatz konstruieren. Auch viele Schweizer Schriftsteller schreiben ironisch. Die Ironie ist eigentlich immer, fast immer, ein Requisit der guten Literatur.
Man kann über Sie lesen, dass Sie schon als Kind Schriftstellerin werden wollten. Wussten Sie das, bevor Sie aus Ungarn ausgewandert sind?
(lacht) Schon vorher? Nein. Das kam erst in der Schweiz, als ich schon richtig lesen und schreiben konnte.
Hat die Erfahrung der Emigration dieser Entscheidung für die Schriftstellerei vielleicht Vorschub geleistet? Oder anders gefragt: Gibt es ein Bewusstsein dafür, dass diese Erfahrung Ihnen die Möglichkeit alternativer Lebensläufe eröffnet hat?
Ich stelle mir die Frage auch immer wieder, und ich glaube: ja. Sicher spielte das Bedürfnis mit, sich eine Art Zuhause zu erschreiben. Aber da ist zum Beispiel auch das, dass ich mich nochmals verpflanzt habe, hierhin, nach Rom. Wenn man einmal einen Ort verlassen hat, ist die Idee, dass man den nächsten Ort auch wieder verlassen kann, näher, im Bereich des Möglichen. Das hat mich sicher stark geprägt. Und ich merke es erst jetzt wirklich.
Obwohl Sie diese Erfahrungen bereits in Ihren frühen Büchern zum Thema gemacht haben?
Ja, natürlich, die Auseinandersetzung mit dem Thema war bewusst. Und trotzdem, je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie sehr die Emigration auch mich als Person geprägt hat. Es ist vielleicht eine Alterserscheinung, dass man sich deutlicher sieht.
Man sagt auch, wenn man älter werde, verlange es einen nach Essen aus der Kindheit. Ist das bei Ihnen auch der Fall, trotz römischer Küche?
Nein. Ich habe keine Nostalgie nach diesen Jahren. Ich weiss einfach, dass sie mich geprägt haben. Das schliesst aber nicht aus, dass ich auch mal etwas Ungarisches koche, ganz unprogrammatisch.
Und die ungarische Sprache, hat die etwas Nostalgisches?
(zögert) Ja. Aber rein relativ gesehen: nicht die ungarische Sprache an sich, sondern für mich. Nostalgisch, das klingt so, als ob man sich nach etwas zurücksehnt. So ist es nicht, aber etwas sehr Vertrautes kommt mir aus der ungarischen Sprache entgegen, wenn ich sie lese, spreche oder höre. Es ist ja doch die erste Sprache, die ich gekonnt und gehört habe.
Können Sie mit dem Begriff überhaupt etwas anfangen, «Heimat»?
(überlegt) Nein. (lacht) Das heisst, doch, sofern wir festhalten, dass es mehrere davon geben kann. Wenn man es so definieren kann, dass es Orte sind, denen man sich aus irgendwelchen Gründen vertraut fühlt, wo einem etwas entweder wesentlich entspricht, man etwas gut kennt oder man temperamentmässig richtig zum Ort steht – dass irgendeine Art von Harmonie da ist –, dann sind das Heimaten. Sicher ist das für mich so, vielleicht für andere nicht. Ich würde aber doch behaupten, dass mein Modell genauso gut ist wie das Modell derer, die einfach eine Heimat haben und an dieser festhalten. Es ist, meine ich, genauso realistisch und authentisch, wenn man sagt, das und das sind meine Heimaten. Ich habe zum Beispiel drei Orte, von denen ich mit verschiedenen Vorzeichen und in diesem Sinn je als Heimat sprechen würde.
Die «Heimat» hat für mich auch eine Komponente der Unterstellung, man ist ja nun mal einfach irgendwo geboren. Ich glaube, der Begriff, damit er greift, braucht ein gewisses Mass an Einwilligung. Andererseits überkommt einen das Heimweh unwillentlich. Da geht meine Theorie nicht auf, mit der Schweizer Krankheit, dem «mal du Suisse».
Vielleicht lässt man heute die «Heimat» ohnehin besser aus dem Spiel und spricht eher vom Gefühl, zuhause zu sein. Mit Betonung auf Gefühl: sich zuhause fühlen. Das kann dann auch punktuell sein, und dann ist auch die Frage nach der Herkunft und der Unterstellung nicht mehr so akut. In jungen Jahren bin ich durch Asien gereist – und an vielen Orten überkam mich das Gefühl, zuhause zu sein. In diesen punktuellen Momenten kommt einem etwas bekannt vor, wird etwas in einem angesprochen, ohne dass das gleich bedeutet: «So, da bleibe ich jetzt.»
Man ist in jungen Jahren doch auch anfälliger dafür, sei es durch Reisen oder im Lesen. Man kennt nur den Horizont, den man nicht selbst gewählt hat, und plötzlich liest man, was man vielleicht schon gedacht hat, aber keinen Referenzrahmen dafür kannte.
Ja, das meine ich auch mit dem punktuellen Zuhause – und auf der geistigen Ebene ereignet es sich sogar noch häufiger. Nicht nur in der Jugend. Höchstens, dass man da häufiger Aha-Erlebnisse hat, weil man erst dabei ist zu erfahren, wie stark einen Texte ansprechen können. Später dann sucht man in ihnen diese geistigen Heimaten – was vielleicht gar nicht so gut ist.
Sie schreiben auch über Ihre jetzige Residenz Rom. In einer früheren Kolumne in der Zeitschrift «werk, bauen + wohnen» hatten Sie über die Engelsburg oder hässliche Bauten am Meer nachgedacht. Ist Architektur etwas, das Ihnen zusagt?
Ja, die interessiert mich sehr. Leider wäre ich absolut unfähig gewesen, sie zu studieren, da mir die mathematischen Fähigkeiten fehlen. Aber mich interessiert sehr, wie Häuser aussehen – von aussen wie von innen. Vielleicht sogar noch mehr von innen. Wahrscheinlich wäre ich Innenarchitektin geworden.
Sie haben eben auch gesagt, wenn man schreibe, wohne man in einem Text. Geht es beim Schreiben auch ums Einrichten?
(überlegt) Ja, man könnte wohl vieles unter dem Stichwort «wohnen» betrachten: Wo wohnt man? Abgesehen vom konkreten Raum. Das Wohnen in einem Text bedeutet vor allem, dass man den virtuellen, leeren Schreibraum Schritt für Schritt einrichtet – und Schritt für Schritt zu einem Stück Realität macht.
Könnten Sie es sich vorstellen, wieder in die Schweiz zu ziehen?
(überlegt)
Oder eher nochmals an einen ganz neuen Ort?
Eigentlich nicht. Auch wenn ich mir schon vorstellen könnte, wieder in der Schweiz zu wohnen. Ich mag die Schweiz und habe auch viele Freunde da. Und trotzdem käme es mir komisch vor. Jetzt bin ich doch schon 22 Jahre hier. Es gibt zu viel, das ich hier sehr gern habe. Das zu verlassen und zurückzulassen würde mir extrem leidtun – bei allen Schwierigkeiten, die das Leben hier mit sich bringt.
Die Schweiz hat keine Grossstadt wie Rom, würden Sie deren Vorzüge vermissen?
Ja, das mit der Grossstadt ist richtig und reicht auch wieder weiter zurück: die Grossstadt Budapest ist für mich eine Urprägung. Nicht zufällig – für mich nicht zufällig – ist Rom ungefähr so gross wie Budapest. Rom ist eine kleine Metropole, nicht unüberblickbar. Ich könnte zum Beispiel nicht in London leben. Eine Stadt wie Rom ist für mich das Richtige, solche Dimensionen habe ich als kleines Kind gewissermassen eingeatmet. Natürlich sind Rom und Budapest sehr verschiedene Städte, aber trotzdem: relativ ähnlich grosse Städte haben auch einen ähnlichen Rhythmus. Irgendetwas erkenne ich hier wieder. Als geborene kleine Grossstädterin.
Das gilt heute für immer mehr Leute. Die meisten Menschen zieht es in die Städte. Und wenn sie in eine Grossstadt reisen, finden sie sich schnell zurecht, kommen mit den Menschen ins Gespräch, können sich orientieren, ja niederlassen.
Ich weiss nicht, ob das wirklich so ist. Klar, gewisse Formen unserer globalisierten Gesellschaft sind sehr ähnlich geworden und da findet man sich wieder. Aber ob es so leicht ist, sich in einer fremden Grossstadt niederzulassen? Jetzt, einfach von einem Moment auf den andern? Da wäre ich nicht so sicher. Für die Jungen ist das vielleicht leichter, aber ich sehe die Dinge auch aus italienischer Perspektive und sehe, wie unglaublich schwierig es ist, auch für die Jungen, irgendwo Fuss zu fassen. Alle wollen weg, natürlich. Es ist nicht einfach, und noch viel schwieriger ist es für die, die sich hier niederlassen möchten. Auch für andere Europäer, nicht nur für die Flüchtlinge, die hier nicht viel Hoffnung auf ein besseres Leben haben können. Am leichtesten ist es für die, die eine Nische finden, etwas, in dem sie noch mit einem anderen Land verbunden sind, als Journalisten zum Beispiel. Gesamthaft gesehen habe ich nicht das Gefühl – vielleicht täusche ich mich –, dass es heute so viel einfacher ist, sich zu verpflanzen.
Christina Viragh
ist Schriftstellerin und Übersetzerin. Ihre Kindheit verbrachte sie in Budapest, mit sieben Jahren kam sie nach Luzern, studierte in Lausanne und lehrte in Kanada. Heute lebt sie in Rom. Zuletzt von ihr erschienen sind ihr Roman «Im April» (Ammann, 2006) und die Übersetzung von Péter Nádas’«Parallelgeschichten» (Rowohlt, 2012).
Serena Jung
ist Redaktorin dieser Zeitschrift.