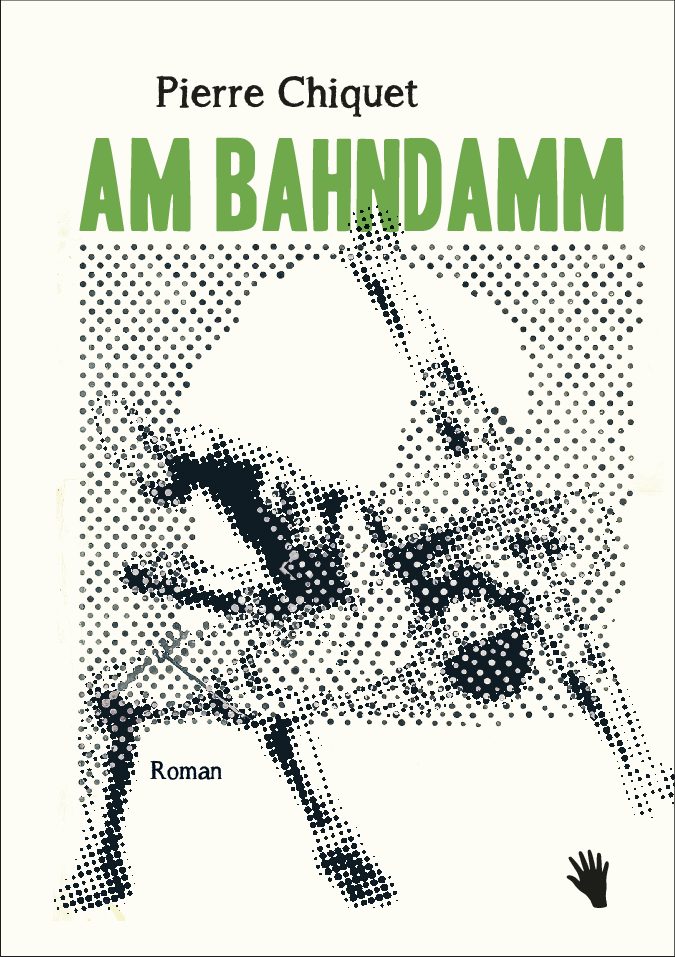Herr Marzianis Experimente
Eine Kurzgeschichte.
Herr Marziani arbeitet an einem Buch. Er spürt schon dessen Form, ahnt die Inhalte und Bezüge und erkennt den Sinn, auch wenn er manchmal den Eindruck hat, das bereits Geschriebene sei nicht mehr als ein Sammelsurium abgedroschener oder unverständlicher Sätze.
Vor Herr Marzianis Haus hat man innerhalb weniger Monate zwei siebenstöckige Wohnblöcke hochgezogen. Herr Marziani steht mit einer Tasse in der Hand am Fenster, beobachtet den Kran und das Treiben der Arbeiter und kehrt dann an den Tisch zurück, um etwas zu schreiben oder zu streichen. Wenn ihn jemand fragen würde, was er gerade tue, würde er ohne jede Selbstgefälligkeit «nichts» antworten.
Herr Marziani weiss genau, dass zu viele Bücher geschrieben und publiziert werden. Warum tut er es dann auch? In Wirklichkeit wird ein Buch nicht einfach produziert, um es zu den bereits existierenden hinzuzufügen, in der Literatur gibt es keine Akkumulation, es gibt nur eine Praxis des Denkens und der Vorstellungskraft, lebendige oder tote Sprache, Bewegung oder Stillstand, Verständnis oder Unverständnis, authentische oder falsche Figuren, Präsenz oder Vergessen.
Herr Marzianis Tätigkeit besteht eigentlich nicht darin, ein Buch zu schreiben, etwas Vollendetes zum Abschluss zu bringen, sondern vielmehr darin, zu studieren und zu experimentieren, auch wenn er weder genau sagen könnte, was er studiert, noch welches die Gegenstände und Methoden seiner Experimente sind.
Familienanthropologie
Herr Marziani ist glücklich, dass er eine Familie hat. Er interpretiert Kafkas Aphorismus «Was ist fröhlicher als der Glaube an einen Hausgott!» gern auf seine Weise. Für manche, Kafka eingeschlossen, ist die Familie eine Falle, sind das Vater- oder Muttersein ein Fluch oder zumindest gleichbedeutend mit Selbstaufgabe, mit einer Niederlage, einer Kapitulation vor dem biologischen Prinzip der Fortpflanzung der Arten, doch Herr Marziani sieht das anders, zumindest bisher.
Um nicht ins Sentimentale abzugleiten, spricht er von den Kindern wie von einem der vielen Experimente, mit Hilfe derer ein Mensch versuchen kann, sein Wissen über die eigene, sich selbst anmassend als Homo sapiens sapiens bezeichnende Spezies zu vertiefen.
Man nehme ein anderthalbjähriges Kind, sagt Herr Marziani, und beobachte, wie es sich durch seinen Körper und die Gegenstände ausdrückt, die es zu fassen bekommt. Sprachliche Darbietungen begleitet es mit kleinen Pantomimen: Heute imitiert es eine Gebärde oder eine Klangfolge, ohne zu wissen, was es tut oder sagt, morgen ist alles bereits assimiliert und gehört zum Repertoire. Kinder geben laufend Beispiele eines sich durch Transformation, Assimilation und Einfühlungsgabe wandelnden Wissens.
Man nehme ein fünfjähriges Kind, sagt Herr Marziani weiter, man nehme die Geschichten, die es rund um jene Dinge spinnt, die es beeindrucken: Sie sind wie die Hypothesen eines Wissenschafters, der einem Phänomen gegenüber, das sich ihm noch entzieht, aber dem er sich auf diese Weise dennoch annähern kann, seiner Phantasie freien Lauf lässt. Zum Beispiel: «Stimmt es, dass die Sonne irgendwann erlöschen wird? Ist es dann dunkel? Ich will nicht, dass die Sonne erlischt. Vielleicht können wir mit einer Rakete hinfliegen und sie mit einem Streichholz wieder anzünden. Ist es so, als wäre kein Holz mehr da? Aber wieso fällt das Holz nicht runter?»
Auf der einen Seite ist das Universum, auf der anderen der Beobachter, der sich mit den ewigen grossen Fragen und den Gefühlen, die diese in ihm hervorrufen, auseinandersetzt, angefangen bei der Angst vor der Dunkelheit – der grossen Dunkelheit.
Und dann ist die Familie natürlich auch ein Zoo mit offenen Käfigen, wo die Affen sich um die Mützen der Wächter balgen, Tiger und Löwen sich frei zwischen Sitzbänken und Wegen herumtreiben, Elefanten und Giraffen das Kassenhäuschen auf den Kopf stellen, die Kinder sich zusammen mit den Seehunden in Szene setzen und dabei unaufhörlich rufen: «Mama, schau mal!», «Papa, schau mal!», während Mama und Papa dem Pinguin mit dem Eiswagen nachlaufen, die Hand ausstrecken und merken, dass das Eis ausverkauft ist und im Wagen ein Krokodil sitzt.
Herr Marziani geht arbeiten
Herr Marziani arbeitet in einem Verlag, wo er sich unter anderem mit einer medizinischen Zeitschrift befasst. Es ist interessant zu sehen, auf welche manchmal unerhört raffinierte Weise das menschliche Leben sich um das menschliche Leben kümmert, auch wenn er es unangenehm findet und es ihn beängstigt, den Körper als eine aus Organen, Knochen, Geweben und verschiedenen Flüssigkeiten zusammengesetzte Maschine zu betrachten.
Die Ärzte operieren mit dem Skalpell in der Brust des Herzpatienten, Herr Marziani operiert mit dem Bleistift in den Berichten der Ärzte, liest sie und liest sie wieder, um schliesslich aufgrund seiner vielleicht allzu leicht erregbaren Phantasie zu entdecken, dass der im Operationssaal liegende Herzpatient kein anderer ist als er selbst. Kurzschlüsse dieser Art zwingen ihn, mitten in der Transplantation etwas frische Luft schnappen zu gehen.
Wie so viele Büroangestellte liebäugelt auch Herr Marziani damit, sich eine Stelle als Hilfsgärtner zu suchen: draussen arbeiten, fernab von Papierkram und Bildschirmen, den Gedanken freien Lauf lassen und, als Hilfskraft, keine wirkliche Verantwortung tragen. Warum wagt er dann keinen Versuch? Weil er genau weiss, dass der Hilfsgärtner seiner Phantasie ein Klischee ist, ein Postkartenbild, das sich zur Arbeit gleich verhält wie ein Sonnenuntergang mit Meer, Palmen und Kuss im Gegenlicht zur Paarliebe.
Als Herr Marziani einmal frühmorgens auf dem Weg zur Arbeit durch einen Park geht, bleibt er stehen, um sich mit einem Gärtner zu unterhalten, der gerade Öl und Benzin in die Motorsäge füllt. Dann hebt der Gärtner den Blick und sagt: «Ah, es muss schön sein, in einem Verlag zu arbeiten, den ganzen Tag in einem bequemen Sessel zu lesen, die Tasse immer in Reichweite, und danach mit den Kollegen darüber zu diskutieren, ob es einem gefallen hat oder nicht…»
Zeitungslektüre
Herr Marziani schlägt die Zeitung auf, die er im Zug auf einem Sitz gefunden hat, und blättert sie zerstreut durch, bis plötzlich ein Foto seine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Was ist darauf zu sehen?
Ein Fund im Eis – in mattem, dreckigem und teilweise vielleicht schon matschigem Eis. Das Element, das man sofort erkennt, ist ein eleganter Damenbergschuh mit einer solid genagelten Sohle, der sich von einem Bündel dunkler, anscheinend um einen Holzbehälter gewickelter Lumpen abhebt. Das Ganze erinnert von oben gesehen an einen Bronzeguss in der Tradition von Francis Bacon. Neben dem linken Schuh liegt unauffälliger der rechte, während man etwas weiter drüben die Sohle eines Männerschuhs und eine Mütze erkennt. Eine verzerrte, zusammenhanglose Gruppe, ein Menschenbündel, eine Verknotung, die aus mindestens zwei Personen, einem Mann und einer Frau, besteht. Es gibt auch eine Glasflasche mit einer Prägung, die allerdings nicht lesbar ist.
Die Überschrift lautet: «Die Gletscherleichen sind identifiziert». Herr Marziani liest den Artikel und erfährt, dass es sich um ein 1942 im Wallis verschollenes Paar handelt. Die beiden hatten sich auf den Weg zu ihrem Vieh im Hochgebirge gemacht und waren nicht zurückgekehrt. Sie war eine 37jährige Lehrerin, er ein 40jähriger Schuhmacher. Letzteres erklärt vielleicht die unglaubliche Widerstandsfähigkeit der Bergschuhe, die auch ihre Form perfekt bewahrt haben: Herr Marziani setzt seine Kurzsichtigenbrille ab, nimmt das Bild noch näher und überzeugt sich davon, dass dieses Schuhwerk mit der ganzen Liebe gemacht worden ist, die ein Mann seiner Frau und der Mutter seiner Kinder entgegenbringen kann.
Im Artikel steht auch, dass die Suche der Helfer und Einheimischen zweieinhalb Monate gedauert hatte, aber erfolglos geblieben war – keine Spur, die bestätigt hätte, was man gleichwohl ahnte, nämlich dass sie in eine Gletscherspalte gestürzt waren. Die Kinder wurden bei verschiedenen Familien in Obhut gegeben. Aus dem Gletscher steigen also auch diese Chöre auf – die aufgeregten Stimmen der Helfer, die Gebete der Dorfbewohner, die Diskussionen zu Hause bei den Pflegefamilien… Die Zeitung zitiert auch eine der Töchter, die 1942 vier Jahre alt gewesen war und sich nun, mit 79, auf das Begräbnis ihrer viel jüngeren Eltern vorbereitet.
Solche zeitlichen Verschiebungen und Verkehrungen geschehen in jedem Leben, denkt Marziani, während er die Zeitung wieder zusammenfaltet, nur dass im vorliegenden Fall das Gedächtnis oder der dafür bestimmte Teil des Gehirns wegen der gekippten Beziehung zwischen Psyche und Materie die Konsistenz von Eis angenommen hat und die mentalen Geister, zu denen Verstorbene normalerweise werden, hier auch als Mumien in Erscheinung treten.
Herr Marziani schlägt die Zeitung noch einmal auf und sieht, was er zuvor nicht gesehen hatte und was ihm jetzt in aller makabrer Deutlichkeit erscheint: einen Kopf, Haare, eine Augenhöhle, eine Wange, das Profil einer Nase, ein klar erkennbares Gesicht.
Herr Marziani kocht (nicht)
Heute müsste Herr Marziani eigentlich für seine Kinder kochen, er ist an der Reihe. Was hat er also mittags im Lager eines Brockenhauses zu suchen? Er beendet ein Geschäft. Der soeben erstandene runde Tisch wird seiner Meinung nach den alten, rechteckigen, der seit Jahren in der Küche im Weg steht, aufs vorzüglichste ersetzen.
Herr Marziani lädt den Tisch auf das Fahrrad und durchquert so das Viertel. Dieses akrobatische Unterfangen bringt ihm Pöbeleien vonseiten (männlicher) Autofahrer ein, aber auch ein paar bewundernde (weibliche) Blicke. Da letztere überwiegen, kommt Herr Marziani zum Schluss, dass es der Laune zuträglich sei, mit einem auf ein Fahrrad geladenen alten Holztisch herumzuziehen.
Als Herr Marziani endlich zu Hause ankommt, machen ihm die Kinder Vorwürfe: «Na toll, und was essen wir jetzt, den Tisch?» Tatsächlich ist die Mittagspause schon fast vorbei, und sie müssen zurück in die Schule.
Abends aber sind sich alle einig, dass der Tisch, den Herr Marziani besorgt hat, mit seinen 110 Zentimetern Durchmesser und den schmalen Beinen perfekt sei für eine vierköpfige Familie mit einer kubischen Küche wie der ihren. Es ist eine Frage der richtigen Distanzen, der physischen und moralischen Anordnung, der Ausrichtung von Türen und Fenstern, der jeweiligen visuellen Fluchtpunkte, der Luftströmungen, der Raum- und der Gefühlsgeometrie.
Fräulein Ellas Kra-kra-kra
Herr Marziani stattet seiner Bekannten Ella einen Besuch im Blindenheim ab.
«Du siehst gut aus», sagt Ella, als sie ihm die Hand schüttelt.
«Und du, alles in Ordnung?», fragt Marziani.
Sie erzählt ihm von einer Krähe, die sie nachts nicht schlafen lasse: «Sie kommt und belästigt mich mit ihrem Kra-kra-kra.»
«Das nächste Mal nehme ich ein Gewehr mit, dann schiessen wir sie ab und lassen sie ausstopfen.»
«Ich kann mir deine Jagdkünste ungefähr vorstellen! Bist du wenigstens treffsicher?»
«Nicht ganz so treffsicher wie du, aber fast.»
Ella, die nicht nur das Augenlicht, sondern wegen eines Tumors auch die Augäpfel verloren hat, macht gern Witze über diese Dinge.
Ein paar Stunden später steht Herr Marziani im Brockenhaus, weil er sich erinnert, dort eine ausgestopfte Krähe gesehen zu haben. Er kauft sie, befreit sie vom Staub, bis sie glänzt, und bringt sie seiner Bekannten als Geschenk. Diese stellt sie oben auf das Bücherregal: «Hier passt sie gut hin», sagt sie, «das ist meine Trophäe.»
Am nächsten Tag ruft Ella Herrn Marziani an und berichtet, sie habe herrlich geschlafen, ohne Kra-kra-kra, wie es schon lange nicht mehr passiert sei. Herr Marziani weiss nicht, ob er ihr Glauben schenken soll, aber sie beharrt darauf: «Glaube mir!»
«Ich glaube dir nicht.»
«Kra-kra-kra!»
Herr Marziani wird um einen Beitrag gebeten
Herr Marziani ist gebauchpinselt, weil ihn ein wichtiges ausländisches «Bulletin für Literatur und Philosophie» um einen Beitrag für eine Ausgabe zum Thema Freiheit gebeten hat. Er liest die Mail noch einmal: «Was ist Freiheit heute? Für wie frei dürfen wir uns in der vernetzten Gesellschaft, in der alles mit allem zusammenhängt und die Arbeit immer stärker in die Privatsphäre eindringt, noch halten? Welches sind die grössten Gefahren für die Freiheit? Die Familie? Die Lebenskosten? Die Schulden? Manche behaupten, die Welt habe sich in ein gigantisches, videoüberwachtes Gefängnis verwandelt. Sind Sie mit dieser Sichtweise einverstanden? …»
Fragen über Fragen! Aber wohlverstanden, die Tatsache, dass Herr Marziani gebauchpinselt ist, bedeutet nicht, dass er die Einladung anzunehmen gedenkt. Die Frist ist zu kurz und die Bezahlung zu bescheiden, fast lächerlich.
Und doch, und doch… Als er das Heft aufschlägt und anfängt zu schreiben, zu korrigieren, mit grossen X ganze Abschnitte zu streichen, hat er wie jedes Mal das Gefühl, wieder in der Schule zu sein. Am Schluss lautet die Fassung in Reinschrift folgendermassen:
Die Freiheit
Wir sind in dem Masse frei, in dem wir uns von Fall zu Fall befreien können.
Herr Marziani ist aufrichtig zufrieden mit dem, was er geschrieben hat, er hat den Eindruck, alles gesagt zu haben, was er zu diesem Thema zu sagen hat, seine einzige Befürchtung ist, dass die Redakteure des Bulletins den Text ein wenig kurz – lächerlich kurz – finden könnten, und so verzichtet er darauf, ihn einzusenden.
Herr Marziani geht schwimmen
Herr Marziani, der früher nie Interesse an sportlichen Aktivitäten gezeigt hat, kann entgegen jeder Prognose inzwischen Crawl schwimmen, nach jedem dritten Armzug atmen, einmal links, einmal rechts, und mit seinem gestreckten Körper das Wasser durchpflügen, ohne unnötige Spritzer zu verursachen. Er ist so begeistert, dass er in Erwägung zieht, ein Lob auf das Schwimmen zu schreiben. Bloss wozu? Sein Lob auf das Schwimmen besteht in der Tatsache selbst, dass er mit Hilfe seiner Arme durch das oder über das Wasser gleitet. Folgendes geschieht: Armzug um Armzug hört Herr Marziani innerhalb weniger Minuten auf, Herr Marziani zu sein, und verwandelt sich stattdessen in ein Dampfschiff mit Rauchfahne, Schaufelrädern und einem tiefen Schiffshorn: Tuu-tuuut. Eine Bahn und noch eine Bahn und noch eine Bahn. Atlantik, Indischer Ozean, Pazifik.
Aus dem Italienischen übersetzt von Barbara Sauser.