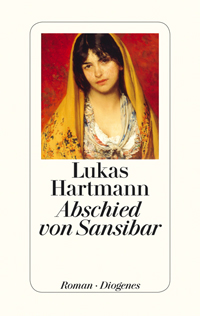Im Spiegellabyrinth
Über unser Verhältnis zu Sprachen und meine Arbeit an der Übersetzung des italienisch-arabisch-tessinerisch-französischen Romans «La chiave nel latte» von Alexandre Hmine.
Ich wühle im Haufen, hebe einen Buchstaben auf, überlege, ob ich ihn behalten und wohin ich ihn legen soll, will, dass Elvezia zu mir schaut, und frage sie, was ich geschrieben habe. Sie hat mir geraten, kurze Wörter zu schreiben – vier, höchstens fünf Buchstaben – und Vokale zu gebrauchen, aber meistens bilde ich sehr lange Reihen voller Konsonanten. Ich höre nicht auf sie, weil ich ihre Reaktion mag, wenn das Resultat unaussprechbar ist.
ASDFGHJKL
Sie lacht von Herzen, schüttelt den Kopf und sagt:
«Nein, mein Kind, doch nicht so.»
Also mische ich die Buchstaben wieder und fange von vorne an: Konsonant, Vokal, Konsonant, Vokal.
MAMA
Aus «La chiave nel latte»
Als Kind übersetzte ich das Deutsche, das ich zuerst im Kindergarten und dann in der Schule lernte, ins Französische oder Italienische, meine Mutter- und Vatersprache. Jetzt ist es genau umgekehrt: Ich übersetze Alexandre Hmines Roman «La chiave nel latte» vom Italienischen ins Deutsche.
Auch der Protagonist in Hmines autobiografischem Roman wächst in mehrsprachigen Welten auf: Da ist die dörfliche Welt des Alto Malcantone mit ihrem Tessiner Dialekt, wo das Kind zunächst bei einer alten Witwe namens Elvezia aufwächst. Seine Mutter, die siebzehnjährig und hochschwanger aus Marokko in die Schweiz geflüchtet ist, kann sich nicht um ihn kümmern. Als der Junge später als Teenager zu ihr nach Lugano zieht, spricht er Italienisch mit ihr, denn Arabisch hat die Mutter ihm nicht beigebracht. Der Identitätskonflikt des heranwachsenden Protagonisten spiegelt sich im Wandel des Verhältnisses zu seinen Sprachen: Der Dialekt seiner Kindheit weicht dem Italienischen; dem Arabischen, das er in der Kindheit zu lernen sich weigerte, nähert er sich nun als Erwachsener an. Doch zu all diesen Sprachen bleibt sein Verhältnis ambivalent, von Fremd- und Vertrautheitsgefühlen gleichermassen geprägt.
Auch mein Verhältnis zu den Sprachen hat sich verändert: Während das Deutsche langsam die Oberhand gewann, verspürte ich in bezug auf das Französische und Italienische trotz der emotionalen Verbundenheit eine gewisse Unzulänglichkeit, sobald die Kommunikation über das Alltägliche hinausging. So wuchs das Bedürfnis, mich vertiefter mit meinen Muttersprachen auseinanderzusetzen. Mit dem Master in Literarischem Übersetzen in Lausanne wurde diese Auseinandersetzung zur Profession – und «La chiave nel latte» zu meinem ersten grossen Projekt.
Im Austausch mit meiner Mentorin Barbara Sauser lernte ich schnell, dass sich Fragen zur Sprache – und davon gibt es viele – schnell zu mehrstündigen Gesprächen entwickeln können, selbst wenn es nur um eine einzelne Textstelle geht. Es ist, als würde das Übersetzen den Sprachen den Spiegel vorhalten – oder eher: eine spiegellabyrinthartige Konfrontation zwischen ihnen auslösen, in der eine Überlegung zur nächsten führt und so die Vielschichtigkeit des Sprachlichen offenbart.
Letztendlich spiegelt unsere Beziehung zu den Sprachen immer auch diejenige zu den Menschen, die wir mit ihnen verbinden. Und so erscheint es nahezu unvermeidlich, dass in Hmines Roman die Beziehung zwischen Mutter und Sohn bis zuletzt konfliktgeladen bleibt: Das Arabische, die Sprache der Mutter, ist nicht die Muttersprache des Protagonisten; eine wirklich gemeinsame Sprache haben die beiden nicht. Als sich der Protagonist am Ende des Romans auf den Friedhof begibt, um Elvezia sein soeben erschienenes Buch zu widmen, mutet es wie das Ende einer langen inneren Auseinandersetzung an: In diesem intimen Moment findet der Protagonist zur Sprache seiner Kindheit, dem Tessiner Dialekt, zurück – und schliesst Frieden mit seiner Vergangenheit.