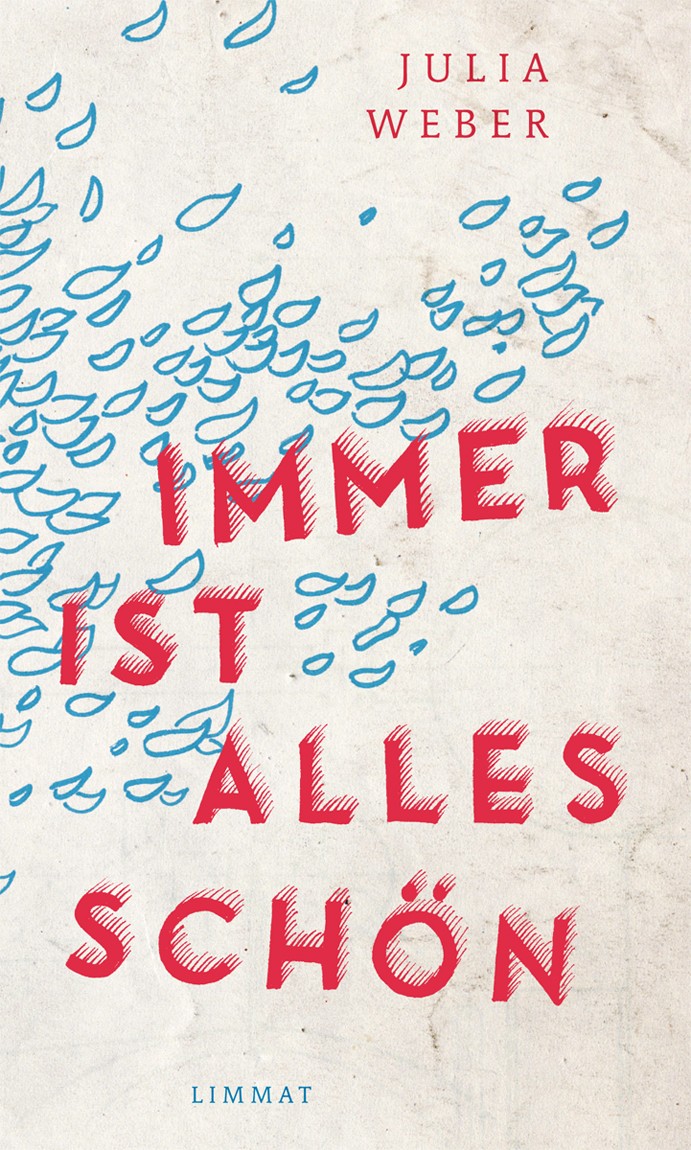
Julia Weber:
«Immer ist alles schön»
Nein, in dieser Welt ist eben nicht alles schön. Es ist grauer Alltag in Rohform, aber schwarz auf weiss – ohne tupfernde Idealisierungen in Form handelsüblicher Floskeln. Die elfjährige Anais beschreibt ihn durch die Brillengläser ihrer kindlichen Naivität: sie lebt zusammen mit ihrer Mutter und ihrem jüngeren Bruder Bruno. Das klebrige Treppenhaus vor der Tür mag sie nicht besonders, es riecht nach alten Sachen, nach ranzigem Öl oder Resten von Spaghetti. Doch in der Wohnung riecht es gut und ist es hell. Tagsüber widmen sich Anais und Bruno der Schule und die Mutter ihrem Wein. Manchmal steht die Mutter nackt im Flur. Manchmal kommen Männer zu Besuch. Und mit ihnen das Fremde.
Während Anais das alles erzählt, bleibt es dem Leser überlassen, das Ausmass der Tristesse dieser Realität zu bemerken: Die Mutter versucht ihre Überforderung im Suff zu ertränken, dabei lässt ihr innerlicher Schrei nach Unbeschwertheit alles um sie herum in ein dumpfes Nebelmeer verschwinden. «Was bist du nur für eine Mutter?», würden wir mit vorwurfsvollem Ton fragen wollen. Das sagt sie uns dann aber selbst, in ihrer eigenen Erzählung. Maria, wie sie heisst, erzählt von ihren Träumen und von den Herausforderungen, mit denen das Leben sie konfrontierte. Sie erzählt von der gescheiterten Beziehung mit Anais‘ Vater, der sie zu etwas machen wollte, das sie nicht ist. Vom schwierigen Verhältnis zu ihrer Mutter, die nichts als Vorwürfe übrig hatte. Sie erzählt von ihren Freundinnen, die sie früher hatte, bis die Begegnungen immer weniger wurden, immer weniger Wahrheit hatten. Sie erzählt, wie sie Architektur studieren und hohe, gläserne Häuser bauen wollte. Davon, wie schwierig es war, eine junge, alleinerziehende Mutter zu sein. Sie beschreibt ein Leben, das ihren eigenen Sehnsüchten nicht gerecht wurde, nicht gerecht werden konnte.
So changieren wir zwischen Anais‘ Welt und derjenigen der Mutter. Zwischen Mitgefühl für Anais und Bruno – die vom Leben keine faire Chance bekommen – und Mitgefühl für die Mutter, die hoffnungslos ihren Träumen nachrennt, ohne Aussicht, sie einfangen zu können. Anais’ Erzählung nimmt uns mit. Mit kindlichen Metaphern umschreibt sie ihren kargen Alltag: die schwankende Mutter mit zu viel Wind in der Krone, die fremden Männer mit selbstgemalten Bildern auf den Armen. Das Schicksal, das Anais durch ihre Unschuld nicht zu realisieren vermag, trifft uns wie ein Schlag und lässt Wut wachsen. Doch bevor wir uns so richtig in Missachtung suhlen können, werden wir gezwungen, uns die Seite der Mutter anzuhören. Und plötzlich können wir uns mehr mit Maria identifizieren, als uns lieb ist. Wir erkennen die gescheiterten Freundschaften und Beziehungen, die alltäglichen Probleme, die immer grösser werden, die vielen «falschen» Entscheidungen.
Ein Roman also über das Träumen und das Scheitern. Über das Leben und wie es uns zwingt, unsere kindliche Phantasie hinter uns zu lassen und uns in das klebrige Treppenhaus, in die fremde Welt ausserhalb der hellen Wohnung zu begeben. Und schliesslich befinden wir uns dort, wo unsere Träume unerreichbar werden – wo das Schöne plötzlich nicht mehr so schön ist. Und hier bleibt dann doch nur noch die Medikation durch Floskeln wie diese: «Immer ist alles schön.»
Julia Weber: Immer ist alles schön. Zürich: Limmat, 2017.











