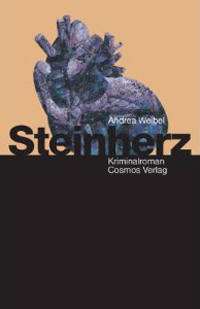…um der reinen Unterhaltung willen…
Scheinwelten, Ironie und jede Menge Krieg: das Werk Christian Krachts wimmelt nur so von falschen Fährten, kaum sichtbaren Stolperfallen und Lockrufen interpretatorischer Abgründe. Warum es sich dennoch lohnt, die Lektüre zu wagen.

Das Ausklingen des 20. Jahrhunderts begleitete Christian Kracht 1999 mit zwei Publikationen. In Berlin erschien im Ullstein-Verlag die Aufzeichnung eines längeren, womöglich so nie geführten Gesprächs zwischen Joachim Bessing, Eckhart Nickel, Alexander von Schönburg, Benjamin von Stuckrad-Barre und Christian Kracht. Tristesse Royale war der Titel des Bandes, königliche Traurigkeit. Darin antwortete Kracht auf Alexander von Schönburgs Feststellung «Also ist Politik Scheinwelt. Mode ist Scheinwelt» sowie auf dessen Suche nach einer Lösung des Problems: «Es gibt noch einen anderen Ausweg, und das ist wiederum der Krieg.»
Im gleichen Jahr verlegte die Stuttgarter Deutsche Verlags-Anstalt einen von Kracht herausgegebenen Sammelband mit Erzählungen: Mesopotamia. Ernste Geschichten am Ende des Jahrtausends. Auf dem Buchrücken prangte ein seither vieldiskutiertes Zitat von Jarvis Cocker: «Irony is over. Bye Bye.»
In einem der wenigen Interviews, die Kracht gegeben hat, bat ihn im Juni 2000 der Tagesspiegel um eine Erläuterung seiner Replik auf Schönburgs Klage in Tristesse Royale: «Ich muss wohl eine Art Auslöschung gemeint haben, die Ausrufung eines Ausnahmezustandes: Zusammengekauerte Gestalten sitzen nackt am Strassenrand und ritzen sich beschämt mit Tonscherben die Arme auf, andere Menschen stolpern durch Städte auf der Suche nach Salz, das Kilo Rindfleisch kostet bei Spar in Berlin-Mitte 600 Mark.» Irony is over.
Ironie bezeichnet als literarisches Verfahren im grundlegendsten Sinn eine Redeweise, wonach das Gegenteil des eigentlichen Wortsinns gemeint ist. Sie drückt Distanz aus – und einen Standpunkt besseren Wissens. Gegenüber der erzählten Welt und den in ihr gefangenen Figuren signalisiert sie neben einem quantitativen einen qualitativen Wissensvorsprung, über die eigentlich relevanten Einsichten zu verfügen, und sei es nur jene von der Sinnleere der Welt, der manch Zeitgenosse ins Gesicht zu schauen sich nicht recht traut. Leser, die etwa Thomas Mann nicht schätzen, finden mitunter gerade dies besonders störend. Ein berühmtes Beispiel: «Ein einfacher junger Mensch reiste im Hochsommer von Hamburg, seiner Vaterstadt, nach Davos-Platz im Graubündischen. Er fuhr auf Besuch für drei Wochen. Von Hamburg bis dort hinauf, das ist aber eine weite Reise; zu weit eigentlich im Verhältnis zu einem so kurzen Aufenthalt.»
Auf einer ähnlichen Route wie Hans Castorp im Zauberberg reist auch der Erzähler in Christian Krachts erstem Roman Faserland (1995): nicht exakt von Hamburg nach Davos-Platz, aber doch ähnlich genug von Sylt nach Zürich. Als er nach sieben von acht Kapiteln in der Schweiz ankommt, liegt eine unerquickliche Odyssee hinter ihm: Auf Partys und in Clubs in Hamburg, Frankfurt, Heidelberg oder München rauchend und trinkend durch eine Welt von Drogenrausch und Sex irrend, sind alle Bemühungen um Nähe und Kontakt zu Freunden und Bekannten gescheitert. In der Schweiz jedoch hellt sich die Stimmung umgehend auf: «Zürich ist schön. Hier gab es nie einen Krieg […]. Die Bäume sind schön und manchmal rauschen sie, und das Bier, das schmeckt ganz anders.» Und wenig später: «Ich denke daran, dass die Schweiz ein so grosses Nivellierland ist, ein Teil Deutschlands, in dem alles nicht so schlimm ist. Vielleicht sollte ich hier wohnen, denke ich. Die Menschen sind auch auf eine ganz bestimmte Art attraktiver. Die Frauen haben so komische Himmelfahrtsnasen, und sie tragen alle Kleidung, die japanisch aussieht. Alles erscheint mir hier ehrlicher und klarer und vor allem offensichtlicher. Vielleicht ist die Schweiz ja eine Lösung für alles.»
Die Schweiz als Utopie aber scheitert. Faserland endet, wie Thomas Manns Zauberberg, mit dem wahrscheinlichen Tod des Protagonisten. Der Abschied von Hans Castorp gleicht dabei im Ton seiner Begrüssung: «Fahr wohl – du lebest nun oder bleibest! Deine Aussichten sind schlecht; das arge Tanzvergnügen, worein du gerissen bist, dauert noch manches Sündenjährchen, und wir möchten nicht hoch wetten, dass du davonkommst.» Manns ironisch-distanzierter Erzähler entledigt sich seines Protagonisten, nur er selbst bleibt zurück. Kracht wählt einen anderen Weg: Sein Erzähler sucht vergeblich nachts auf dem Kilchberger Friedhof das Grab von Thomas Mann. Schliesslich beobachtet er einen Hund, und es scheint, als erleichtere sich der just auf Manns Grab. Dann geht es hinab zum See, er mietet ein Boot, «ob er mich auf die andere Seite des Sees rudern würde». Der Leser bleibt beim Erzähler, mit ihm steigt er ins Boot: «Bald sind wir in der Mitte des Sees. Schon bald.» Finis. Keine Distanz.
Der Krieg
2008 erscheint Christian Krachts dritter Roman Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten. Er spielt im Jahr 2010, dem 96. Jahr des Weltkrieges, der 1914 mit der Ermordung des österreichischen Thronfolgers seinen Ausgang nahm. Der Roman entwirft eine Alternativgeschichte des 20. Jahrhunderts, in der eine Schweizer Sowjetrepublik als politische Grossmacht agiert – ein Entwurf, der für einmal Charles-Ferdinand Ramuz’ Beobachtung von der geringen politischen Bedeutung der Schweiz im Essay Besoin de grandeur umkehrt. Und doch bleibt alles allzu vertraut: der Rassismus, der Kolonialismus, die Bomben, der Antisemitismus, die Gewalt im Namen der Ideologie, der ewige Krieg, angebliche Wunderwaffen, die Vergeblichkeit der Weltverbesserung.
Eine Vielzahl literarischer Texte wurde als direkt oder indirekt zitierte Quelle für die im Roman entworfene Welt ausgemacht, darunter Joseph Conrads Heart of Darkness (1902). Der Bezug liegt auf der Hand, doch Kracht variiert Wesentliches: Wie bei Conrad erweist sich in Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten der Auftrag, einen zwischen Genialität und Wahnsinn schwankenden Vertreter der Staatsmacht zu verhaften, als zentraler Auslöser der Handlung. Das Herz der Finsternis aber liegt bei Conrad im Zentrum Afrikas, im Kongo. Kracht kehrt die Bewegung um und schickt einen afrikanischen Parteikommissär aus Afrika in die Schweiz, erst nach «Neu-Bern», dann ins Réduit, das Zentrum der Macht, das in die Alpen gebaute Stollenwerk als Symbol Schweizer Wehrhaftigkeit.
Deutsche Zeppeline bombardieren schliesslich die Alpenfestung, Europa scheint dem Untergang geweiht. Am Ende verlässt der Erzähler Europa und kehrt in die Savanne Afrikas zurück, dorthin, von wo einst die Eroberung der Welt durch den Menschen begann. Und er ist nicht allein: «Ganze Städte wurden indes über Nacht verlassen, und ihre afrikanischen Einwohner kehrten, einer stillen Völkerwanderung gleich, zurück in die Dörfer. Der Schweizer Architekt, der sie so sorgfältig am Reissbrett geplant und hatte erbauen lassen, reiste mit dem Luftschiff in die leeren urbanen Zentren Ostafrikas.» Und weiter: «Der Architekt, ein Welschschweizer mit Namen Jeanneret, stand machtlos und stumm im leeren Administrationsgebäude […] und […], nachdem er eine ganze Nacht alleine durch seine dunkle und menschenleere Schweiz gelaufen war, warf frühmorgens das Ende eines Seiles über eine von ihm selbst entworfene, stählerne Strassenlaterne und erhängte sich […]. Er hing ein paar Tage, dann assen Hyänen seine Füsse.» Abtritt Le Corbusier und die Moderne. Irony is over.
Die Schweiz
Die Schweiz ist nicht nur in Christian Krachts literarischem Werk breit präsent – in Faserland, Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten, in Tristesse Royale und in New Wave; die Kronenhalle und das Café Odeon besichtigen Kracht und Eckhart Nickel in Ferien für immer. Die angenehmsten Orte der Welt. 2008 ist Kracht Gründungsmitglied und Stiftungsrat der Zürcher Eiger-Stiftung, mit David Woodard präsentiert er Woodards «Dreamachine» im Cabaret Voltaire in Zürich. Es ist konsequent, dass Kracht 2012 die Dozentur für Weltliteratur an der Universität Köln zugesprochen wurde ebenso wie der Literaturpreis des Kantons Bern.
Und Krachts Verhältnis zur Schweiz? Die Schweizer Literaturwissenschafter Franka Marquardt und Patrick Bühler haben gezeigt1, dass das verklärende Bild, das sich der Erzähler in Faserland von der Schweiz als Nivellierland bzw. als idyllisches Refugium für Deutsche entwirft, ein traditioneller Topos der Schweizwahrnehmung aus deutscher Sicht ist – ein Klischee also, keine Utopie, kein «Zion, the kingdom of Jah, the Mothership, die Arche eben», wie Kracht in New Wave im Gespräch Die Schweiz mit Joachim Bessing sein Vaterland bezeichnet.
Der Protagonist in Faserland bekennt, als er von seinen Schullektüren berichtet: «Thomas Mann habe ich auch in der Schule lesen müssen, aber seine Bücher haben mir Spass gemacht. […] Diese Bücher waren nicht so dämlich wie die von Frisch oder Hesse oder Dürrenmatt.» Es ist natürlich kein Zufall, dass der Schweizer Kracht diese Trias der Schweizer Literatur zum Vergleich heranzieht. Während Kracht sich allgemein zu Dürrenmatt zurückhaltend äussert und ihn mit Hermann Hesse eine Hassliebe verbindet, betont er gegenüber Frisch Distanz: «Ich habe Max Frisch ja leider nie gelesen» oder «Frisch ist mir leider völlig fremd geblieben». Eine Provokation? Wohl kaum. Eher dürfte, so muss es scheinen, die Idee, die Schweiz literarisch in eine kolonialisierende Sowjetrepublik zu verwandeln, Befremdungspotential bergen. Schliesslich wird Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten auf dem Buchrücken als «Der grosse Schweiz-Roman!» angekündigt. Doch das Réduit ist hohl, und auch wenn der Vierwaldstättersee erwähnt wird, ein Gründungsmythos wird nicht neu erzählt. Im Gegenteil: die SSR geht unter. Finis.
Die Unterhaltung
Christian Krachts Bücher stecken voller Verweise auf die Weltliteratur, auf Comics, Filme, Romane, Künstler, Philosophen, Gedichte, Songs. Für Germanisten könnten sie eine Lebensversicherung sein – wieder und wieder lassen sich neue Spuren entdecken, ausschreiten, vermessen und nach ihrer Bedeutung befragen. Der ungehemmten Recherchierlust aber steht dreierlei entgegen: Zum einen verrät Kracht gerne, meist direkt mit der Publikation, jene Texte, die Spuren hinterlassen haben. Zweitens lässt Kracht nicht nach zu betonen, dass er vor allem eines sein will: ein Unterhaltungsschriftsteller. Drittens schliesslich sind alle Romane Krachts, besonders der gerade erschienene, in der Südsee spielende, Imperium, wirklich ausgesprochen unterhaltsam, ja mitunter regelrecht lustig.
Vielleicht also hat Kracht recht. Vielleicht ist er wirklich vor allem ein Unterhaltungsschriftsteller. Nur, was für einer dann genau? Eines ist gewiss: Kracht ist einer der literarisch avanciertesten Erzähler deutscher Sprache, spätestens seit Imperium, einem aus Stilimitaten und Handlungszitaten aus den verschiedensten Quellen des 20. Jahrhunderts komponierten Pastiche und zugleich einer urkomischen Parabel auf den notwendigen Untergang aller Utopien und Imperien. Die in Imperium auftretende Ironie ist eine auf dem Weg der Stilimitate geborgte, die sich nicht gegen den Protagonisten August Engelhardt selbst richtet, sondern gegen die literarische Tradition. Anders als Thomas Mann hat Kracht bisher keine seiner Figuren verraten oder im Stich gelassen. So komisch seine Romane sind, sie sind dabei zugleich zutiefst ernst. Krachts Texte sind Literatur und Parodie auf die Literatur zugleich, sie sind Abgesang auf die Welt und Simulation eines Abgesangs, sie sind Text und Pose im gleichen Atemzug. Und wozu das alles?
In dem bereits zitierten, im Juni 2000 im Tagesspiegel publizierten Interview (das womöglich Kracht mit sich selbst geführt hat) findet sich eine Antwort: «Verstehen wir Sie richtig? Über Inhalte reden muss allein deshalb schiefgehen, weil schon so oft darüber geredet worden ist? – Ja, absolut. Das Sprechen über Inhalte ist zum Scheitern verurteilt. Man produziert immer nur Missverständnisse. – Führt dieser Blick auf das Leben nicht zwangsläufig in die Depression? – Nein, denn das Sprechen um der reinen Unterhaltung willen ist ja noch möglich: Vortäuschen, verstecken, Unsinn erzählen, das sind alles Mechanismen, die noch gut funktionieren.»
Der Freund
Vom Herbst 2004 bis zum Sommer 2006 erschien beim Axel-Springer-Verlag eines der ungewöhnlichsten Zeitschriftenprojekte der letzten Jahre. Von Beginn an auf acht Hefte begrenzt, zeichneten Eckhart Nickel und Christian Kracht als Herausgeber verantwortlich für die Literaturzeitschrift Der Freund. Sitz der Redaktion: Kathmandu in Nepal. Verkaufspreis: 10 Euro. Das Format war ungewöhnlich – gross und fast quadratisch –, das Papier angenehm dick und cremeweiss, der Satz grosszügig und abwechslungsreich (ein-, zwei- oder dreispaltig). Zeichnungen und Abbildungen ergänzten in grosser Zahl die abgedruckten Reportagen, Erzählungen, Essays. Das Themenspektrum war ungewöhnlich weit, das erste Heft etwa vereinte so unterschiedliche Beiträger wie Rem Koolhaas, Moritz von Uslar, Albert Ostermaier, Rebecca Casati, Rafael Horzon, Vladimir Sorokin oder Jenny Erpenbeck. Sorokin präsentierte «Rezepte» für ein Bankett, für einen «Salat aus Neujahrsfotografien», für «Damenhandschuhe in Aspik», «Filzhutschinken» oder einen «Fahrradsattel im Pelz». Von Erpenbeck erschien hingegen die Erzählung Vater Mutter Kind, von Ostermaier das Gedicht Panik, Rem Koolhaas steuerte den Essay Junkspace. Eine ellenlange Analyse im übelriechenden Raum der Unzumutbarkeit bei.
Wer die Hefte genau in den Blick nahm, für den hielten sie zudem kleine Geschenke bereit: Stets fand sich auf dem Heftrücken ein kurzes Motto – ein Filmtitel oder eine Songzeile –, ein zweites zierte die Innenseite des Rückumschlages, zudem enthielt jede Ausgabe eine Widmung (Dan Treacy, Christopher Reeve, Dave Eggers, Anne Frank, Benedikt XVI., Stanley Kubrick, Edie Bouvier Beale, David Lynch). Artikel wurden mit einer knappen Übersicht der nachfolgend diskutierten Themen eingeleitet. Im Kopf der Leser entstanden so Listen, die der Germanist Moritz Bassler als rhetorische Listen bezeichnet hat: Ihr Reiz liegt gerade darin, dass sie nicht Unterbegriffe zu einem Oberbegriff vereinen, sondern dazu auffordern, subtile Zusammenhänge erst zu entdecken oder zu konstruieren und die Verrätselung, die durch die nach Deutung rufenden Listen entsteht, als Form der ästhetischen Verdichtung zu geniessen, die wie in einem Gedicht neue Zusammenhänge erst erzeugt.
Wer das Glück hat, alle acht Hefte des Freunds zu besitzen, wird sie nicht wieder hergeben wollen. Wer zudem ein regelmässiger Leser Krachts ist, der wird wissen, dass er auch mit dem Freund einen klassischen Kracht erworben hat: Der Freund ist eine Literaturzeitschrift, und er ist keine. Sein Design beeindruckt und ist doch, ohne jeden Versuch des Verbergens, entlang von Dave Eggers The Believer entwickelt. Einige Beiträge sind unter falschem Namen geschrieben, andere sind von ihren Verfassern in jeder Hinsicht ernst gemeint. Das Verweissystem der Hefte erzeugt poetische Verdichtung und verweist doch auf nichts.
Vielleicht lautet die Grundannahme der Arbeiten von Christian Kracht in der Tat, dass das Sprechen über Inhalte scheitern muss und dass nur noch «Vortäuschen, verstecken, Unsinn erzählen» als Optionen bleiben. Wenn man weiter die Rede vom Ende der Ironie einmal ernst nimmt, also den Verzicht auf einen überlegenen Standpunkt, dann entsteht eine ganz eigene und ganz zeitgemässe Literatur: Sie erzählt mit aller Radikalität vom Ende der Illusionen, sie stellt sich in keine Distanz zu dieser traurigen Bilanz, sie weiss keinen Ausweg – ausser dem des ästhetischen und intellektuellen Vergnügens des Vortäuschens, des kunstvollen und offengelegten Fälschens, der lustvollen Übertreibung, des Unsinns, des Vergnügtseins inmitten des Abgrunds. Auf die Schweiz darf man neidisch sein, dass ein Autor, der das beherrscht, ihren Pass besitzt.
1 Christian Kracht. Zu Leben und Werk. Hg. v. Johannes Birgfeld & Claude D. Conter. Köln: Kiepenheuer & Witsch 2009.