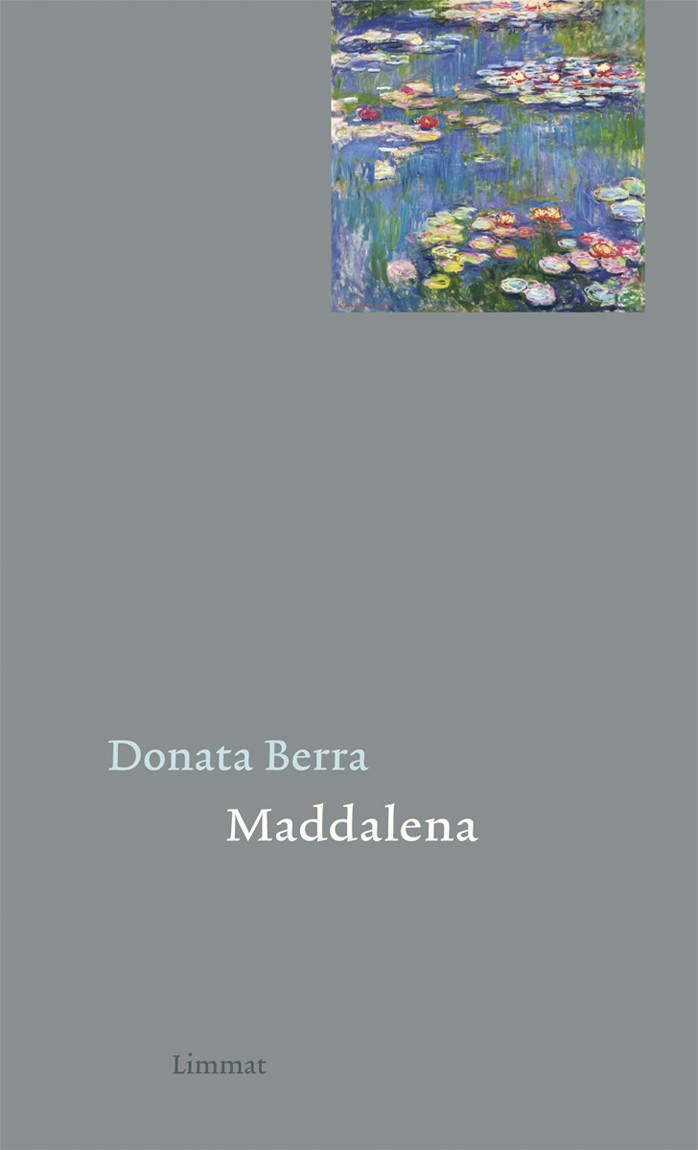Wie ich mal fast Popmusiker
geworden wäre und dabei
vorübergehend verarmte
Die folgenden Aufzeichnungen sind ausnahmslos wahr.

Als Usama bin Ladin im September 2001 seine vollbetankten Flugzeuge in die Wachtürme der freien Welt rauschen liess, da hatte die Musiktauschbörse Napster ihre besten Tage schon hinter sich und lag, seit gut einem halben Jahr verklagt und zerschlagen, am Boden. Es war der letzte grosse Sieg der Musikindustrie gegen die digitale Bedrohung, und doch wussten alle in der Branche spätestens mit diesem aussergewöhnlichen Tag, dass nichts mehr so bleiben konnte, wie es mal war, und dass auch ihre Geschäftsgrundlage künftig ins Wanken geraten würde. Es war die Zeit, fast auf den Tag genau, in der ich die
Zeichen der Zeit erkannte und ohne Not entschied, mein Lebensglück in der Musik zu suchen.
Die Startbedingungen waren schlecht. Nicht nur wegen der allgemein angespannten Lage, sondern weil Musik mich eigentlich nie interessiert hatte. Es war vor allem, wie noch so häufig im Fortgang meines Lebens, der mich verzehrende, heiss wie Phosphor brennende Neid auf den Erfolg anderer, der mich immer wieder zu den aussichtslosesten Ambitionen verführte. So hatten in diesem Fall Freunde von mir ein Jahr zuvor mit ihrer Band, zu der ich mangels Talents nicht eingeladen wurde, einen Plattenvertrag unterschrieben und waren mit einem Male professionelle Musiker. Vor Wut kochend, musste ich ihrem kometenhaften Aufstieg tatenlos zusehen.
Ihr sehr junger damaliger Label-Boss, ein anstrengend-aufdringlicher, schamloser Prolet, den ich vom ersten Moment an bewunderte, liess die Band zwar bereits nach einer gefloppten Single wieder fallen, avancierte dafür aber im Fortgang zu einem der erfolgreichsten und bis heute gefürchtetsten Entscheider im deutschsprachigen Popbetrieb. Meiner Menschenkenntnis vertrauend nahm ich ihn zum Vorbild und heuerte im Spätsommer 2001 bei einer Musik-Promotion-Agentur an, die in guten Zeiten ihr Geld damit verdient hatte, schlampig hergestellte Promo-CDs schubkarrenweise an ungewaschene Provinz-DJs zu verschicken, und manchmal wurde aus dem ein oder anderen Song auch tatsächlich ein Hit, bevor man ihn wieder vergass.
Ich meine mich zu erinnern, dass das Wehklagen über die gerade ja erst Anlauf nehmende Krise schon sehr weit fortgeschritten war und dass dieses nervöse Jammern über einbrechende Verkäufe tatsächlich für ganze vierundzwanzig Stunden verstummte, als an jenem Tag im September in den Büros der Kollegen plötzlich die Röhrenfernseher eingeschaltet wurden und alle in Agonie verfielen. Die Welt mochte an diesem Tag zusammenstürzen: für mich waren die Ereignisse Zeichen des Aufbruchs. Bester Dinge und ziemlich sicher, in dieser Branche noch zu reüssieren, stopfte ich mit einem Pfeifen auf den Lippen einfach weiter CDs in Versandtaschen. Mit Aufsteigergeschichten immerhin kannte ich mich aus, hatte ich sie doch schon in früher Kindheit und auf Druck der Eltern bei Flaubert und Maupassant, vor allem bei Maupassant (!), nachlesen müssen, bei Dostojewski, Zola und bei Stendhal – endlich also würde sich die Lektüre auszahlen, man musste sie nur als Anleitung zur mutigen Tat lesen, und nun also wollte ich es fortan so trickreich und listig angehen wie Maupassants ehrenvoller Held Georges Duroy. Ich war sicher, dass man alles erreichen konnte, wenn man nur entschieden genug daran arbeitete, es so aussehen zu lassen, als meine man es ernst. Irgendwann, das war ein Naturgesetz, kämen die Dinge schon ins Rollen.
Und das kamen sie, viel schneller und doch ganz anders, als ich es vermutet hatte. Mit meinem besten Freund, einem Produzenten, der gerade erst – wir erinnern uns – seinen Plattenvertrag und damit auch all seine Hoffnung verloren hatte, nahm ich im Spätherbst einen Song auf, den wir genauso schnell und fahrig arrangierten, wie wir ihn uns ausgedacht hatten. Es war das erste Mal, dass ich «Musik» machte, und doch ist es vier Studioalben, siebzig Songs und fünfhundert gespielte Konzerte später noch immer das visionärste Stück Musik, das mir je zugefallen ist – nicht umsonst tauften wir den Song «Neuzeit» und das soeben neu erfundene Genre «Neopop».
Da ich mich, wie eingangs ja erwähnt, tatsächlich nie für Musik interessiert hatte, war mir verborgen geblieben, dass es ziemlich genau die Musik, wie sie uns doch gerade eben erst wie von Zauberhand in den Sinn gekommen war, bereits gegeben hatte, nämlich im Deutschland der frühen 80er Jahre, als von Düsseldorf aus die erste Neue Deutsche Welle, der deutsche Kassettenuntergrund, losgetreten wurde. Gruppen wie Palais Schaumburg, Der Plan, DAF oder Fehlfarben hatten all das eigentlich fast schon genauso gut gemacht wie wir, aber da ich davon keine Ahnung hatte, gab es nichts, das meine Selbsteinschätzung als musikalisches Wunderkind hätte negativ beeinflussen können. Erst viele Jahre später, als ich bei einer von der Kulturstiftung des Bundes und dem Auswärtigen Amt arrangierten Podiumsdiskussion in Kinshasa, Demokratische Republik Kongo, grossspurig aus meinem Lebenswerk zitierte, brachte mich ein kompetenter Zwischenruf derart aus der Fassung, dass ich noch im Hotel die musikhistorische Recherche anleierte und im Anschluss bis zum heutigen Tage wieder einstellte.
Mein Freund und ich, wir hatten uns damals vorgenommen, Musik zu machen, so unhörbar, neu und erschütternd, dass niemand etwas mit ihr würde anfangen können. Doch auch da irrten wir: Nur ein paar Wochen nachdem wir «Neuzeit» aufgenommen hatten, klingelte zur späten Nachmittagsstunde, als ich gerade dabei war, das Feuer zu schüren und meine Abendgarderobe anzulegen, das Haustelefon.
Herausgerissen aus Tagträumereien, die ich mir um diese Uhrzeit sonst nicht erlaube, meldete sich am Apparat zu meiner Überraschung der berühmteste Musikproduzent Deutschlands. Er gab an, auf Irrwegen in den Besitz unseres Songs gekommen zu sein, und während wir so plauderten und er mir wieder und wieder zu erklären versuchte, wie aussergewöhnlich unser Song geraten sei, stellte ich mir bereits die Frage, was ich mit all dem Geld wohl anfangen würde. Im Rausch der Ereignisse kündigte ich meinen Job, doch bereits wenige Stunden später schlich sich ein mulmiges Gefühl bei mir ein, würde doch der mit allen Wassern gewaschene Produzent sicher schnell herausgefunden haben, dass er es bei mir mit einem Scharlatan par excellence zu tun hatte. Statt weitere Songs zu schreiben, wie mir aufgetragen war, zerbrach ich mir wochenlang den Kopf darüber, wie ich es würde anstellen können, ihn über mein fehlendes Talent so lange im Unklaren zu lassen, bis die Millionen und Abermillionen auf meinem Konto angekommen waren.
Nach fast drei Monaten, in denen ich einer Lösung dieses Problems kein Stück nähergekommen war, rief der Produzent abermals an und forderte uns auf, nun endlich zu ihm nach Hamburg zu kommen, um dort im Studio die «tollen neuen Songs» aufzunehmen. Mir stockte der Atem, jetzt musste tatsächlich etwas geschehen, und zwei Tage bevor wir aufbrachen, stiegen wir noch einmal mit zittrigen Gliedern in den fensterlosen Musizierraum im Keller eines im Ruhrgebiet sehr einflussreichen Zahntechniklabors hinab.
Noch einmal erfasste uns eine Welle der Genialität, und nur wenige Minuten vor Abfahrt kamen wir mit drei fertigen neuen Liedern zurück ans Tageslicht, von denen das eine – «Lass mich durch, ich muss nach Cairo» – den arabischen Frühling vorwegnahm, zehn Jahre bevor sich die Hoffnung auf dem Tahrir-Platz im Angesicht der Welt ihren holprigen Weg bahnen sollte. Obwohl ich sicher sein konnte, hier abermals Musik von aussergewöhnlicher Qualität erschaffen zu haben, musste ich doch weiterhin damit rechnen, in Hamburg als Hochstapler entlarvt zu werden: Denn nur unter Zuhilfenahme sämtlicher technischer Tricksereien und Täuschungsmanöver war es uns überhaupt gelungen, meinen Gesang in halbwegs akzeptable Form zu pressen, und so bestand meine allergrösste Sorge darin, vor den Augen und Ohren des Produzenten in die Verlegenheit zu geraten, die Gesangsspuren noch einmal stümperhaft einsingen zu müssen.
Entgegen jeder Wahrscheinlichkeit aber hatten wir ein halbes Jahr später drei fertige Songs und einen unterschriftsreifen Abtretungsvertrag eben jener Plattenfirma auf dem Tisch, nach der ich mich vor gar nicht allzu langer Zeit doch so über die Massen verzehrt hatte. Erneut hatte mich das Glück also mit offenen Armen empfangen. Ohne hineinzusehen, unterschrieben wir das Dokument, und für meinen prompt überwiesenen Vorschuss in Höhe von 3200 Euro kaufte ich (fast) zweihundert Telekom-Aktien zum Preis von je 16,52 Euro – heute weiss ich weder, wo die Aktien geblieben sind, noch wofür genau wir das Geld damals eigentlich erhalten haben.
In den folgenden fünf bis zehn Jahren geschah dann nicht mehr viel. Die meiste Zeit über sass ich entspannt im Ohrensessel meiner Grossmutter, den ich am liebsten vor dem hohen Fenster zum Garten hinaus positionierte, rieb mir dann und wann die Hände und wartete auf den nächsten Anruf, der Grosses ankündigen würde. Es war nur eine Frage der Zeit, bis meine Songs und Texte, zu denen sich über die Jahre noch ein paar mehr gesellt hatten, weiteren wichtigen Leuten und «Entscheidern» zu Bewusstsein kämen – ich musste also nur sitzen und warten, darauf, dass die Schecks nach und nach eintrudeln würden.
Es muss im Januar 2008 gewesen sein, da begannen an einem nasskalten Regentag die Zweifel. Aufgeregt, aber die Sorgen herunterspielend, rief ich meinen Freund an, von dem ich lang nichts mehr gehört hatte – und wir entschieden, gleich jetzt und auf seine Kosten ein Album herauszubringen. Glücklicherweise hatte er seinen Vorschuss nicht in Aktien investiert, sondern in einem Strumpf unter der Matratze aufbewahrt. Nun konnten wir das Geld gut gebrauchen, und noch im selben Jahr erschien unsere erste gemeinsame Platte, die wir, da wir es nicht besser wussten, «Deutsche Renaissance – Ein Kanon» nannten.
Die Reaktion der Öffentlichkeit liess sehr zu wünschen übrig. Unser grösster Erfolg bestand darin, dass ich den Schriftsteller Christian Kracht, der damals in Buenos Aires lebte, bei einer Lesung in Düsseldorf traf, er mir freundlicherweise seine Adresse gab und ich ihm zwei Exemplare meines Albums an den Rio de la Plata schickte. Zwar hörte ich in der Folge nie wieder von ihm, doch fühlte ich mich jetzt endgültig als vollwertiges Mitglied der deutschsprachigen Künstlerszene – ja ich stellte mir sogar vor, wie er, der grosse Schriftsteller, mein Idol, all seinen Künstlerfreunden auf der ganzen Welt nur von meiner Musik erzählen und ihnen die besten Textzeilen aus dem Kopf rezitieren würde, während sie vor Lachen aus dem Prusten gar nicht mehr herauskämen.
Vier weitere Jahre vergingen, ohne dass sich irgendetwas tat. Nun, da ich als Künstler nicht länger in der Lage war, einen normalen Beruf auszuüben, und die digitale Tontechnik weitere Fortschritte gemacht hatte, mussten mein Freund und ich damit beginnen, kleinere Konzerte zu spielen. Die schmalen Erlöse aber nahmen wir nicht für private Belange, sondern wir legten sie wie ein russisches Muttchen auf Heller und Pfennig zur Seite, um mit dem Gesparten noch ein zweites, erneut alles Bisherige in den Schatten stellendes Album zu produzieren.
Im Frühjahr 2012 hatten wir genug beisammen, und noch vor dem Sommer erschien «Triumph der Maschine», das wir an ein paar aufregenden Tagen im Mai wie in einem Rausch aus den Klaviaturen rieseln liessen. Schon am nächsten Tag und fast im Minutentakt prasselten die Anfragen auf uns ein. Mit immer noch süsseren Versprechen versuchten die Konzertveranstalter und Booking-Agenturen, uns an die Angel zu bekommen, Plattenfirmen schickten erst Geschenkekörbe, dann leichte Damen mit Akzent, und ihre Agenten redeten am Telefon – oder wenn sie uns auf der Strasse erwischten – wie im Wahn auf uns ein. Dann kamen die Manager, dann die Verlage, dann die Politik und schliesslich die internationale Kulturdiplomatie. Sie alle wollten Teil dieser neuen grossen Entwicklung sein. Verkleidet als demnächst einzulösendes Versprechen, stolzierten wir 365 Tage lang von Ball zu Ball und von Kongress zu Kongress. Wir mussten nichts tun, die reifen Feigen wurden uns mit dienender Geste von den Bäumen gepflückt.
Nach meinen guten Erfahrungen beim Unterzeichnen von Verträgen entschied ich mit all dem dafür notwendigen Nachdruck, sämtliche Verträge ohne vorherige Prüfung zu unterschreiben, und so geschah es auch. Es ging darin um Prozente, Anteile und Verpflichtungen, aber vor allem um Vorauszahlungen und Vorschüsse von bisweilen 10 000, 30 000, nein 50 000 Euro! Alles, was wir dafür als Gegenleistung tun mussten, war, ein weiteres Album von möglichst ähnlicher Virtuosität auf die Beine zu stellen. Und das, so waren wir überzeugt, würde uns diesmal noch leichter fallen als jemals zuvor.
Um es kurz zu machen: Das genau geschah nicht. Die Vorschüsse waren sehr bald verpufft, ganz so, als hätte es sie nie gegeben, und zwei Jahre lang verzichteten wir vorsichtshalber darauf, noch einmal nachträglich in die Verträge zu schauen, um vielleicht zu erfahren, auf welche Weise wir die Summen würden zurückzahlen müssen.
Irgendwann hielt mein Freund es nicht mehr aus. Unter einer Wolldecke kauernd ging er den Kontrakt eines Nachts mit der Taschenlampe noch einmal Buchstabe für Buchstabe durch und liess mir eine Botschaft übermitteln. Da es uns, wie er herausgefunden hatte, zwecks Vertragserfüllung insgesamt günstiger käme, zumindest irgendein Album statt gar keines zu veröffentlichen, erschien 2014 eine Platte von so geringer Qualität, dass sie heute nur noch als Warnung an künftige Generationen erfolgshungriger junger Menschen verstanden werden kann.
So wahr mir Gott helfe, für das Motiv des Covers hatten wir auf den allerletzten Drücker die Toilettentapete einer Autobahnraststätte fotografiert, und am Tag der Veröffentlichung liessen selbst die kaltherzigsten Menschen auf den Strassen der Republik ihre Köpfe im Wind hängen und blickten beschämt zu Boden, als die mit unseren CDs und Fanartikeln vollgestopften Lastwagen auf dem Weg zur Müllhalde an ihnen vorüberfuhren.