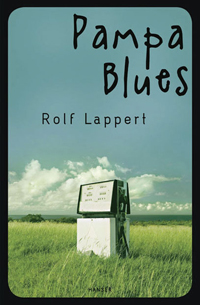Zwei ungleiche Brüder
Vor dreissig Jahren war Hermann Burger der erste Schriftsteller, der den Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg erhielt. Soeben hat ihn ein Schweizer aus demselben Dorf erhalten: der Schriftsteller Klaus Merz. Er erzählt, was die beiden darüber hinaus verbindet.

Herr Merz, Sie haben soeben den Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg erhalten, wir gratulieren. Unser Glückwunsch ist auch direkt an eine Frage gekoppelt: Wie blickt man im Ausland heute auf die Schweizer Gegenwartsliteratur?
Das ist nicht ganz einfach zu beurteilen, aber gerade im deutschsprachigen Raum meine ich in jüngster Zeit feststellen zu können, dass es wieder ein wachsendes Interesse an Schweizer Literatur gibt. – Interesse heisst natürlich nicht, dass einfach Tor und Türen offen stehen. Es dauert schon seine Zeit, bis man als Schweizer Erzähler Fuss fasst in der «übrigen Welt» und in einem Betrieb, der sehr gross, dicht bespielt und schnelllebig ist.
Woran liegt das?
Stimmen, die sich nicht unbedingt durch die grossen Gesten und Geschichten, sondern eher durch stilistische und inhaltliche Achtsamkeit auszeichnen, gehen leichter unter. Unterhaltungsromane für 100 000er Kampfauflagen mit kräftigem Werbebudget kommen nur selten aus der Schweiz. Was mir aber häufig begegnet, ist ein spezifisches Interesse für eine unaufgeregte Sorgfalt beim Erzählen. Für sprachliche Präzision und den gleichzeitig respektvollen Umgang mit den eigenen Figuren.
Dieser Umgang hat Ihnen den Ruf eines «Meisters der Reduktion» beschert. Können Sie als «Reduzierender» sagen, was andere damit meinen?
Man meint wohl damit, dass ich lieber literarisch Eingekochtes herstelle als nur Sirup. Reduktion ist das eine, es geht mir aber vor allem um eine poetische Verdichtung und Aufladung der Texte. Ich möchte ja nicht explizieren, sondern darstellen, möglichst bildhaft, um durch Verdichtung gleichzeitig offene Räume zu schaffen, in denen die Leserinnen und Leser sich selbst und ihre eigenen Anteile zu meiner Geschichte einbringen können, ja sogar müssen.
Was die Art des Erzählens angeht, unterscheiden Sie sich ziemlich deutlich von Hermann Burger, Ihrem langjährigen Weggefährten…
Sicher, ja, doch die Passion für Sprache und Stil verbindet uns, meine ich, über alle Unterschiede hinweg.
Die Passion sicher. Aber: Während er exzessiv ausbreitet, verdichten Sie.
(lacht) Das stimmt. Aber lassen wir in diesem Zusammenhang doch lieber die Literaturkritikerin Elsbeth Pulver zu Wort kommen, sie schreibt im Kritischen Lexikon der Gegenwartsliteratur folgendes, ich zitiere: «Den beiden Autoren, Burger und Merz, ist in ihren Anfängen überraschend viel gemeinsam: nicht nur der Ort der Herkunft und der Kindheit – das Dorf Menziken im Kanton Aargau –, sondern vor allem der Verzicht auf das blosse Abbilden der Realität; dazu die Neigung zum Spiel mit absurden und surrealen Elementen als Möglichkeit, tiefer liegende Schichten der dennoch genau beobachteten Realität freizulegen. – In anderer Hinsicht entwickelten sich die beiden Autoren allerdings als stilistische Antipoden: Im Gegensatz zur zunehmenden Redundanz Burgers tendiert Merz von Anfang an in Lyrik und Prosa zur Lakonie; und vom Burger’schen Pathos in der Selbststilisierung und Selbstbemitleidung heben sich Merz’sche Figuren durch ihre Neigung zum Understatement ab; sie gehören nicht zu den ostentativ Leidenden, fallen durch eine unprätentiöse Tapferkeit auf. Dieser Gegensatz zeigt sich vor allem bei jenem Thema, das in beider Werk eine wichtige Rolle spielt: die Krankheit.»
Wie kommen Sie nun auf Frau Pulver?
Sie ist eine entscheidende Figur in unser beider Schreib-Leben: Sie hat Hermann Burger von früh auf aktiv gefördert, besprochen und zunehmend auch menschlich unterstützt. Mich hat sie später ebenfalls mit kritischer Umsicht begleitet. – Auch Anton Krättli, profilierter Redaktor der «Schweizer Monatshefte», war ein grosser Förderer von Hermann. Sie standen zusammen für eine «Literatur+Kunst»-Seite im «Aargauer Tagblatt» gerade, ein Feuilleton, von dem man heute im Aargau nur noch träumen kann.
Einer von Burgers Förderern war auch Marcel Reich-Ranicki…
Reich-Ranicki war, so denke ich, eine Art Seelenverwandter Burgers, bis in den kleinen Sprachfehler hinein. Und er hat Hermanns grossartige Fähigkeiten klar erkannt. Er hat Burger nach Klagenfurt zum Bachmannlesen eingeladen, und Hermann hat den Preis 1985 auch prompt erhalten. – Später gelang es Hermann sogar, Reich-Ranicki für sein «Aargauer Tagblatt» als Rezensent zu gewinnen. Als Rezensent des aktuellen Burger-Buches, versteht sich. (lacht)
Die Fürsprecher waren zahlreich, vielleicht in dieser Fülle in der bisherigen Schweizer Literaturgeschichte einzigartig. Woher dieser weit über die Grenzen hinausgehende Zuspruch?
Als Schüler Emil Staigers war er von Beginn seiner Karriere an gut verankert – vernetzt, würde man heute sagen, im akademischen sowie im Literaturbetrieb. Er hat sich dieses Netzwerk angelegt, als andere noch gar nicht wussten, dass es das gibt. Sein Erstling erschien bei Artemis, später bemühten sich Fischer und Suhrkamp um ihn. Und das deutsche Feuilleton hat damals, vielleicht dank der Wiederentdeckung Robert Walsers, die in den 1970er Jahren darauf aufmerksam machte, dass es neben Frisch und Dürrenmatt noch ganz andere Schweizer Autorinnen und Autoren gibt, den Schweizer Betrieb aufmerksamer wahrgenommen. Bis 1989 genossen wir in Deutschland ja ein wenig den Status «interessanter Exoten». Als dann die Wende kam, war Hermann schon tot, und es gab wieder genug «inländische Exoten». Das deutsche Feuilleton blendete uns in der Folge wieder vermehrt aus.
Warum hat man also hier wie dort zwar weiterhin Frisch und Dürrenmatt gelesen, aber kaum mehr Burger?
Das lässt sich nicht so genau sagen. Er hat sein Werk selber sehr stark an seine eigene Person gebunden. Und als er dann als Mensch mit all den werbenden Eskapaden und Ferrarifahrten nicht mehr da war, ist seine Literatur wohl einfach mitgetaucht. – Medien und Leserschaft, habe ich oft festgestellt, haben Hermann ja immer öfter nur noch über seine Aktionen und Auftritte wahrgenommen, nicht mehr über seine Texte und ihre verdeckte endogene Verzweiflung. Dabei gibt es so viel, das wir ihm zugute halten müssten: Hermann hat zum Beispiel das «Österreichische» in die Schweizer Literatur eingebracht. Sein «Prosalehrer» war nicht umsonst Thomas Bernhard; von ihm importierte Hermann quasi das fulminante Lamento, das dann niemand anderes so zelebriert hat wie er. Hermann war genauso schillernd wie seine Literatur. Zumindest vordergründig. Und man hat dementsprechend, wie schon gesagt, stets nur auf seinen nächsten Auftritt gewartet, etwa mit dem Sturmgewehr vor den Buchmesse-Kameras: Skandal! Action! – Und auch als Folge schlechter PR-Beratung, die er sich, anstelle von echter Hilfe, kurz vor seinem Abscheiden noch holen zu müssen meinte. – Aber da ist noch lange nicht das letzte Wort gesagt worden, glaube und hoffe ich.
Man hat ihn ja nicht selten auch als Aufschneider und Schwa-dronierer bezeichnet. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ab der «Künstlichen Mutter» verwischen tatsächlich die Konturen zwischen Burger selbst und seinem Werk. Ich konnte mit dem Roman und dem literarischen Klamauk, auf den sich wohl diese Reaktionen beziehen, nicht viel anfangen, für mich war Hermann da buchstäblich schon auf den Gleisen «unter den Berg hinein» unterwegs.
Sein Werk ist ja auch nicht besonders eingängig verfasst, muss man sagen. Aber: wer nicht willens ist, es zu lesen, der hat es auch nicht verdient.
Das ist so, die feine Erzählung «Blankenburg» etwa, sie ist mir fast am liebsten, ergreifend und erhellend zugleich! – Als einer, der Hermann von Kindheitstagen her erinnert, war mir aber bei all seinem auch literarischen Hokuspokus immer klar: Jetzt zaubert er, jetzt ist er in seinem Element. Das konnte nicht jeder. Das faszinierte mich. Aber letztlich definierte er sich ja über sein literarisches Schaffen. Er zog sich immer wieder an den Wörtern aus dem «Sumpf», aus seinen schweren Depressionen heraus. Und sein Schreiben hat «Luftwurzeln» getrieben zwischen Zaubern, Verzweifeln, «Verschellen» und Tod.
Haben Sie keine Angst, genauso vergessen zu werden wie Hermann Burger?
Nein, eigentlich schaue ich unserer Wyna gelassen zu, sie fliesst nun mal bachab. Sollte etwas von uns zurückbleiben, setzen wir beide wohl Leser voraus, die sich für die Sprache ebenso interessieren wie für den Inhalt. Denen es ein Genuss ist, die Dinge, die ja alle schon einmal gesagt worden sind, in einem leicht anderen Licht nochmals anders zu lesen.
Wie muss man sich das Schreiben bei Ihnen konkret vorstellen?
Als Deutschlehrer sagte ich meinen Schülern immer, sie sollten es einfach «fliessen lassen» – und dann «ausholzen». Ich aber erarbeite meine Texte eher wie ein Kupfertreiber: Hämmern, dünner machen, leichter machen, in Form bringen.
Konkreter?
Ich muss meine Texte liegen lassen. Ich muss ihnen immer wieder möglichst fremd werden, um sie neu sehen und korrigieren zu können. Deswegen dauert die Arbeit an einem 100-Seiten-Roman bei mir auch 2 bis 3 Jahre. In dieser Zeit lasse ich die Kapitel – und auch Gedichte – oft ruhen. Grosse Änderungen muss ich zwar im Grunde nach der ersten langsamen Niederschrift meist nicht mehr vornehmen, auch wenn zum Schluss oft sieben bis acht Manuskriptfassungen vorliegen – es geht eher ums Umstellen, ums Zurechtrücken von ganzen Textblöcken. Eine Art von Textschach fast.
In Ihren Geschichten geht es inhaltlich häufig um Aussenseiter. Um den Hauswart, um Auswanderer, die ihr Glück suchen, um den «kleinen Mann», der niemandem auffällt.
Aussenseiter? Eher um Menschen, denen normalerweise kein Denkmal gesetzt wird.
Was macht den Reiz dieser Personengruppen aus?
Mich interessieren die Leute, die den Grossteil unserer Gesellschaften ausmachen und achtbar oder auch auf unsägliche Weise durch ihr Leben gehen müssen. Mich interessiert die Unerschöpflichkeit des Alltäglichen, meist aus Sicht von Figuren, deren reale Vorbilder uns im heutigen Tagesgeschäft, zugegeben, vielleicht eher nur am Rand begegnen.
Hermann Burger soll in seiner Kindheit auch ein Aussenseiter gewesen sein, stimmt das?
Hm – wir sind ja beide im selben Dorf aufgewachsen, und meine Eltern besassen dort eine Bäckerei-Konditorei. Ich stand samstagmorgens während der Schulferien oft hinter dem Ladentisch und musste im Verkauf helfen. Hermann, drei Jahre älter als ich, kam jeweils auch ins Geschäft, um den vorbestellten Zopf abzuholen. Und er hat sich bei uns mit einigen seiner Schulkameraden getroffen, die alle auch auf eine Gratiscrèmeschnitte meines Vaters hofften und sie prompt bekamen. Dann, das habe ich noch genau vor Augen, beim Verdrücken der Patisserie haben ihn die Kollegen meist zu hänseln angefangen. Aber Hermann drehte den Spiess schnell um und gab gleich selber den Hanswurst. Brillant, listig, lustig und ein wenig traurig dazu. Damit hat er sich unter den Stärkeren behauptet. Er hat pariert!
Und wie hat er sich im Deutschunterricht gemacht?
Gute Frage! Denn für unsere beiderseitige literarische Sozialisa-tion ist wohl unsere Deutschlehrerin verantwortlich, Mathilde Rey. Sie hat uns die deutsche Sprache beigebracht, ja eingehämmert: sie hat mit uns Grammatik- und Rechtschreibhefte geführt, war sogar die eigentliche Erfinderin des Leuchtstifts. (lacht) Man musste die Subjekte nämlich in besagtem Heft nicht bloss rot unterstreichen, sondern sie auch noch kolorieren, so dass sozusagen ein Leuchteffekt entstand. Die Prädikate blau, die Objekte grün usw. Sie konnte unheimlich unangenehm werden, wenn man Fehler machte, die Frau im immerblauen Jackettkleid und mit den streng nach hinten gezogenen Haaren. Aber sie hat uns auch die Literatur ähnlich intensiv und engagiert nahegebracht wie die Orthographie. Einerseits lehrte sie uns also Präzision und Sorgfalt, andererseits legte sie ebenso viel Wert auf das Erleben von Literatur. – Wahrscheinlich hat sie von uns beiden unsere Erstpublikationen auch als erste geschenkt bekommen.
Wie sah denn Ihrer beider Durchbruch in der Literatur aus?
Hermanns «Rauchsignale» haben wesentlich mehr Dampf gemacht als mein «Mit gesammelter Blindheit», das im gleichen Jahr, 1967, erschien. Beide Veröffentlichungen wurden wohl von Erika Burkart iniziiert; sie war uns eine wichtige Förderin und Freundin. Sie wird das Ihrige bei Artemis, ihrem Verlag, für Hermann getan haben, und Traugott Vogel, ein enger Freund von ihr, hat mich in die damals legendäre Reihe der «Bogenhefte» aufgenommen. Hermann und ich sind einander daraufhin oft begegnet, haben sogar eine Art Literaturzirkel gebildet.
Konkreter?
Die erste Station war «Schiltwald». Da hatten wir einen gemeinsamen Burkart-Freund, Jannis Zinniker, etwa so alt wie wir, der dort im Schulhaus, das später die Folie für «Schilten» abgeben sollte, unterrichtete und wohnte. Dort haben wir uns einige Male getroffen. Hermann, meine ich, wurde nach einem solchen Treffen für eine kurze Stellvertretung in Schiltwald angefragt – so ist er dann buchstäblich in diesen Schilten-Kosmos hineingewachsen, der sich im beeindruckenden Roman von 1976 wiederfindet. Friedhof, Turnhalle, Harmonium.
Noch konkreter. Wie muss man sich diese Treffen vorstellen?
Ganz einfach: Wir haben uns zusammengesetzt und über unsere neuen Texte gesprochen. An der Aare «betrieb» Hermann ein Gartenhaus als Atelier und Schreibstube. Da stiessen auch Arthur Hächler und Silvio Blatter, der im Sauerländer-Verlag eine kleine Buchreihe lanciert hatte, zu uns. Und Hans Boesch, als ein Abgesandter und Vorbild beinahe unserer Vätergeneration, ein Ingenieur und grossartiger Schriftsteller, erdete unsere Gruppe. Ich erinnere mich, dass Hermanns «Tod im Café», das später in «Bork» erschien, einmal zur Diskussion stand. Ich selber hatte jeweils Gedichte oder kürzere Erzählungen dabei. Und immer hatten wir ein Ziel: Wir wollten Fuss fassen in der Welt der Literatur, eventuell gar einen eigenen Autorenverlag gründen.
Dazu kam es nie. Im Februar 1989 hat er Suizid begangen. Wann haben Sie ihn das letzte Mal getroffen?
Im Herbst 1988 haben wir noch einmal zusammen gelesen. Hermann war tief gebräunt und hatte beim anschliessenden Fest eine Ärztin als Begleiterin neben sich, von der er sich immer wieder den Puls messen liess. Dazwischen unterhielten wir uns aber miteinander wie zwei beinahe gesunde Menschen und «alte Kameraden» – denn ich sass ja mit Hermann zusammen, nicht mit dem Showmaster.
Lesen Sie auch Klaus Merz‘ Erinnerung an Hermann Burger in «Der Begleiter».