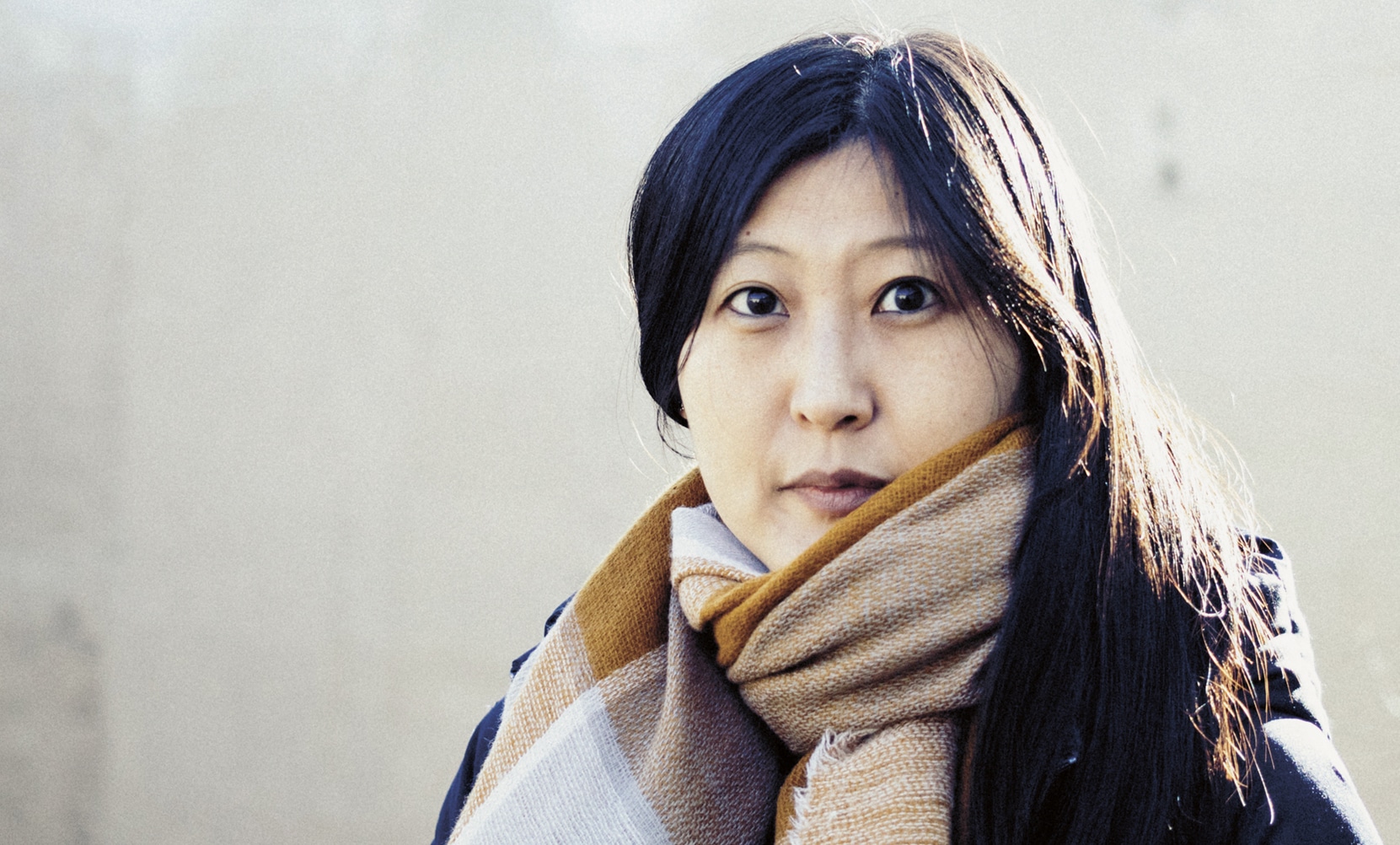Bitte angemessen beflaggen!
Bänz Friedli wurde als herumreisender «Pendlerkolumnist» in «20 Minuten» einem Millionenpublikum bekannt – niemand beschrieb die Agglo wie er. Heute sagt er: So richtig kennengelernt habe er sie eigentlich erst, nachdem er das berufliche Gleis gewechselt habe. Ein Werkstattbericht.

Bestes Theater» lautete die Überschrift, und die Rezension ging so: «Welch grandiose Inszenierung. Sie bildet die Schweiz schonungslos ab. Das Dekor minimal gehalten, aber effektvoll: Metallstangen und ein gummierter Bodenbelag, stark verschmutzt, schaffen ein kaltes Ambiente. Die stummen Figuren, auf Sessel verteilt, symbolisieren die Verlorenheit des einzelnen in einer entfremdeten Gesellschaft. Glasscheiben werfen die Individuen mit gespenstischen Spiegelungen auf sich selbst zurück. Jeder ist allein. Der grummelnde Rentner. Der bekiffte Hip-Hopper. Ein Taschendieb. Zwei Immigrantinnen, die in gebrochener Sprache tuscheln; ausgemergelte, verhärmte Frauen, die eine mit Kopftuch, die andere mit braunen, angefaulten Zähnen. Als hätten sie Angst, belauscht zu werden, wispern sie flüchtige Sätze. Über den Überlebenskampf. Woher das Geld nehmen, um die vielen Kinder zu ernähren? Wie die Miete bezahlen? Die Krankenkasse? Auf den Mann ist kein Verlass, er hurt herum. Die unerträgliche Gewöhnlichkeit des Elends. Dann tritt der Neonazi auf. Glatze, stierer Blick, Runen auf der Jacke. Er pöbelt, wird handgreiflich. Eskalation droht. Bis ein Junkie taumelnd dazwischengeht. ‹Lass doch die armen Weiber in Ruhe›, sagt er, verwickelt den Nazi in eine Diskussion, und: ‹Chumm, hee, häsch mer nöd zwäi Stutz?›
An dieser Aufführung stimmt alles. Die Tonspur: bedrohlich knatternd. Die Handlung: überraschend. Die Dialoge: packend lebensecht. Die Darsteller: glaubhaft vulgär. Die Moral: doppelbödig. Grosses Theater, stets bis auf den letzten Platz besetzt. Kostenlos zu sehen im 31er, dem Bus von Schlieren Richtung Farbhof. Und keinen hier drin kümmert dieser Marthaler.»
Als ich im vergangenen Frühjahr die Texte für ein Sammelbändchen mit Pendler- und Eisenbahngeschichten zusammenstellte, fiel die Kolumne durch, die Sie soeben gelesen haben. Eine Randspalte aus dem Frühherbst 2002 – die konnte man nicht mehr bringen, niemand mehr würde die Anspielung auf «diesen Marthaler» verstehen. Viel zu lange her, die Aufregung um den damaligen Chef des Zürcher Schauspielhauses, Christoph Marthaler. Einige Bildungsbürger und Journalisten, angeführt vom damaligen Publizisten und heutigen SRG-Generaldirektor Roger de Weck, hatten mächtig Aufhebens um Marthalers Absetzung gemacht: «Zürich schreit: Marthaler bleibt!» Doch von einer Volksbewegung konnte keine Rede sein, und der Protest verebbte rasch.
Es war nur der Protest einiger studierter Stadtmenschen, und vermutlich wollte ich mit dem kleinen Text auf etwas krude Weise ausdrücken: Was kümmert uns in der Agglo draussen deren elitäreres Gescheiss?
Von alltäglichen Ärgernissen handelten die kleinen Texte, die ich regelmässig verfasste, vom täglichen Kopfschütteln über unflätige Mitreisende, über Dauertelefoniererinnen und Dönerverzehrer, plärrende Teenies und mäkelnde Seniorinnen, über zu spät Aus- und zu früh Einsteigende; über Nichtigkeiten halt, die vielen so lästig vertraut sind, dass sie nicht nichts sind. Und, ja, sie handelten auch davon, dass man sich öfter selber just bei dem ertappt, worüber man sich so fürchterlich ärgert, wenn andere es tun: beim Dauertelefonieren, Schirmausschütteln und Durchgangversperren … Und zuweilen handelten sie von angenehmen Überraschungen, von dem Dödel mit Pilzfrisur und Hornbrille etwa, der sich mitsamt seiner Gitarre in den Waggon zwängte, einen dann aber, noch ehe man sich über ihn aufregen konnte, mit einer so hinreissenden Version von «You’re the One» bezauberte, dass man meinte, Buddy Holly persönlich sei einem erschienen.
Darüber hinaus und vor allem aber handelten die Kolumnen von der Unterschiedlichkeit der Welten, zwischen denen Arbeitspendelnde täglich pendeln. Hier die Agglo, da die Stadt, die sich zu jener Zeit gerade mit der albernen Losung «Downtown Switzerland» schmückte. Welten, einander nah, vielleicht nur drei, vier S-Bahn-Haltestellen auseinander – und doch so fern. In der Agglo ist der Tonfall ein anderer, da kommen die Moden später an, da fuhren die Jugendlichen noch Waveboards, diese zweirädrigen Dinger mit Fussplatten und Torsionsstab, als in der City bereits vierrädrige Longboards angesagt waren, da galt die Freitag-Tasche noch als chic, als sie in der Stadt passé war.
Das Hin und Her hat mein Schreiben bestimmt, das Beobachten, Belauschen und Schildern. Die Agglo: längst nicht mehr Dorf; und doch gebärdet sie sich noch als solches. Alteingesessene sehen noch das Feld, das vor Jahrzehnten schon überbaut wurde, «wäisch na, Kurt?», Rentnerinnen erinnern sich, dass das «Moser-Gut» mal ein Bauernhof und nicht ein ökumenisches Gemeinschaftszentrum war. Und am «Dorfmärt» bieten die Frauen von der Strickgruppe der Pro Senectute gekringelte Socken feil, von denen sie gar nicht ahnen können, wie hip die in den Boutiquen der Innenstadt gerade wieder sind. Man sammelt Pro-Bons, die gibt’s beim Drogisten und bei der Blumenfrau, mit der man per Du ist. Der Nachbar mäht schon wieder den Rasen, ein Räselein von erbärmlichen sechs Quadratmetern… Das ist doch der Schafseckel, der für die Volkspartei in der Schulpflege sitzt? Aber man grüsst ihn ja doch freundlich – «Armin! Sali, wi gahts?» –, die Töchter spielen zusammen Fussball. Und am 1. August bitten Gewerbeverein und Kulturkommission in einem gelben Flugblatt, die Bevölkerung möge die Häuser angemessen beflaggen.
Die Themen würden mir ausgehen, fürchtete ich, als wir – nach etlichen Jahren in der Agglomeration – in die Stadt zogen. An den Rand der Stadt, aber immerhin: in die Stadt. Doch am ersten Tag schon lieferte ein Möbeldesigner aus dem hippsten Kreis von «Downtown Switzerland» mir ein hippes Gestell. «Jetzt, da ich in der Stadt wohne…», sage ich beiläufig. Und er schaut mich fassungslos an: «Stadt?!» Erklärt dann: «Wäisch, für eus ghört das da dusse nüme zur Stadt…» Und wirklich, bald schon stellte ich fest, dass sich auf dem Trottoir alle grüssen, dass auf dem gepflästerten Vorplatz der Quartierkirche alljährlich die «Miss Albisrieden» gekürt wird, die schönste Kuh der Gegend; ein Alphornquartett spielt auf, Würste werden grilliert, der Ortsverein verkauft gehäkelte Pfannenblätze. Beim Drogisten gibts Pro-Bons, mit der Verkäuferin im Sportfachgeschäft bist du bald schon per Du, ein Schwatz hier, ein Verweilen da, ein Kopfschütteln über den Nachbarn, der stets so pingelig seine Thujahecke stutzt – das Unscheinbare, über das ich so gerne schrieb, gibt es auch in der Stadt: die kleinen Dinge, die das Leben ausmachen.
In der Stadt herrscht genauso «Agglo» wie draussen in der Agglomeration. Und vermutlich sind ohnehin alle irgendwie Pendler in dem kleinen Land, das zu zersiedelt ist, als dass es noch lautere Landeier und stilechte Stadtmenschen gäbe. Gewiss, einige tun so. Aber: je cooler sich der Webdesigner hinter seiner Nerd-Brille und seinem zerzausten Bart als Stadtneurotiker gebärdet, desto sicherer kannst du sein, dass er in einem Kaff im Thurgau aufgewachsen ist und dort regelmässig das Grosi besucht. Klammheimlich natürlich, den Kollegen erzählt er, er ziehe sich die neueste Staffel «House of Cards» rein. Gibt eine vor, ihre Jugend Molotowcocktails werfend im Zentrum von «Züri brännt» verbracht zu haben, dann ging sie damals bestimmt noch brav in Ottikon zur Schule. Welche Biographie balancierte denn heute nicht zwischen einer Kindheit im Turnverein und urbaner Pop-up-Gastronomie, zwischen Jugendliebe in Churwalden und Gelegenheitsbeischläfer im städtischen Szeneviertel?
Zwar wirbt eine Illustrierte im Herbst 2015 unter dem Slogan «Meine Schweiz» im Weltformat mit traumhaften Natursujets: ein Altbundesrat in hehrer Bergwelt, ein Weltcupstar an einem stillen See, eine Ständerätin im weiten Tal. Und nur Grün und Natur und blauer Himmel. Hier wird ein Land suggeriert, das es nicht gibt. Die Wahrheit ist eine Agglo, die sich als breites Band von Freiburg bis Rorschach zieht, von Stans bis Schaffhausen, von Basel bis Walenstadt.
Über deren Bewohnerschaft, über die angeblich doofen Hausfrauen mit ihren «frechen» Frisürchen, lässt es sich leicht lästern aus Zürcher Warte, besonders aus gläsernen Redaktionshäusern heraus. Wer aber herumkommt im Aggloland, lernt zu differenzieren. Gewiss, in der Hüsli-Schweiz stehen meist zwei Offroader vor dem Haus, einer für den Papi, damit er zur Arbeit fahren kann, einer fürs Mami, auf dass es die Cheyenne ins Ballett bringen und den Leon vom Fussballtraining abholen könne… Halt, bin ich da nicht schon wieder bei den Stereotypen? Aufgepasst! Ja, es gibt die Hüsli mit den Offroadern davor. Aber das heisst noch lange nicht, dass alle beschränkt sind, die darin wohnen. Das ist das Spannende an der grossen Agglomeration mit ihren vielen kleinen Schweizen: dass sie nirgends gleich und überall voller Eigenheiten ist. Im ach so urbanen Loft kann der bornierteste Biederling stecken, im biedersten Eigenheim der weltoffenste Hausmann.