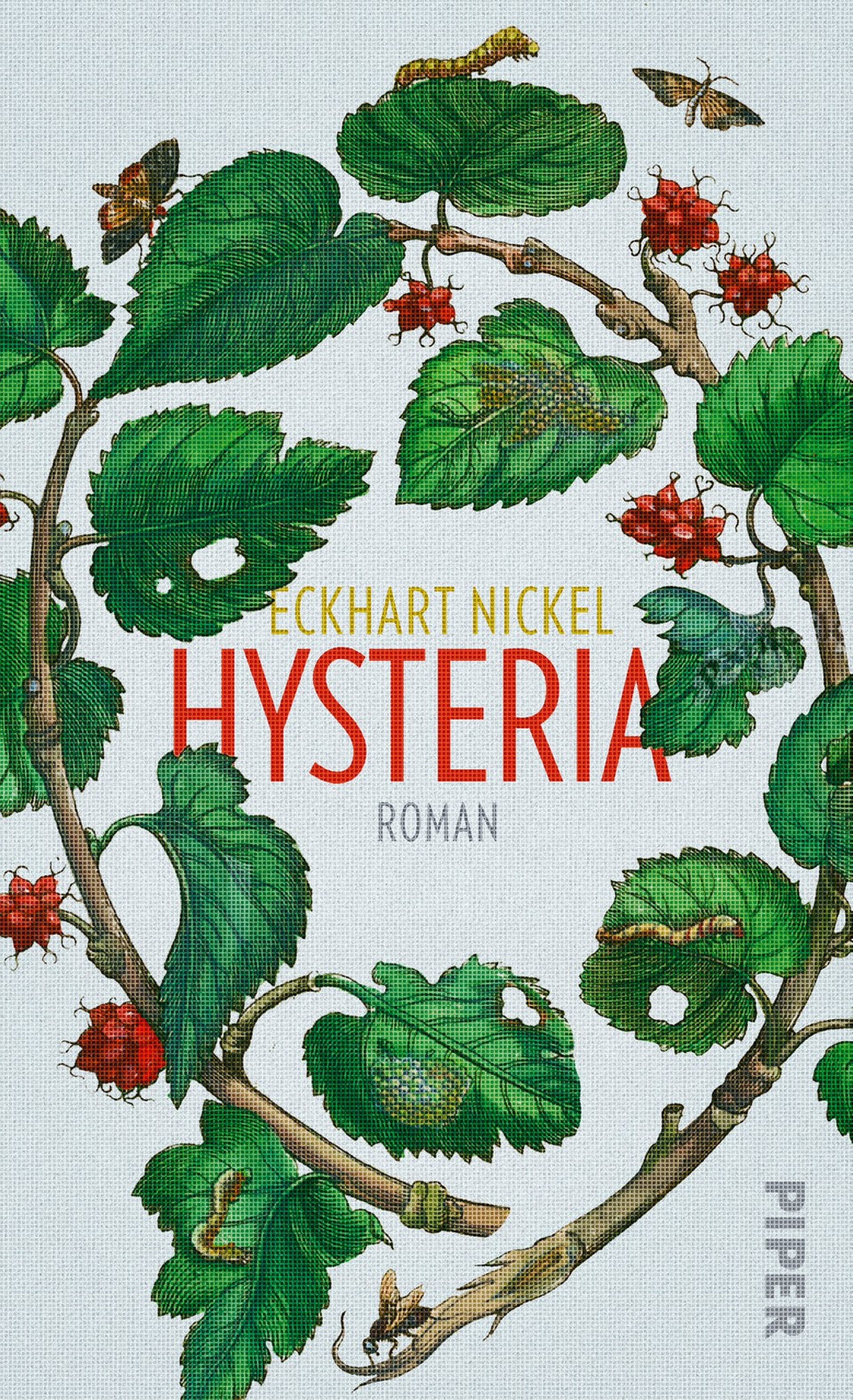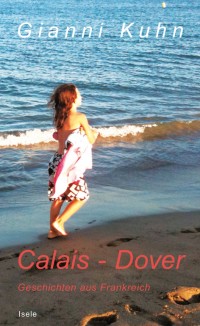Die totale Herausforderung
Schweizer Schriftsteller in Diktaturen

Viele Schweizer haben totalitäre Länder bereist: als Reporter, Diplomaten, Geschäftsleute oder Touristen. Wie nehmen Besucher aus einer Demokratie eine Diktatur wahr? Welche Einblicke haben sie in die fremde Gesellschaftsform? Wie lassen sie sich aber auch täuschen oder sogar faszinieren? Und was erfahren sie dabei über sich selbst? Wir begleiten drei Autoren auf ihren Reisen: nach Nordkorea, in die DDR und nach Nazideutschland. In ihren Berichten verfolgen sie drei unterschiedliche Ansätze: einen ästhetischen, einen psychologischen und einen medizinischen.
Ästhetik: Koreanische Projektion
Christian Kracht besuchte im Jahr 2004 das isolierteste Land unserer Zeit: Nordkorea. Zu Photographien von Eva Munz und Lukas Nikol, die auf dieser Reise entstanden, schrieb er das titelgebende Vorwort: «Die totale Erinnerung» (2006). Der Titel zitiert den Film «Total Recall» von Paul Verhoeven mit Arnold Schwarzenegger (1990) nach der Kurzgeschichte «We Can Remember It for You Wholesale» des Science-Fiction-Autors Philip K. Dick (1966). Die englische Ausgabe des Nordkorea-Bildbandes wiederum trägt den Titel «The Ministry of Truth», der aus George Orwells Roman «Nineteen Eighty-Four» (1949) stammt und Manipulation nicht biologisch, sondern sprachlich begreift. «Erinnerung» wird bei Dick künstlich eingepflanzt, «Wahrheit» bei Orwell propagandistisch erzeugt.
Der Untertitel, «Kim Jong Ils Nordkorea», deutet an, dass das Land, um das es hier geht, seinerseits als Fiktion eines Autors verstanden wird. Die totalitäre Gesellschaft ist das perverse «Kunstwerk» ihres Diktators, der als allmächtiger Impresario eine begehbare «360-Grad-3-D-Inszenierung», «eine gigantische Installation», «ein manisches Theaterstück» geschaffen hat. Die beiden ersten Photographien, offiziellen Quellen entnommen, zeigen Kim zunächst wie in einem Autorenporträt und dann als Regisseur, der durch das Okular einer Kamera blickt. Als handle es sich um l’art pour l’art, die keiner Erklärung bedarf, gibt es keine Bildunterschriften, nur Zitate aus einer medientheoretischen Schrift des Diktatordirektors, «Über die Filmkunst» (1989).
Das Verzeichnis der «Autoren» nennt nicht nur die beiden Photographen, Munz und Nikol, sowie den Verfasser des Vorworts, Kracht, sondern auch den obersten Staatskünstler, dessen Schaffen hier dokumentiert wird, und zwar an erster Stelle und parodistisch parallel formuliert: «Kim Jong Il ist Staatsoberhaupt der Demokratischen Volksrepublik Nordkorea. Er lebt in Pjöngjang.»
Die 99 Photos von Munz und Nikol, die den Hauptteil des Bandes bilden, zeigen die Inszenierungen der nordkoreanischen Diktatur: eine Choreographie im Stadion, ein militärisches Ballett, Tänzerinnen mit Fächern, eine Sängerin mit einem Mikrophon, vor laufendem Fernseher. Es sind vor allem Bilder von Bildern oder von Monumenten, Repräsentationen zweiten Grades. Viele zeigen die Mittel und Medien der Simulation: Bühne, Vorhang, Kronleuchter, Scheinwerfer, Lautsprecher, Kameras, Stromkabel, ein Telephon, ein Fernglas auf einem Stativ, Fernsehbildschirme und sogar Bücher.
Nur selten tritt ein Publikum in Erscheinung. Überhaupt scheint im öffentlichen Raum kulissenhafte Leere zu herrschen: auf den Strassen, in den Regalen, in einer Bar. Eine Polizistin regelt einen nicht vorhandenen Verkehr. Ein einsames Auto bewegt sich als Irrläufer über die verwaiste Kreuzung gewaltiger Boulevards. Ein Kind steht auf einem Podest, als imitiere es eine Statue des «Geliebten Führers». Eine Dose Coca-Cola scheint eigens im Stillleben platziert worden zu sein. Mit einer Plakette bezeugt die «New York Group for the Study of Kimilsungism» ihr Interesse für die Lehre des Diktatorenvaters – ebenso wie «Der Schweizerische Studienzirkel der Dschutsche-Idee» für die geltende Staatsideologie. Wer hier keine Ironie spürt, ist selber schuld – oder begeistert von Kim Jong Un.
In Nordkorea ist nichts, wie es scheint, alles autoritäre Simulation. In seinem Essay berichtet Kracht, wie er, Munz und Nikol die Dreharbeiten eines Historienfilms besuchten. Dabei konnten sie feststellen, dass sogar diese nur vorgespielt waren. «Das Kabel der Filmkamera war nicht eingesteckt.» Dafür wurden die drei Gäste selbst heimlich gefilmt, so dass sie sich am Abend im Staats-TV sehen konnten: «Wir waren Teil der Projektion geworden.»
Wenn Kracht darauf hinweist, dass im Reich Kim Jong Ils alles, was die Besucher zu sehen bekommen, fingiert ist, und wenn er davor warnt, wie trügerisch Bilder der Diktatur sein können, so ist dies alles andere als ein ästhetizistischer «Flirt» mit dem Totalitarismus, den man ihm unterstellt hat, sondern im Gegenteil Aufklärung über dessen Verführungskraft. Die «Ästhetisierung des politischen Lebens», wie sie «Die totale Erinnerung» vor Augen führt, hat Walter Benjamin im Aufsatz über «Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit» (1938) als Tendenz des Faschismus beschrieben.
Woran aber «erinnert» uns die koreanische Simulation? Die totale Erinnerung, die in der Diktatur implantiert wird, ist eine fiktive, die das Bewusstsein der Menschen verändert. Und sie ist zugleich, als totalitäre, eine allzu reale, die in unsere eigene Geschichte führt. Denn die Bilder aus Nordkoreas «Schattenreich» meinen «wir», so Kracht, «aus einem dunklen Traum» zu kennen. Sobald wir jedoch aus diesem Albtraum erwachen, entgleitet uns ihre Bedeutung. «Wir erinnern uns, wir wissen aber nicht, woran.» Diese verdrängte, in Sigmund Freuds Sinn unheimliche Erinnerung, die hier angedeutet, aber nicht ausgesprochen wird, ist die an die deutsche Vergangenheit: an die Totalitarismen der DDR und vor allem des Nationalsozialismus. Wenn Kracht schreibt, dass in Nordkorea Menschen «verfolgt», in «Lager» verschleppt und dort umgebracht würden, so verweist diese Wortwahl auf den Terror der Nazis und auf die Shoah. Und wenn er Gerüchte zitiert, nach denen der Diktator Drogengeld «in der Schweiz versteckt» habe, spielt er an auf die ökonomische Kollaboration der neutralen Eidgenossenschaft. Die Bilder von Nordkorea, die «wir» in der «Tagesschau» sehen und die ihm selbst in Pjöngjang vorgeführt wurden, versteht Christian Kracht als Deutscher und als Schweizer zugleich.
Psychologie: Realsozialistischer «Biedersinn»
Als teilnehmende Beobachter besuchten Schweizer Schriftsteller vor allem die Diktaturen der Nachbarländer. Im totalitären Deutschland waren sie privilegiert: kulturell nahe, mit der Sprache vertraut – und zugleich auf Distanz.
Als er in den neunzehnsiebziger Jahren in Westberlin lebte, setzte sich Max Frisch mit der DDR auseinander, die er mehrfach besuchte. Anders als Kracht in Korea interessierte sich Frisch in seinem «Berliner Journal» der Jahre 1973–1974 nicht für die Ästhetik, sondern für die Psychologie des Totalitarismus: für das Verhalten der Einwohner, ihre Emotionen, ihre Sprache. Seine Ethnographie der Diktatur ist so nuanciert, dass besondere Wörter erforderlich werden, um das Verhalten der DDR-Bürger beschreiben zu können: Die meisten begegnen einander mit «strikter Verhohlenheit». Nur Wolf Biermann, der kritische Sänger, wirkt «unverschüchterbar».
Im Umgang zwischen Menschen aus West und Ost beobachtet Frisch vor allem Scheu, Vorsicht, Behutsamkeit. Bei DDR-Bürgern bemerkt er Befangenheit, Unsicherheit, Scham und «die Kümmernis, provinziell zu sein». Sie würden sich «genieren», weil sie nicht reisen durften und die Welt nicht kennen konnten. Als Ergebnis der «Klaustrophobie» sieht er eine «Minderwertigkeitsangst». Allenthalben herrscht ein «DDR-Komplex»: als Selbstbezüglichkeit der Abgeschiedenen, «ohne Neugierde» auf die Sorgen im anderen Deutschland. Kommt ein heikles Thema auf, für das die Stasi sich interessieren könnte, oder fällt ein Name, der mit einem Tabu belegt ist, verstummen die Gesprächspartner. Die Stimmung «vereist». Frisch bemerkt eine «Selbstzensur nicht nur beim Reden, sondern auch mimisch». «Staatsfeind Nummer eins bleibt die Spontaneität.» Als «Ventil» bei aller Beklemmung dient ein betont joviales Verhalten – ebenso wie das Lachen im Kabarett oder im Theater. Ein «Alibi-Humor», «in Anführungszeichen gesprochen», soll dem Gast aus dem Westen eine kritische Haltung vortäuschen. Ganz anders als in der «wilden Komik» eines Wolf Biermann.
Bei seinem Nachbarn Uwe Johnson, der aus der DDR ausreiste, stellt Frisch einen traumatischen Zwiespalt fest, einen bitteren «Heimweh-Hass». Gegenüber Künstlern, die blieben, wie Jurek Becker oder Christa Wolf, verhält sich der Übergesiedelte, ähnlich wie Biermann, der Dissident, aggressiv. Das schlechte Gewissen desjenigen, der das Land verlassen hat, begegnet dem schlechten Gewissen derer, die sich mit dem System arrangiert haben.
Am Ende bemerkt der Schweizer Besucher, wie das Diktaturverhalten auf ihn selbst übergeht: «es steckt an», er wird «selber vorsichtig», befangen, unfrei. Was er in Ostberlin sah, überträgt er auf seine Heimat: den «Biedersinn», den «stinkenden Atem der Provinz», die «politische Gegnerschaft» zur politischen Klasse. Er verfasst eine eigene literarische Dystopie – über Zürich als geteilte Stadt.
Medizin: Faschistische Infektion
Dass er in Berlin bereits die zweite Diktatur erlebte, erwähnt Max Frisch in seinem Tagebuch nicht. Vier Jahrzehnte zuvor, 1935, war er als junger Autor zum ersten Mal nach Deutschland gereist. Diesen Aufenthalt, von dem er in einer Reportage für die «Neue Zürcher Zeitung» berichtete, begriff er als «Probe» für seine eigene Haltung. In Stuttgart versuchte er, das ‹ewige› vom ‹heutigen› Deutschland zu unterscheiden, die Kultur, mit der er sich als Deutschschweizer identifizierte, von jener zu trennen, die vom Faschismus befallen war. Sogar in einer antisemitischen Ausstellung, die er in Berlin besichtigte, bemühte sich der Reporter um eine differenzierte Betrachtung. «Was diese Ausstellung über die Juden bringt, die sie als auserwähltes Volk verspottet, lässt es uns äusserst schwer werden, über diesem Dritten Reich das ewige Deutschland nicht zu vergessen», gibt er einerseits zu; und erklärt andererseits: «Man möchte wohl wünschen, dass das heutige Reich nach jenem notwendigen Zurückdämmen die Rassenfrage nicht länger auf die Spitze treibe.» Das «notwendige Zurückdämmen» eines offenbar übermässigen jüdischen Einflusses? Der Verfasser des kurz zuvor erschienenen «Jürg Reinhart», in dem rassistische Fremdbilder durchaus eine Rolle spielen, zeigte Verständnis für Diskriminierung, aber Vorbehalte gegen Gewalt.
Max Frisch war nicht der einzige Schweizer, der eine ‹Reise ins Reich› unternahm. Annemarie Schwarzenbach erlebte die Machtübernahme der Nationalsozialisten in der deutschen Hauptstadt, John Knittel nahm teil an einer Propagandarundreise im Krieg, René Juvet und René Schindler erlebten die Bombenangriffe der Alliierten, der NS-Sympathisant Jakob Schaffner kam in ihnen um.
Im Frühjahr 1940 fuhr Meinrad Inglin nach Berlin, Leipzig und Hamburg, um vor Auslandschweizern zu lesen und nebenbei für die Regierung in Bern «die Augen offen zu halten». Im Bericht über seine «Missglückte Reise durch Deutschland», dessen Typoskript aus dem Krieg in Schwyz im Archiv liegt und der später in den «Schweizer Monatsheften» erschien, wählte Inglin ein Mittel, das auf den ersten Blick einfach und realistisch, auf den zweiten jedoch hintersinnig und poetisch erscheint. Er beschreibt, wie er sich «im Nachtschnellzug erkältet» und eine Lungenentzündung zuzieht, die ihn dazu zwingt, seine Tournee abzubrechen. Das Fieber steigt lebensbedrohlich. Die Expedi-tion in die Diktatur wird zu einer Nahtoderfahrung. Wer deutschen Boden betritt, so scheint es, setzt sein Leben aufs Spiel. Die deutsche Landesgrenze bildet in Inglins Erzählung einen cordon insanitaire – analog zu seinem Roman «Schweizerspiegel» (1938), wo die Spanische Grippe während des Ersten Weltkriegs die Schweiz von aussen bedroht.
Die Wahrnehmung des Kranken wird zunehmend verzerrt. Inglin schreibt wie aus einem Fieberwahn: Pneumo-Prosa. Die totalitäre Erfahrung hat poetische Effekte. So ist der Reisende in den labyrinthischen Korridoren eines menschenleeren Polizeigebäudes kafkaesk auf der Suche nach einer behördlichen Beglaubigung, er bewegt sich wie durch die Kulisse eines expressionistischen Spielfilms, und alles erinnert an eine Schauergeschichte, die auf einem transsylvanischen Schloss spielen könnte. Auf den verdunkelten Strassen der Reichshauptstadt fahren mit abgedeckten Scheinwerfern Offiziere vorbei, die «wie fremdartige Geschöpfe aus einem Aquarium» zu ihm herausstarren. Im Hamburger Krankenbett erfährt er im Delirium die Vision eines Sturms, die das Szenario von Thomas Manns «Zauberberg» umkehrt. Am Horizont zieht der Weltkrieg herauf.
Inglins scheinbar so zufällige Krankheit wird lesbar als ausgefeilte Allegorie des Nationalsozialismus. Schweizer, die mit diesem sympathisierten, bezeichnet er als «die Angesteckten». Diese Ansteckung scheint nun auch ihn selbst zu betreffen. Und wenn eine Erkrankung der Lunge, wie Susan Sontag feststellte, die Metapher für eine «Erkrankung der Seele» ist, dann wird auch ihre Behandlung bedeutsam. In Inglins Bericht sind es durchweg Schweizer Mittel, die ihn in Deutschland heilen und retten. Zunächst wird dem Kranken ein Antibiotikum verabreicht, «ein Basler Produkt»; erholen soll er sich in einer «Zweiganstalt des Berner Diakonissenhauses»; und auf dem Höhepunkt des Fiebers stellt er sich vertraute Gewächse vor, die gerade «daheim» in Schwyz erblühen müssten: «Märzenglöggli». Um die deutsche Gefahr zu bewältigen, besinnt sich der Schweizer Patient auf das Eigene, im Sinne eines Rückzugs ins Réduit: aus Basel, der Grenzstadt, über Bern, die Bundesstadt, nach Schwyz, in den Urkanton.
In der Diktatur aktiviert der Schweizer seine Widerstandskräfte. Er überwindet die faschistische Krankheit, aber er beschreibt seine eigene Anfälligkeit. Denn nach der Logik der Inkubation muss die Infektion bereits vor der Grenze geschehen sein, damit sie während der Einreise virulent werden konnte: in der Schweiz selbst.
Oliver Lubrich
ist Professor für Deutsche und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Bern. In der Anderen Bibliothek gab er «Reisen ins Reich 1933–1945» und «Berichte aus der Abwurfzone 1939–1945» heraus.
Quellen:
Christian Kracht, Eva Munz und Lukas Nikol: Die totale Erinnerung. Kim Jong Ils Nordkorea, Berlin: Rogner & Bernhard, 2006.
Max Frisch: Aus dem Berliner Journal. Herausgegeben von Thomas Strässle, unter Mitarbeit von Margit Unser, Berlin: Suhrkamp, 2014.
Max Frisch: Kleines -Tagebuch einer deutschen Reise. In: Neue Zürcher Zeitung, 30. April, 7. Mai, 20. Mai, 13. Juni 1935.
Meinrad Inglin: Missglückte Reise durch Deutschland. In: Schweizer Monatshefte, Jg. 43, H. 3 (1963), S. 246–261.
Die Schreibung der Titel und Zitate von Kracht, Frisch und Inglin wurde den Konventionen des «Literarischen Monats» angepasst.