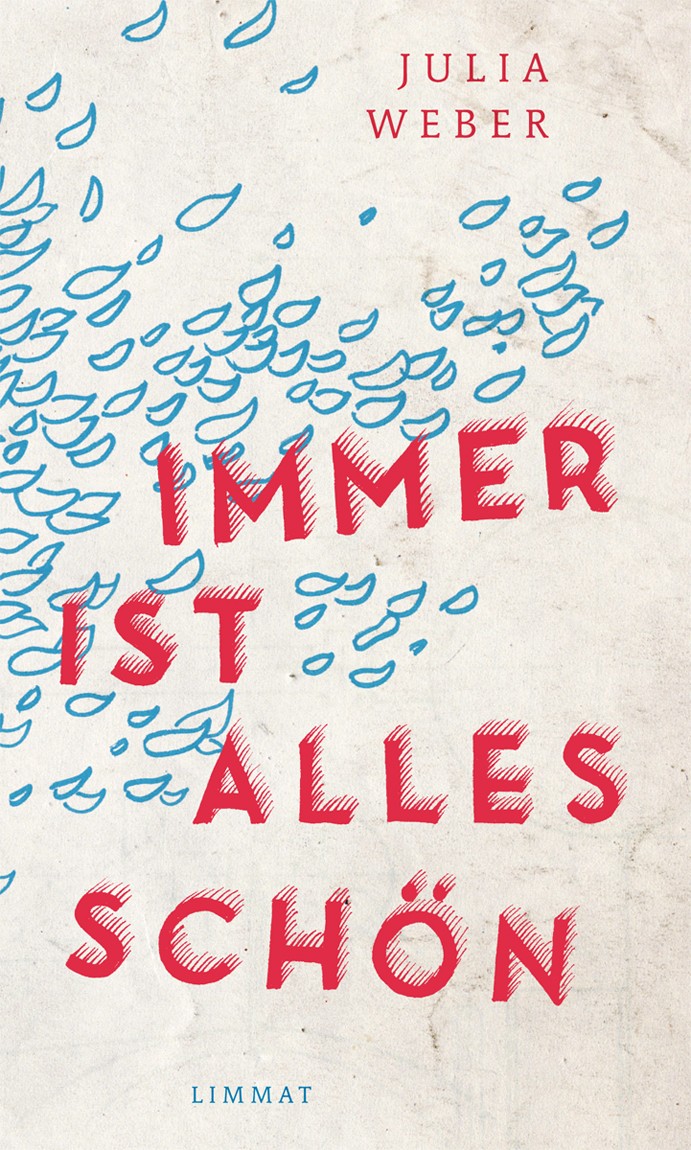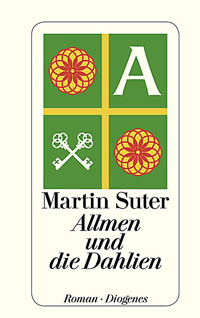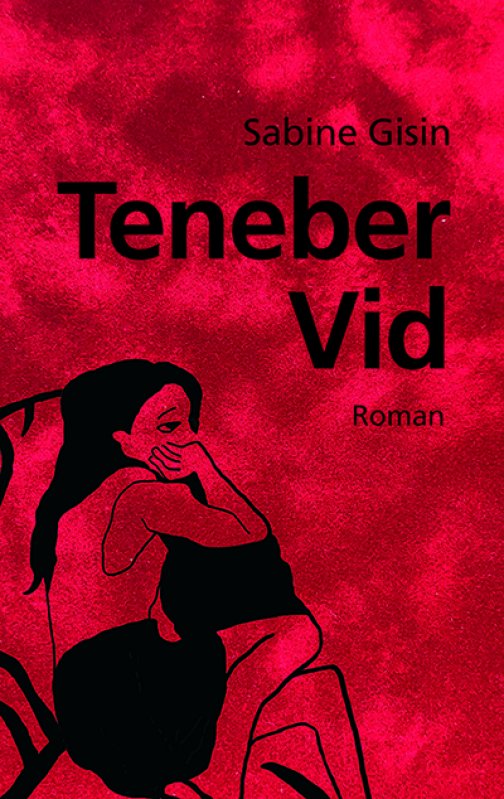Die Unerhörten.
Dankesrede.

Einige Wochen bevor Yves Laplace einen der Schweizer Literaturpreise für «Plaine des héros» erhielt, war er schon mit dem neu geschaffenen Alice-Rivaz-Preis ausgezeichnet worden. Zu dieser Gelegenheit schrieb er den folgenden Text mit dem Titel «Die Unerhörten». Es handelt sich um eine Hommage an die Genfer Autorin Alice Rivaz (1901–1998), um eine Dankesrede für den ihm verliehenen Preis (die ebenso dem Schweizer Literaturpreis gelten könnte) und um eine Anspielung auf Thomas Bernhards posthum erschienenes Buch «Meine Preise». Der Text erscheint hier erstmals auf Deutsch.
Die Unerhörten
Nachdem ich lange gezögert hatte, wie sich meine Dankesrede gestalten sollte, und obwohl mein Naturell mich eher dazu verführte, eine Art Thomas Bernhard’schen Monolog zu improvisieren, beschloss ich, mich schriftlich an mein Publikum zu wenden – und ich traf diese Entscheidung nicht leichten Herzens; zum ersten Mal scheint es mir in einer solchen Situation notwendig, auf die Ehre oder das Schicksal, das man einem meiner Bücher angedeihen lässt, zu reagieren.
Zwei ebenso unergründliche wie dringliche Gründe haben mich dazu bewogen.
Der erste ist der, dass ich einen Preis entgegennehmen darf, der den Namen eines lebenden Autors trägt – damit will ich sagen, eines Autors, der durch die heutige Lektüre zu einem Lebenden, einer Lebenden wird, sei er oder sie auch angeblich vor siebzehn Jahren gestorben… Und vielleicht muss ich auf eine erste stumme Widerrede eingehen, die sich doppelt regt gegen dieses «sei er oder sie» und das «angeblich»: Man möge mir freundlichst glauben, dass ich, wenn ich Alice Rivaz einen «Autor» nenne, nicht im Geringsten vergesse, was sie bewegte und was ihre Identität ausmachte, und noch weniger, was sie Innovatives, im wahren Wortsinn «Unerhörtes» über Genus und Numerus, über die Stellung der Frau geschrieben hat. Aber diese Reduktion des Genus auf das Geschlecht, im Leben wie in der Grammatik, war gerade nicht ihre Art in der Kunst, der Literatur, Wörter, von denen niemand annehmen würde, sie seien speziell den Frauen vorbehalten, nur weil sie feminin sind.
Bleibt also dies: Für mich, der ich heute Alice Rivaz lese, ist sie nicht gestorben – während zahlreiche Autoren, die vorläufig noch am Leben sind und die nicht an sich halten können, uns dies zu verkünden, nicht so sehr in ihren Büchern als in ihren anderen Dienstleistungen (ich meine damit die Leistungen, die sie im Dienste des Unterhaltungsmarkts vollbringen, den Alice Rivaz verabscheute) mir ehrlich gesagt tot und begraben scheinen; Gott habe sie selig.
Mein zweiter Grund, mich der Pflicht dieser öffentlichen Dankesrede, die für mich nichts Formelles hat, schriftlich zu stellen, ist noch unergründlicher und dringlicher als der erste. Er liegt darin, dass von meinem Vater die Rede sein wird in dem, was ich über Alice Rivaz sagen möchte. Auch wenn mein Vater, dem ich «Plaine des héros» gewidmet habe, uns seit über einem Jahr nicht mehr hören kann, stelle ich mir vor, dass er nun meine Bücher liest, wie er gelegentlich, so glaube ich, Alice Rivaz las, die während einiger Jahre unter dem Namen Alice Golay seine Kollegin war im Bureau international du travail BIT, der internationalen Arbeitsorganisation IAO, im wunderschönen Gebäude am Seeufer, das Georges Épitaux zwischen 1923 und 1926 errichtete; seine Kollegin also, bis zum Jahr 1959, in dem sie vorzeitig in Rente ging, genau in dem Alter – 58 Jahre –, in dem mein Vater sich ein Vierteljahrhundert später ebenfalls pensionieren liess; und ich bemerke soeben, dass mich dieses Alter umso mehr berührt, als ich 1958 geboren bin und 58 Jahre alt werde…
Die IAO, ihr Park und ihr Gebäude (unterdessen leider, Ironie der Geschichte, die auch ein Realitätseffekt ist, Sitz der WHO), wo ich mich erinnere, als Kind wohl tausendundeinmal meinen Vater besucht zu haben, beschreibt Alice Rivaz in «Das Wellental»:
Weniger als eine halbe Minute später befand sie sich wie jeden Morgen um diese Stunde am Rand des alten Parks, in welchem sie das grosse Gebäude erwartete, das einen wenn nicht vorrangigen, so doch wichtigen Teil ihres Lebens beherbergte, da sie ihm seit Jahren den grössten Teil ihrer Tage widmete. Unter dem dunkelgrauen Himmel, an welchem Häher und Raben kreisten, bot es einen überraschenden, fast ungewöhnlichen Anblick, einsamer und von der Stadt weiter abgelegen denn je, eine Art am Ufer gestrandetes Gespensterschiff, teilweise von mächtigen Bäumen verdeckt, mit einer Reihe erleuchteter kleiner Bullaugen, die wie flackernde orange Kerzen durch die wirren, nackten Äste blinkten, ein Zeichen dafür, dass im ersten Stock, in der Schreibmaschinenabteilung, bereits der Geschosshagel der Tasten knatternd auf die Walzen niederging. Doch da waren viele erleuchtete Fenster, und im Park standen schon mehrere Wagen von Beamten unter den Bäumen.1
Ich grüsse die Gestalt meines Vaters, über seine Schreibmaschine gebeugt hinter einem dieser orangen Bullaugen, Tag und Nacht, während sein VW, ein blauer, dann weisser Käfer, mit dem Nummernschild GE 56 58 6 auf ihn wartet im Park, unter den Bäumen, und ich auf ihre Rückkehr lauere (die des Vaters und des blauen Käfers) zwei Kilometer weiter oben, in der Rue de Vermont 52, in diesem Quartier des rechten Rhoneufers und der internationalen Institute, einem der schönsten Handlungsorte für Alice Rivaz’ Romane und Kurzgeschichten.
Folgendes schrieb ich übrigens meinerseits in «La réfutation»2 und in einem Gemeinschaftsband, der in «L’aire bleue» erschien, der Reihe, die alle Romane von Alice Rivaz neu auflegte, welche ursprünglich bei grossen französischen Verlagen (Juillard, José Corti, Gallimard) und auch Schweizer Häusern (angefangen bei der Büchergilde) erschienen waren.
Seit ich elf Jahre alt bin, fülle ich Hefte, gehe einer Frage ohne Antwort nach: Ich wusste seit jeher, dass ich im Schatten des Namens von meinem Vater schrieb; dass ich an meines Vaters Stelle und ihm zugewandt schrieb. Als ich zwölf bin, schreibe ich vierzig Geschichten des «Kleinen Nick» in Nachahmung von Goscinny und Sempé. Mein Vater schlägt mir vor, sie auf der Schreibmaschine abzutippen. Ich wage es nicht, ihn darum zu bitten, unter jede Geschichte meinen Namen zu setzen, aber ich unterschreibe das Inhaltsverzeichnis. Ich signiere mit meinen Anfangsbuchstaben die spärlichen Illustrationen mit grauem Farbstift. Die erste Geschichte heisst «Das Buch».
Jeden Abend warte ich darauf, dass mein Vater vom Büro nach Hause kehrt, und halte Ausschau nach der beigen Mappe, welche die Geschichten des «Kleinen Nick» enthält, in Schreibmaschinenschrift, wie es sich gehört. Ist da ein Tippfehler, flehe ich meinen Vater an, die ganze fehlerhafte Seite nochmals in die Tasten zu hämmern. Ich ertrage keine einzige handschriftliche Korrektur. Genauso wenig ertrage ich das weisse Tipp-Ex, das schwarz wird, wenn man das Blatt gegen das Licht hält. Mein Vater ruft aus, ich sei ein Pedant. Er versteht nicht, dass ich ihn dermassen tyrannisiere. Schliesslich tut er jedoch, was ich verlange.
Während seines ganzen beruflichen Lebens arbeitete mein Vater bei der IAO. Er nutzte die toten Stunden, um meine Geschichten des «Kleinen Nick» auf der Schreibmaschine zu tippen. Was bedeutete eigentlich IAO? Das hiess immerwährende arbeitsfreie Oase, sagte mein Vater, der am 21. Oktober 2014 in die IAO zurückkehrte.
Wo kann ich mich seither niederlassen? Wo richte ich meine Schreibstatt ein?
Ich glaubte, Alice Rivaz’ Werk zu kennen, hatte ich doch einst wie alle, in Wahrheit wie wenige, «La paix des ruches» (Der Bienenfriede), «Comptez vos jours» (Bemesst die Zeit) und «Jette ton pain» (Schlaflose Nacht)3 gelesen. Ich glaubte, sie zu kennen, weil vor etwa zwanzig Jahren Markus Hediger, ihr Übersetzer, der damals einen meiner Romane übersetzte, der einzige, der auf Deutsch erschien, «Un homme exemplaire» (Ein vorbildlicher Mann4), mir voller Bewunderung von seinen Besuchen bei ihr erzählt hatte, in Genthod, in einer sogenannten Seniorenresidenz, einige Steinwürfe davon entfernt, wo ich heute wohne, an der Route de Valavran; es ist davon die Rede in «Plaine des héros».
Diese trivialen Zufälle sind nicht belanglos, sie bilden, unter dem Gedächtnis oder dem Geist eines jeden, den Stoff, aus dem, wie in Alice Rivaz’ Erzählungen und Romanen, Gespenster erstehen, Gestalten, Figuren, die uns ähneln, die uns prägen, wie ein Schriftzug, ein Charakterzug uns prägt, und uns dennoch befreien, ja, ich wähle das Wort mit Bedacht, von unserer bürgerlichen, beruflichen, sexuellen, familiären, nationalen usw. Identität, so wie Alice Golay sich befreite unter dem Namen von Rivaz, nicht einfach irgendein Name und natürlich nicht einfach ein Dorf, sondern das, was man in der Literatur eine Stimme nennt – und die sind selten, so viel ist sicher, man kann sie, wie die Tage, an den Händen abzählen…
Ich hatte also eine oberflächliche Vorstellung von Alice Rivaz’ Werk, das ich für persönlich und tiefgründig hielt, Wegbereiter des Feminismus (was wurde nicht alles darüber gesagt, auch Missverständliches: Nein, nicht nur die Bücher, sondern auch die Standpunkte von Simone de Beauvoir und Alice Rivaz haben nicht viel gemein – ist mir übrigens klar ersichtlich, auf welche Position sich der Biber5 stellte, so bezweifle ich, dass Alice Rivaz überhaupt einen Standpunkt einnahm), das ich auch für ein Werk der Selbstbeobachtung hielt, und damit in der Nachfolge von Jean-Jacques Rousseau, unterwegs auf der angeblichen «inneren Suche», von der man mir schon die Ohren vollschwatzte, als ich meine ersten Bücher schrieb, mit siebzehn oder achtzehn Jahren.
Ich habe etwas ganz anderes entdeckt, als ich in den letzten Wochen das erstaunliche Diptychon las, das die beiden Romane «Comme le sable» (Wie Sand durch die Finger) und «Le creux de la vague» («Das Wellental»)6 bilden. Eine Sprache, zuerst einmal, deren Präzision, Musikalität, deren Sog und Ironie, ja wirklich: Ironie, einen umhaut. Dann die Themen, «psychologisch», wenn man will, oder eher analytisch, die an die grössten Autoren des 20. Jahrhunderts denken lassen, bald an Virginia Woolf, bald an Proust und Gide, vielleicht auch an Stefan Zweig oder sogar früher noch an Goethe und Tolstoi – konstante Bezugspunkte – oder dann, später, an eine richtige Zeitgenossin von Alice Rivaz, die ihr meiner Meinung nach näher steht als Simone de Beauvoir: Nathalie Sarraute. Und wenn ich ohne Unterschied Autoren französischer, englischer, deutscher und russischer Sprache anführe, so geschieht das nicht zufällig. Es sind Modelle für ihr Unterfangen, das tatsächlich nichts mit Literatur des «Terroirs» zu tun hat, wie heute, mit kosmischer Naivität, unsere Geschichtenerzähler sagen würden, seien sie nun begabt oder nicht, vom Kommerz getragen, von der Organisation des Welthandels, und was ich so nenne, ist diesmal nicht die Institution, um das zu bezeichnen, was ihnen fern liegt, wie sie meinen. Doch wissen sie wirklich, woher sie kommen und wohin sie noch gehen könnten, sie, die bereits zu gut wissen, wohin sie es gebracht haben?
Mir scheint auch, Alice Rivaz’ Bücher hätten nicht viel zu tun mit der unauffindbaren «Literatur der Romandie», wie man vor dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts versuchte, sie neu zu definieren oder sogar zu vergegenständlichen, manchmal mit Erfolg, oft mit Talent. Im Gegenzug haben sie sehr viel, ja alles zu tun nicht nur mit der zeitgenössischen französischen, sondern auch mit der europäischen Literatur. In der Tat: Alice Rivaz ist eine europäische Romanautorin des 20. Jahrhunderts, die sich um das Schicksal des Kontinents sorgt, wie man es im Völkerbund, in der IAO und später in der UNO tat; und sie macht sich von innen her darüber lustig, sie erforscht den Graben zwischen Alice Rivaz, der Schriftstellerin, und Alice Golay, der IAO-Angestellten, aber auch der Tochter des Waadtländer Sozialistenführers.
Aus diesem Blickwinkel muss man, so glaube ich, ihr Werk heute lesen, angefangen bei ihrem ersten Buch, «Nuages dans la main» (Wolken in der Hand), auf dem Hintergrund des spanischen Bürgerkriegs, über den sie in einem Vorwort von 1987 schreibt:
Während all dieser Jahre vor dem bewaffneten Weltkonflikt, welcher der Menschheit fünfzig Millionen Leichen einbrachte, hatte ich an eine meiner Bürowände eine riesige Europakarte gehängt, und meine Kameraden und ich warfen jeden Morgen einen angstvollen Blick auf Spanien. […] Ich steckte kleine Fahnen auf die Kampfstellen, was mir erlaubte, das Vorrücken oder Zurückweichen der beiden beteiligten Armeen zu verfolgen… 7
Man erinnert mich daran, dass es im ersten Manuskript von Alice Rivaz, das offenbar zerstört ist, um die Gewehrsalven des 9. Novembers 1932 im Genfer Quartier Plainpalais ging. Und in «Das Wellental», dessen Handlung im März 1933 spielt, sind unter anderen entscheidenden Andeutungen folgende Zeilen zu lesen:
«Nein, nein», sagte er, «man darf nicht glauben, da sei nichts zu machen, Hitler werde von allein stürzen… Im übrigen gibt es keine rein nationalen Probleme mehr… Das beweist das Massaker vom letzten November hier bei uns… Aus diesem in unserem politischen Leben unerhörten Vorfall hat man noch nicht alle Lehren gezogen… Das übersteigt unsere kleine Lokalpolitik bei weitem… Die Gegebenheiten sind da oder werden bald da sein zu einer Machtergreifung der Rechtsextremen bei uns… Es braucht nur eine günstige Gelegenheit…»8
Wer hier spricht, ist Berthold, und Böswillige könnten Alice Rivaz verdächtigen, an Bertolt Brecht gedacht zu haben…
Ich hatte «Das Wellental» nicht gelesen, ganz gewiss einer der grossen Romane, die in Genf spielen, und ich wusste natürlich nichts davon, dass es im ersten Manuskript von Alice Rivaz um die Gewehrsalven in Plainpalais ging, und folglich um Antisemitismus und um den Genfer Faschismus der zwanziger und dreissiger Jahre, wie sie Georges Oltramare und seine Nationale Union verkörperten, als ich die Niederschrift von «Plaine des héros» unternahm, dessen Ausgangspunkt derselbe ist – und vielleicht auch der Endpunkt oder der Fluchtpunkt, der sehr weit weg von Genf liegt, in Auschwitz, in Sigmaringen, in Moskau und in den grossen sowjetischen Ebenen… Aber dass mein Buch heute ein Echo sein könnte, in seinem Wirklichkeitsbezug, auf dieses verlorene Manuskript – sechzig Jahre später –, ist für mich ein Glücksgefühl, und dieses Glück verwirrt mich, eben wie ein Realitätseffekt, von der gleichen Art wie jener, der mich aus den Schuhen kippte, als ich vernahm, dass Georges Oltramare, der «schöne Géo», 1942 auf Radio Paris als Moderator der antisemitischen Satiresendung «Die Juden gegen Frankreich» ein Pseudonym gewählt hatte, das heute widerhallt (man wagt beinahe zu sagen, es habe keinen Staub angesetzt): Charles Dieudonné. Genau, Dieudonné, wie der andere, der in Genf so viele Bewunderer hat.9
Das Irrationale der antisemitischen Besessenheit und ihre mörderischen Konsequenzen, die mitten in einem «Familienroman» hervorbrechen: das ist, in einem Satz gesagt, das Thema von «Plaine des héros», das weit über den Fall von Georges Dunant und seine drei Väter hinausreicht: Paul Dunant, der gesetzlich anerkannte Vater, Vertreter des IKRK in Terezin, Oltramare, sein Fast-Adoptivvater, Literat und faschistischer Propagandist, und Casimir Oberfeld, sein leiblicher Vater, der auf dem Marsch der Zwangsevakuierung aus Auschwitz verstarb. Bei der Lektüre von «Wie Sand durch die Finger» und «Das Wellental» entdecke ich nun, dass Alice Rivaz auf rigorose und gespenstische Art das Bühnenbild für eine solche Geschichte erstellt hatte und dass sie wie ich in den versteckten Bildwinkeln, bis nach Champel, auf den Fassaden des Bourg-de-Four oder im Treppenaufgang der Degrés-de-Poule10 die Handzettel bemerkt hatte, die Oltramare, seine Kumpanen und seine Schergen dort aufpinnten, ihr wisst schon: «Nieder mit den Juden». Oder sogar, beispielsweise: «Schluss mit Fairplay. Wir nehmen Geiseln. Dieses Gesindel wird uns nicht beherrschen.»
Die Schriftsteller sind heute mehr denn je fast unsichtbar, fast unhörbar, fast unerhört – mehr noch, als Alice Rivaz es war. Und wenn sie es noch nicht zur Gänze sind, dann deshalb, weil es Leser gibt, die dies wissen und die also die Unsichtbarkeit, welche die erzählende Stimme charakterisiert, zu vernehmen wissen.
Ausgezeichnetes Werk: «Plaine des héros.» (Paris: Fayard, 2015)
«Das Wellental». Roman, aus dem Französischen von Markus Hediger. Basel: Lenos, 2001, S. 37. ↩
Die Widerlegung. Paris: Seuil, 1996 (Vevey: L’aire, 2011). ↩
Respektive 1947, 1966 und 1979 erschienen. Auf Deutsch «Der Bienenfriede», übersetzt von Marcel Schwander. Zürich: Benziger, 1976 (Basel: Lenos, 1993), «Bemesst die Zeit», übersetzt von Marcel Schwander. Zürich: Ex Libris, 1976 (Basel: Lenos, 1993), «Schlaflose Nacht», übersetzt von Markus Hediger. Basel: Lenos, 1994 (Zürich: Tamedia AG, 2005). ↩
Französisch: Paris: Seuil, 1984, Deutsch: Basel: Lenos, 1994. ↩
Simone de Beauvoir hiess bei ihren Freunden «Le Castor», der Biber (Beaver-Beauvoir) (Beaver-Beauvoir). ↩
Respektive 1946 und 1967 erschienen, beide übersetzt von Markus Hediger. Basel: Lenos, 2000 und 2001. ↩
Lausanne: La guilde du livre, 1940 (Vevey: L’aire, 2008). Aus dem Französischen von Markus Hediger. Frauenfeld: Huber, 1992. Das Vorwort wurde nicht in die deutsche Ausgabe aufgenommen. ↩
«Das Wellental». Roman, aus dem Französischen von Markus Hediger. Basel: Lenos, 2001, S. 355–356. ↩
Dieudonné ist ein französischer Komiker, dessen rechtsextremistische und antisemitische Auftritte auch in der Westschweiz ein Publikum finden. ↩
Quartier, berühmte Altstadtstrasse und überdachte Passage in Genf. ↩