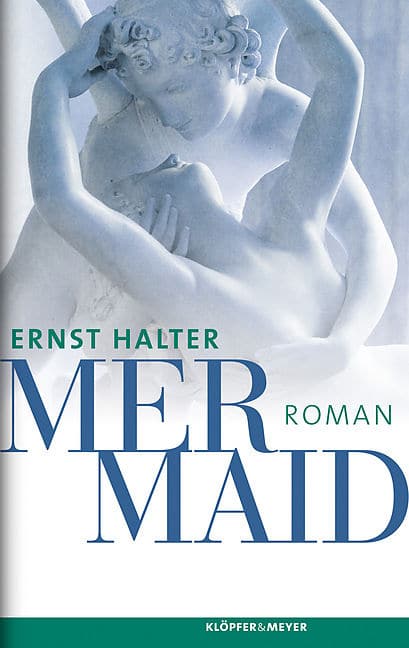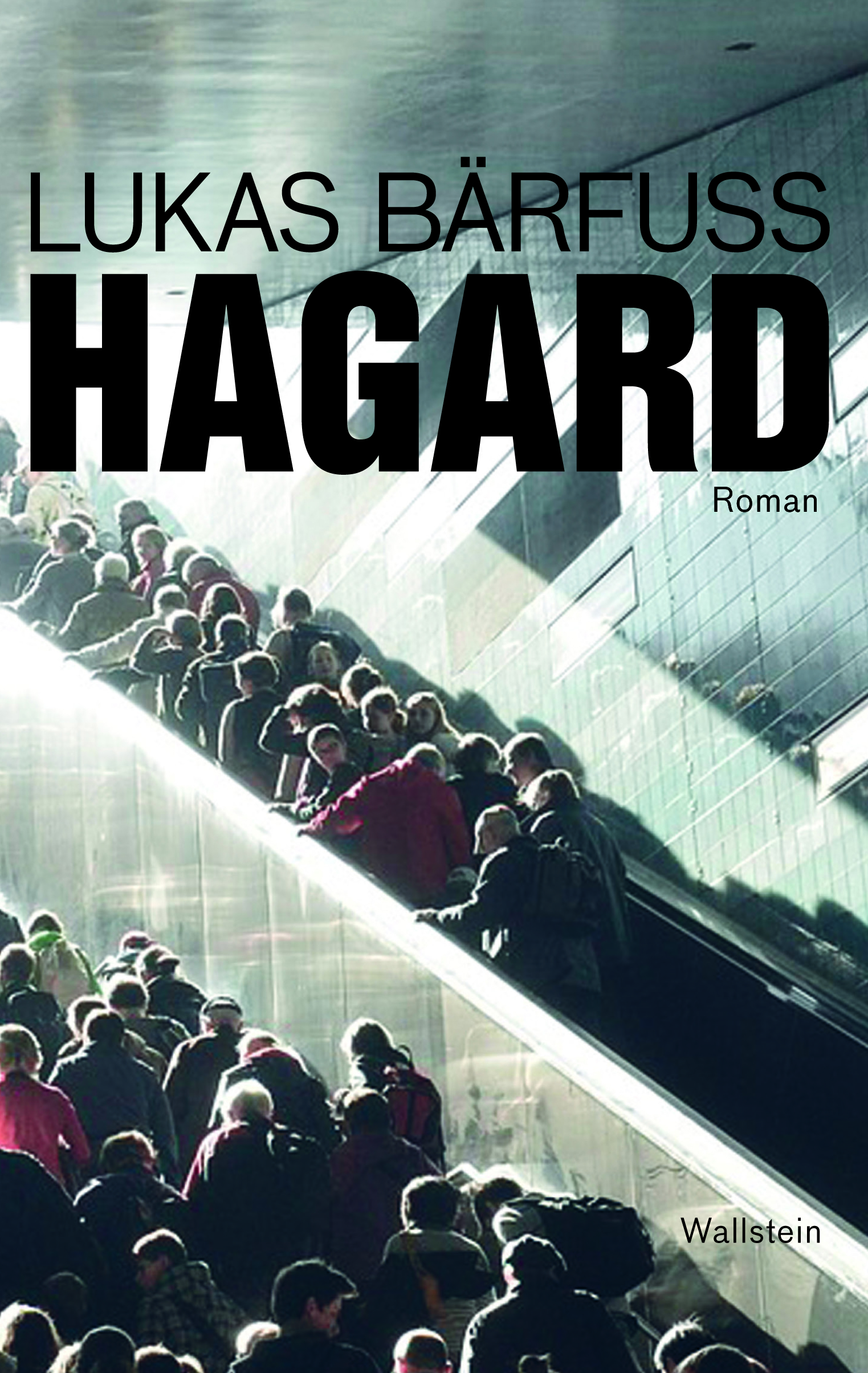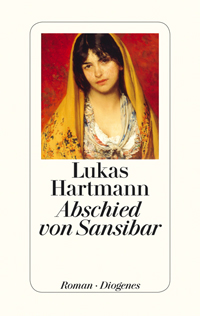Ruth Schweikert oder Die Macht und Ohnmacht des Kleinen
Eine Würdigung der Autorin.

Ruth Schweikerts Bücher erscheinen in grossen Abständen, die selbst eine Geschichte generieren. Spätestens seit ihrem Roman «Augen zu» (1998) ist ihr Rang etabliert, so dass die Kritik jeder Neuerscheinung mit demonstrativer Erwartung entgegensieht, um diese dann als enttäuscht zu erklären, als habe die Autorin ihr Publikum mutwillig auf die Folter gespannt. Dass sie den erwarteten Bestseller wieder nicht geschrieben hat, wird dann zur self-fulfilling prophecy. Man gesteht ihr mildernde Umstände zu; sie hat fünf Kinder zu ernähren, was nur mit sogenannter Nebenarbeit zu schaffen ist. Da ihre Auftritte immer substantiell sind, erreicht sie eine öffentliche Präsenz, die sie für politische, auch kulturpolitische Anliegen durchaus zu nutzen versteht. Man kann sie als Muster einer (immer noch) engagierten Autorin malen, als Sprecherin für ein eigenwilliges Frauenbild, die geradezu dazu einlädt, ihrem nächsten Buch jene hohe Erwartung entgegenzubringen, um dann – siehe oben. Man unterschiebt ihr das Szenario einer gejagten Danaide, die immerfort Wasser in ein Sieb schöpfen muss; das Maliziöse daran bleibt, dass das Strafmass in ihrem Fall den Ansprüchen entnommen wird, die sie an ihre eigene Arbeit stellt, während man sich anderswo mit leichter Süffigem begnügt, einer «guten Geschichte», «authentisch» serviert. Schweikert aber, die exponierte, auch gebildete Autorin, muss es darauf angelegt haben, sperrige Bücher zu schreiben; dafür soll sie dann auch die Kosten tragen. Und weil auch die Kritik heute unter Kostendruck steht, leistet sie sich immer weniger Zweifel zugunsten widerständiger Texte. Sie dürfen nicht «gelungen» sein.
Und in der Tat: im Spiegel der Literatur kann das Leben auf unserer Welt nicht gelungener aussehen, als es ist. Und wenn ein Autor älter wird, kann seine Fähigkeit abnehmen, sich über das Defizit zu täuschen. Nur: das einzige, was er an Tatsachen ändern kann, ist die Wahrnehmung. Ihr Einzugsbereich hat sich bei Schweikert mit dem Älterwerden nicht verkleinert, im Gegenteil. Ihr neuer Roman übergreift, wie die «Buddenbrooks», mehrere Generationen, aber die Bewegung darin lässt sich weder als Auf- noch als Abstieg beschreiben; nicht einmal als Ende der Familienstruktur, auch wenn die Auflösung des bürgerlichen Modells unübersehbar ist. Aber das Bedürfnis danach bleibt umso hartnäckiger, je weniger intakt es ist. Nur: wann wäre es das je gewesen? Schweikert registriert, dass der Umgang mit Defekten nicht nur neuer Ehrlichkeit bedarf, sondern auch neuer Lügen. Kein Betroffener, Frau oder Mann, wird von Geheimnissen entbunden, es gibt nur andere Zonen der Geheimhaltung, und diese verlangen ihre Opfer, nach wie vor. Unsere Freiheit, dass wir wenigstens wählen können, was wir opfern, bleibt Einbildung und vereitelt nicht nur das Gelingen realer Beziehungen, sie affiziert auch ihre Erzählung.
Im Misslingen von Fiktionen scheint ein Hindernis aus anthropologischer Tiefe durchzuschlagen: Der Mensch ist das Tier ohne Programm; es hat gelernt, die Überschreitung seiner Grenzen als Fortschritt zu betrachten, und erkennt sie immer erst, wenn es zu spät ist. Darum enthält das delphische Orakel «Erkenne dich selbst» eine unmögliche Forderung – aber die Kunst muss sie immer wieder vorführen. Denn anderseits scheint gerade die Begierde nach dem Unmöglichen die Bedingung dafür zu sein, dass wir dem uns Möglichen begegnen – im Besten wie im Schlimmsten. Die Moral möchte wenigstens eins vom andern unterscheiden; die Kunst beweist: das geht nicht; nicht einmal das.
An der ETH Zürich war Ruth Schweikert vor zwei Jahrzehnten eine ebenso unauffällige wie unübersehbare Teilnehmerin des Kurses «Schreibarbeit» (später hiess er, nach Max Frisch, «Holozän»). Wir diskutierten den Umgang mit selbstverfassten literarischen Gegenständen, wofür die Hochschule in einer andern Abteilung physikalische Modelle zu bieten hatte. Da war etwa zu lernen, dass wir kleinste Teilchen der Materie nicht messen können, ohne sie durch das Messinstrument zu verändern. Wenn aber das Objektiv das Objekt definiert, hat dieses aufgehört, Gegenstand exakter Forschung zu sein. Ein vergleichbares Dilemma kennt die Kunst schon länger, denn auch bei ihrer «Nachahmung der Natur» stellt sich regelmässig heraus, dass uns dieser Spiegel kein «Ding an sich», sondern ein Bild unserer Intention liefert, das wir mit feststehenden Tatsachen verwechseln. Natürlich schaffen wir damit auch wieder Tatsachen, denn was wir sehen und wie wir es sehen, hat durchaus reale Folgen für das, was wir (unheilbar anthropozentrisch) «Umwelt» nennen – nur sind sie inkalkulabel.
Damit befinden sich Quantenphysik und Literatur gemeinsam in Opposition zu den Annahmen des Rechners, der gerade in der Periode unserer damaligen Schreibarbeit seinen Siegeszug als Universalwerkzeug der Globalisierung antrat – und als alleinzuständiger Abbilder einer neuen Weltordnung von Gnaden des Marktes. Allerdings kann der Rechner nur messen, was ihm gleicht. Das Bild der Welt, das er, mit Hilfe beliebig hochzurechnender Null-Eins, Entweder-oder-Entscheidungen, konstruiert, verlangt kompatible Mitspieler und quantifizierbare Verhältnisse. Der einzelne, die Einzelheit sind für die Statistik quantités négligeables. Aber mit ihnen steht und fällt die Literatur, und nicht nur sie: kein Mensch lebt oder stirbt nach der Statistik.
Der Markt sollte in unserer «Schreibarbeit» nichts zu suchen haben. Dennoch: er sprach schon diskret, aber deutlich mit, wenn wir unsere Texte taxierten. Bei Ruth hatte ich nie einen Zweifel, dass sie nicht nur begabt war, sondern auch professionell, das heisst: eigensinnig und rücksichtslos mit sich selbst beschäftigt, aber nicht mit dem lieben Ego und seinen Lebensumständen, sondern mit der Form ihrer Erzählbarkeit. Für ihre Sprache musste es eine Öffentlichkeit geben, und der dafür nötige Sinn für Qualität, Widerstand und Markt kam damals bei Egon Ammann zusammen. Bevor sein Verlag verschwand, hatte er Ruth Schweikert bekannt genug gemacht, dass sie bei S. Fischer unterkam – man kann ihr dazu nur viel Glück wünschen. Denn immer weniger könnte sie, auch wenn sie es wünschte, ihre Stichproben der Realität zu einem übersichtlichen Befund summieren, einer deutlichen Entwicklung, einer eindeutigen Dramaturgie. Der Widerstand gegen die Fabel hat immer mehr Mühe, das Glück einer Autorin zu machen. Aber: natürlich handeln auch Schweikerts Bücher von Glück, dem pursuit of happiness, und seinem normalen Absturz in Verzweiflung – nur ist es ihre Sprache, die, bei aller Findigkeit und Trennschärfe des Ausdrucks, beide als Motive wie alle andern behandelt. Sie unterscheidet nicht zwischen kleinen und grossen Gegenständen, diese Hierarchie könnte vor ihrer Erfahrung nicht bestehen, die ihr sagt, dass über Glück und Unglück immer noch sehr wenig ausgemacht ist. Was Menschen unter sich ausmachen, unterliegt, bestenfalls, dem Vorbehalt intelligenten Unwissens. Die Autorin könnte Verhältnisse zwischen Mann und Frau, Eltern und Kindern, Jungen und Älteren nur mit Willkür ordnen, und die ist ihre Sache nicht. Gewiss kann auch sie Konventionen nicht entbehren, aber diese bleiben Krücken, mit denen wir uns und andere über unsere (und ihre) Invalidität täuschen wollen. Den Tänzen, die wir dabei aufführen, kann man mitleidig oder belustigt zusehen; die Betrachterin – das heisst: Erzählerin – nimmt sich selbst nicht aus. Die Bühne wird scharf beleuchtet; die Schnüre aber, an denen hier getanzt wird, verschwinden im Dunkel. Sind die Knoten, zu denen wir uns verstricken, Teil eines Netzes oder einer Falle? Sie sind gewissermassen aus lauter Leitfäden gewirkt, aber da sie sich miteinander verwirren, scheinen sie eher dafür geschaffen, ins Labyrinth hineinzuführen als hinaus – vielleicht sind sie das Labyrinth. Schweikerts erzählte Figuren wollen fast immer nur das Beste, verwirken es gerade so und scheinen zu beweisen, dass Kunst nicht einmal (wie Benn gespottet hat) das Gegenteil ist von gut gemeint, sondern etwas ganz anderes.
Ruth Schweikert fabuliert nicht, sie teilt dem Leser viel eher – durchaus unfreiwillig – ihre Allergie gegen voreilige Urteile, gefabelte Konventionen mit. In ihren Texten versucht sie mit dem Sowohl-als-auch menschlicher Verhältnisse fertig zu werden – oder wenn nicht: bitte keine Tragödie. Nichts an unserem täglichen Leben funktioniert digital, auch wenn die Autorin bei ihren Auftritten oft den Computer vor sich hat. Denn auch Missverhältnisse sind – wie alles, worin wir unsere Finger haben – relativ. Das heisst aber wiederum: beziehungsfähig. Dass der Raum zwischen Figuren, wenn sie die persönlichsten Erfahrungen abbilden, so offen bleibt, macht ihn nicht zum Niemandsland der Literatur. Genau dieser Raum ist ihr Arbeitsplatz, ihr Testgelände, diesem Offenen muss jede Einzelheit (und mit ihr steht und fällt die Kunst) ausgesetzt werden, damit sie in jene Schwingung gerät, die den Leser erreicht und bewegt: was er liest, ist ja ganz anders – wie er selbst.
Auch der Teilchenphysik sind die kleinsten Objekte ihres Interesses nicht einfach durch ihre Unmessbarkeit abhandengekommen. Vielmehr waren sie stark genug, die Grundlagen der Wissenschaft zu transformieren. Heisenbergs 1927 formulierte Unschärferelation wies nach, dass die Mehrdeutigkeit der Materie – ovidisch gesprochen: ihr Zeug zur Metamorphose – prinzipieller Natur ist und dass die Komplementarität elementarer Teilchen sogar unabhängig von unserer Raumzeit besteht. Für den Laien, wenn er Literat ist, heisst das so viel, dass einerseits dasselbe zu ganz verschiedenen Zeiten geschehen kann, dafür ereignet sich am selben Ort (und im selben Menschen) gleichzeitig Grundverschiedenes.
Ich wüsste nicht, wie sich Ruth Schweikerts neuer Roman «Wie wir älter werden» besser zusammenfassen liesse. Auf das «Wie» kommt es an, jene Form, die Goethe «ein Geheimnis den meisten» genannt hat. Von diesem Wie allein lebt die Literatur, wenn sie lebt. In dieser Form vermute ich jene «schwache messianische Hoffnung» Walter Benjamins, dem Ruth Schweikert die Erzählung «Port Bou» gewidmet hat. Seither glaube ich nicht mehr, dass sie eine bedeutende Autorin ist. Ich weiss es.
Ausgezeichnetes Werk: «Wie wir älter werden.» (Frankfurt a. M.: Fischer, 2015)