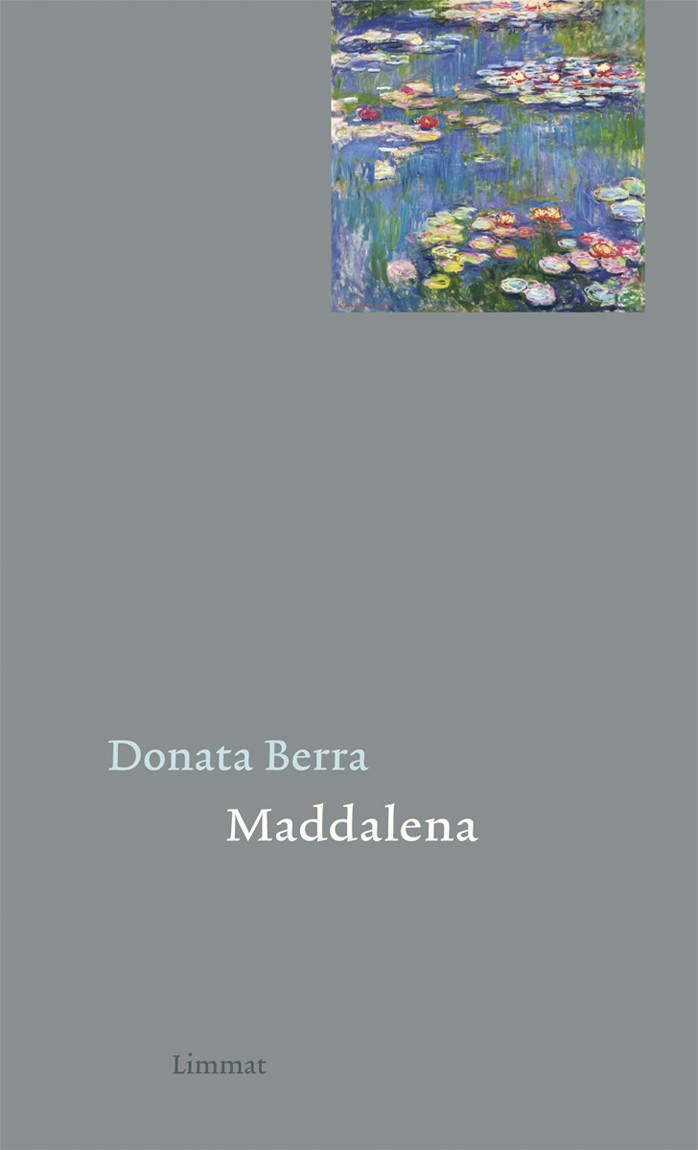
Donata Berra: «Maddalena»
Kundig geführt durch den Silbenwald.
Es liegt im Anspruch einer Zeitung, Wahres zu berichten. Gilt dies auch für eine Literaturzeitschrift? Dann müsste hier über die Gedichte von Donata Berra, Lyrikerin und Übersetzerin aus Mailand, wahrheitsgetreu und sachlich Auskunft gegeben werden. Doch wie soll das gehen, wenn die Welt als ein Mysterium durch die Lyrik Berras kryptisch wiedergegeben wird?
Das Schöne an der Lyrik liegt in ihren Lesarten: hier das oft vernachlässigte vordergründige, dort das hintergründige Lesen. Bevor man sich im Metaphernlabyrinth verirrt, erfährt man vordergründig von einem Diebstahl in Berras gleichnamigem Gedicht («Furto»). «Was ich gestohlen habe», verkündet darin das lyrische Ich, «gebe ich nie mehr zurück.» Über das «Was» schweigt es sich aus und berichtet, die Zeugen des Diebstahls hätten nicht mehr zu sagen gewusst, als dass sie nicht mehr Herr ihres Blickes waren.
Wer hat hier – hintergründig – was gestohlen, und wessen Augen waren ausserstande zu sehen? Und was ist es, das in der Dichterin selbst sieht und fühlt und schreibt? Ist das lyrische Ich die Diebin eines Bildes unserer Welt, das nur es sieht und in Worte – ein Gedicht – verwandelt, für das wir anderen keine Augen haben? Und wer ist dann die in so vielen Gedichten, auch in «Diebstahl», wandelnde Anonyma?
Ist sie die Windbraut («la sposa di un dio dallʼanima di vento»), die man umarmen möchte, bevor sie, getrieben von ihrem Windgatten, entflieht, wie im hier zitierten «Sa di pesce il libeccio»? Vordergründig wie auch hintergründig klingt an: Was die Dichterin sieht, verwandelt sie in Geist, es wird unter ihrer Hand zu Worten, zum Gedicht. Was bleibt, schrieb Hölderlin einst, wird von Dichtern gestiftet. Glaubt man dem letzten Gedicht der neuen Anthologie «Maddalena», sinnigerweise mit «Requiem» überschrieben, verlässt uns dieses unbekannte oder unerkannte lyrische Ich: «Unerbittlich löst sich das Band» und was übrigbleibt, ist nur noch «irgendein Bild» und ein «Antlitz ohne Blick». Es verdunkelt die Silben der letzten Worte, und wo kein Sehen und kein Fühlen, da ist auch kein Geist. Ohne Geist – sprich: Spiritus, Atem – keine Worte. Die Dichterin verflüchtigt sich im Gedicht.
Die klangvolle, verschlungene Lyrik von Donata Berra ist für den Leser, was der finstere Wald für den Wanderer in Dantes «Divina Comedia», und noch so gerne würde man sich im Silbenwald einem kundigen Führer anvertrauen. Hierzu bietet sich das Nachwort eines Gleichgesinnten an, des Tessiner Lyrikers Pietro de Marchi – und erst recht die dem Werk in jeder Hinsicht angemessene Übersetzung von Christoph Ferber in dieser zweisprachigen Ausgabe. Er schöpft aus Donata Berras italienischen Originalen deutsche Gedichte, die man mit Fug und Recht als eigenständige Kunstwerke bezeichnen kann.
Donata Berra: Maddalena. Zürich: Limmat, 2019.











