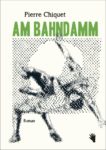Gotthelf in Dolby Surround
Alte Sagen über Gut und Böse, neu verpackt, komplex erzählt: Das war damals Gotthelf – das ist heute Hollywood. Das Horror- und Heimatdrama «Die schwarze Spinne» überspringt Jahrhunderte und erzählt doch immer dieselbe Geschichte. Hier der Trailer, Licht aus, Film ab.

Emmental, 1842
Früh leuchtet an jenem Sonntag die Sonne majestätisch über den Bergen und erhellt die fetten Felder. Stattlich und blank erstrahlt das neue Bauernhaus in magischem, göttlichem Glanz. Mit kräftigen Strichen bürsten die Burschen die Backen der Pferde und beim Brunnen waschen stämmige Mägde ihre rotbrächten Gesichter. Da schlurft der Gross-vater, schweren Atems seine Pfeife schmauchend, über den Hof in die Küche, dort knistert Feuer. Wie bei der Taufe Sitte rührt die Hebamme einen Weinwarm an, mit Safran, Zimmet und Zucker. Im Esszimmer mit dem mächtigen Buffet aus Kir-schenholz rückt schön und etwas blass die Kindsmutter und Hausfrau die reiche Tafel zurecht. Aufgetürmt sind die Küchlein für die Gevatterleute, aufgetischt der Nidel im geblümten Hafen. Daneben dampft der Kaffee in einer glänzenden Kanne, davor liegt das eigentümliche Berner Backwerk, gross wie ein Jähriges und geflochten wie die Zöpfe der Weiber. «Morgen, Gotthelf», ruft der Grossvater einem Mann in den Rücken, der am Tische sitzt. «Sali, Ätti», antwortet der Angesprochene, sich drehend, und fährt verschmitzt fort: «Tausende von Engländern rennen durch die Schweiz, aber weder einem der abgejagten Lords noch einer der steiflichen Ladies ist je so ein Frühstück geworden.» Während im Hintergrund die Bauersfrau hantiert, sagt Gotthelf in die Kamera: «Ein solch Schmaus ist Zeugnis der Familienehre – doch eine einzige unbewachte Stunde kann Flecken bringen, die Blutflecken gleich unauslöschlich bleiben, jeder Tünche spottend.»
Kantonsschule St. Gallen, 1987
Glockengeschrill auf dem Gang durchtrennt das Zwiegespräch der Freundinnen und sie rutschen auf ihren Miniröcken nach vorn. Nicht in der hintersten Reihe, aber hinter Alex, schon im vierten Gymi 195 Zentimeter gross und 130 Kilo schwer. Ruhe breitet sich aus im sonnendurchfluteten Zimmer, und Lehrer Jakob fährt fort. Alsbald ist die Klasse in Wortwolken gehüllt; Binnenerzählung, Rahmenhandlung und jede Menge Vogelgezwitscher. Da ein brünstiger Krähenruf, dort ein Käuzlein an Waldes Saum und Schwalben, die um die Dächer flattern. Eine aufgeregte Fliege tanzt über den Köpfen der Klasse und landet auf dem Reclam-Buch, auf das eines der Mädchen ein Bauernhaus malt, mit einem geschnitzten Herzchen im Giebel. Wie bei jeder Liebe gilt auch beim Lesen: Timing ist alles und knapp 16 kein Alter für eine Erzählung über Gut und Böse aus der christlich-konservativen Feder eines Pfaffen von Lützelflüh. Zu frisch ist, erstens, das Trauma eines nicht enden wollenden Stroms kirchlicher Rituale. Mit Erstkommunion und Firmung der Katholiken hatte es angefangen, fand quälende Fortsetzung im eigenen Konfirmationsunterricht samt Pflichtanwesenheit bei Gottesdiensten, über Monate, und hörte bis zum Tag selbst nicht auf, denn nun heiratet der Cousin. All dies im Teenagertaumel, in dem man mit seinen Wochenenden Besseres anzufangen wüsste. Saufen, knutschen und kiffen zu lauter Musik, auch Minigolf ist okay, einfach möglichst weit weg von der Familie. Und wer sollte sich, zweitens, 1987 für «Augen wie Pflugräder» begeistern, wenn die Welt in kaltem Neon erstrahlt – nach Tschernobyl gar atomar verseucht. Eine offene Drogenszene und T-Shirts mit Iron-Maiden-Monstern prägen das Stadtbild,
«Gender-Bender Desireless» ist Nr. 1 der Jahreshitparade. «Voyage, voyage.» Das lässt sich nicht mit einem Biedermeier-Overkill vereinbaren. Vielleicht ist es wirklich nur ein popkultureller Moment, der zwischen uns und Gotthelf stand. Nur drei Jahre später kam der Giftspinnen-Schocker «Arachnophobia» ins Kino.
Emmental, 1242
Dolby Surround. Christine, das Weib des Hornbachbauern, stürzt einer Wirbelsinnigen gleich den Weg entlang. In ihrem Gesicht kreisen Wehen, wie sie noch keine Wöchnerin erfahren auf Erden. Ihr Hochmut hat sie hierher gebracht, die Lindauerin. Vom Bodensee ist sie gekommen und von Anfang an meinte die Fremde, es laufe nur recht, wenn sie mitrede. Hielt sich für schlauer als der teutsche Komptur Hans von Stoffeln und bot ihm die Stirn. Für schlauer noch als den Teufel, ihm hielt sie die Wange hin – und der küsste sie. An der Stelle schwillt nun eine Spinne in ihrem Gesicht immer höher, immer glühender brennt ihr Gebein. Als ihr Teufelspakt das Dorf vor Not und Elend bewahrte, verschwor man sich noch gerne hinter ihr. Nun, wo es gälte, die Folgen zu tragen, war sie allein. Da ist ihr, als ob plötzlich das Gesicht ihr platze, als ob glühende Kohlen geboren würden in demselben. Da sieht sie in eines Blitzes fahlem Schein langbeinig und giftig unzählbare schwarze Spinnchen gramseln über ihre Glieder, hinaus in die Nacht, und den Entschwundenen liefen langbeinig, giftig, unzählbar andere nach. Christine schreit, dass dem Vieh
im Stalle die Knie schlottern in grausiger Angst. Es begann ein Sterbet, wie man noch von keinem wusste. Das Böse war entfesselt, der Teufel fordert seinen Preis: ein ungetauftes Kind! Schnitt. Ein hochschwangeres junges Weib sinkt nieder beim eindringlichen Gebet. Schnitt. Das verwegene, ahnende Gesicht eines bärtigen Gottesmanns. Es stürmen Gewitter herbei, wie in Menschengedenken nicht oft erlebt. Doch schreitet unerschrocken der mutige Priester aus seiner Kirche hinaus in des Sturmes Wut, durch die brausende Nacht, in seinen Augen lodert heiliger Kampfesdrang. Schnitt. Er erblickt in der Ferne das Böse und beginnt zu laufen. Schnitt. Mit einem Schrei packt er die Riesenspinne und schleudert sie weg. Schnitt. Eiligst tauft er ein Kind auf die heiligsten drei Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes.
Zürich, 2014
Gotthelf, im Ortsmuseum in einer Ecke sitzend, im Hintergrund wird eine Schulklasse vorbeigeführt. Ein zweiter alter Mann rückt ein Anker-Gemälde zurecht. Sagt unvermittelt: «Weisch, Gotthelf, da chrampf ich ein Leben lang für das Wohl des Landes und es ist immer noch wie damals, wo der von Stoffeln und seine Polenritter über die Emmentaler hereinbrachen!» Nein, redet sich der Mann in Rage, alles sei noch viel schlimmer. Der Mörgeli sage es schon richtig: Heute brauche nur noch ein Funktionär aus der EU anzurufen und schon überweise eine Bürokraft in Bern die Kohäsionsmilliarde nach Polen. «Lächerlich!», ruft der Mann an Gotthelf gewandt. «Hat nicht das Volk…», will dieser rhetorisch fragen, wird aber unterbrochen. «Das Volk? Lumpenspiele waren das! Das Volk entscheidet schon richtig, wenn es nicht angelogen oder von fremden Heiden zu einem Handel mit dem Teufel regelrecht genötigt wird. Damals, in deiner Geschichte, hätte ja kein anderer mehr die braven Bauern retten können.» – «Da siehst du nur», lacht der Dichter, «früher war nicht alles besser. Die Emmentaler von heute sollen dankbar sein, einen Tribun wie dich zu haben, den Stöffel von der Goldküste statt den von Stoffeln aus dem Schwabenlande.» – «Recht hesch, die richtigen Schweizer schätzen schon, was ich für sie mache. Ich habe einen Auftrag. Danke, Gotthelf, du hast mir sehr geholfen.» Damit setzt er den Hut auf und mit einem kurzen Gruss ist er weg. Gotthelf überlegt lange, sagt dann in die Kamera: «Ein Fleck, der jeder Tünche spottet.»