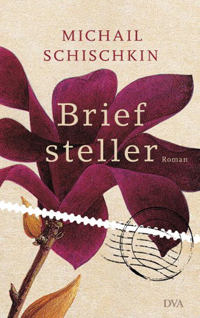
Michail Schischkin:
«Briefsteller»
«Ein grosser, anrührender Liebesroman» von einem «neuen Tolstoi» soll er sein, dieser Roman. So zumindest Buchrücken und Presse. Was lag also näher, als die Lektüre von Michail Schischkins Briefsteller mit Krieg und Frieden im Hinterkopf zu beginnen? Und da es sich hier um einen Briefroman handelt: auch mit ein bisschen vergnüglicher Erinnerung an de Laclosʼ Gefährliche Liebschaften?
Tatsächlich handelt Schischkins neuer Roman von Liebe und von Krieg, von Leidenschaft und Leid. Vom Liebesleid und vom Leid enttäuschter Hoffnungen. Vom Alleinsein, da der Geliebte in den Krieg zieht – und vom Alleinsein in einer erloschenen Beziehung. Aber am eindringlichsten beschreibt der seit 1995 in Zürich lebende Schischkin das physische Leiden, körperliche Schmerzen und schreckliche Verwundungen, die Menschen einander im Krieg zufügen. In einem Krieg, der noch Bajonette kannte und in dem Soldaten noch zu Fuss marschierten.
«Jeder Schritt, den ich hier tue, hat nur deshalb einen Sinn, weil es ein Schritt auf Dich zu ist. Wohin ich auch gehe, ich bin auf dem Weg zu Dir», schreibt Wolodja seiner Geliebten. Und er schreibt von unerträglicher Hitze, sintflutartigen Regenfällen, Entbehrungen und Tod. Und mehr noch als die überzeugend realitätsnahen Schilderungen des tristen Alltags einer alt gewordenen und unglücklichen Frau im Jetzt, von dem Saschenkas Briefe berichten, sind es diese Beschreibungen des Boxer-Krieges, die den Leser hin- und herreissen. Zwischen Faszination und Bewunderung für den Autor einerseits und der Abscheu vor dem so eindrücklich Beschriebenen. Die bildhafte Eindringlichkeit der Sprache erinnert dabei an das Können Elfriede Jelineks: Wer ihre Klavierspielerin gelesen hat, mag bisweilen ihre Gabe verwünscht haben, so schreiben zu können, dass das Erzählte nahezu physisch spürbar wird. Wie es Schischkin hier gelingt, dem Leser so plastisch das Elend der Verletzten vorzuführen, die bei sengender Sonne im Lazarettzelt liegen, schreiend vor Schmerzen und darum bettelnd, man dürfe ihnen nicht die Gliedmassen amputieren, ist mehr als eindrücklich. Auch die Folgen der katastrophalen hygienischen Verhältnisse werden in derart anschaulichen Bildern heraufbeschworen, dass der Leser sich des Eindrucks kaum erwehren kann, gleichsam diese vergiftete Luft zu atmen. Er liest nicht, wie die Ruhr und andere Krankheiten sich langsam zwischen Verletzten, Sterbenden und Toten ausbreiten – er sieht es: «In einer Brandstätte […] wühlten ein paar asche-verklebte Schweine. […] Ein verglommener Arm ragte empor, bekam einen Stoss, die Finger bröckelten ab. Es stank wie die Pest. […] Jetzt habe ich also auch noch gesehen, wie Schweine gebratene Menschen fressen, […] aber wozu musste ich das?»
Wer literarisierte Kriegsgreuel dieser Art verträgt, wird im Briefsteller ein beeindruckend kontrastreiches und sprachgewaltiges Buch finden, eines der besten dieses Literaturherbsts, das sich tatsächlich mühelos über Zeit und Raum hinwegsetzt.
Michail Schischkin: Briefsteller. München: DVA, 2012.











