Unbehagen im Stollen
Wie Karl Schmid den Zweiten Weltkrieg im Gotthard erlebte.
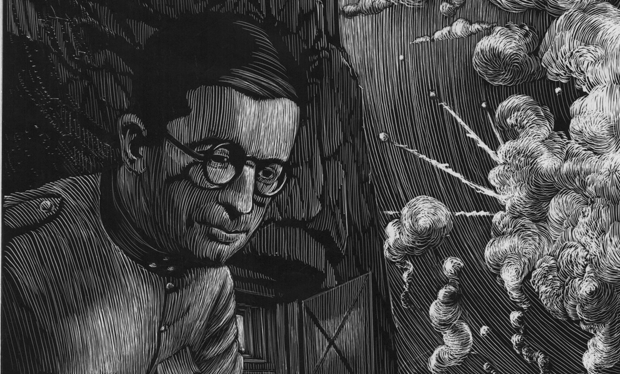
Dieser Krieg hatte etwas Illusionäres. Die generalmobilisierte Armee stand. Sie stand an der Grenze und stand und stand. Es gab keine Gefechte, nur Truppenübungen. Die Schweiz war zum Gefängnis geworden.
Zu den vielen, die im September 1939 ihre Arbeit aufgeben, Haus und Hof verlassen und einrücken mussten, gehörte auch der 32jährige Hauptmann Karl Schmid. Er sollte weder mit dem Feind noch mit Flüchtlingen in Berührung kommen – er sass am und im Gotthard und musste sich bald schon darum kümmern, dass ihm die Mutter Nachthemd, Unterhosen und Rasiercrème in den Stollen schickte. Auch von seiner Freundin Elsie Attenhofer wurde Schmid getrennt. Ununterbrochen dachte er an sie, die Abwesend-Anwesende. Kaum je konnten sie telephonieren, denn die Leitungen, hiess die Order, mussten für militärische Gespräche freigehalten bleiben. Von «unvorstellbar kahlen Kasernenzimmern» aus schrieb Schmid folglich zärtliche Briefe voller Verlangen.
«Du gehst für mich durch die Nacht dieser Tage», teilte er ihr mit und schrieb sich seine Frau so herbei, wie er sie sich wünschte – das Bild seiner Geliebten wurde umso herrlicher, je länger sie ihm, je länger er ihr fernblieb. In Zürich, wo Schmid Lehrer gewesen war, ging das Leben weiter. Dort wartete man nicht auf ihn. Er sah sich durch «Dienstuntaugliche und sogar Ausländer sukzessive ersetzt». Mehr und mehr sah er sich als Opfer. Die Musik spielte im Zivilleben. Dort machten seine opportunistischen Konkurrenten Karriere, während er seine besten Jahre in Bunkern verhockte. Er war der nützliche Idiot. Schmid erkannte in sich bald einen Affekt wieder, der «eine grosse Wurzel des Nationalsozialismus» sei: den Affekt der Heimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg, «die da sagten: ‹Jetzt jagen wir einmal die Schnorrer zum Teufel, die in der Zeit frassen und soffen und vogelten, in der wir dummen Teufel für das Land im Felde standen?›»
Der tatsächliche Militärdienst markierte einen Ort doppelter Provinz und Verlorenheit. Schmid war nicht dort, wo das Leben war, weder zu Hause noch «im Krieg». Äusserlich machte er comme il faut mit, innerlich aber grenzte er sich ironisch ab. Im Dienst war man einsam, aber nicht allein. Schmid litt unter der «Entpersönlichung, der Brutalität der Gemeinschaft», der «Diktatur der Menge». Gleichzeitig war er stolz auf seine militärische Karriere, die ihm bewies, dass er, der Geistige, auch im Praktischen tauglich war.
Nachdem die Deutschen in Belgien und in Holland einmarschiert waren, schrieb Schmid nach Hause, er gehe daran «fast zugrunde». Als auch Frankreich kapituliert hatte, meinte er, «die grössten Revisionen» müssten getan werden. Schon am 15. Mai 1940 schrieb er seinen in Wollishofen lebenden Eltern, er wäre froh, wenn Elsie bei ihnen übernachten könnte statt in Bassersdorf, «es wäre dann doch diesseits der Limmat». Von Wollishofen aus ergab sich nach dem befürchteten deutschen Angriff ein kürzerer Fluchtweg in die Innerschweiz, die man für sicherer hielt…
Besonders aktiv war der Aktivdienst nicht, wenn man das jahrelange Warten nicht als innere Aktivität verstehen will. Die Hauptführungsaufgabe bestand in der dauernden Beantwortung der Frage, wie man die Truppe beschäftigen konnte. Auch Schmid selbst war froh um Aufträge gegen den Dämon der Langeweile. Froh um Befehle, deren Erledigung den Tag füllte und die Seele betäubte. War das Ungeheuerliche dieses transatlantischen Kriegs also ein Schicksal? Ja, aber eines, das auch Alltag und Banalität kannte.
Denn die Schweizer Armee wartete. Und stand.













