Die nicht enden wollende Geschichte
Katja Petrowskaja: Vielleicht Esther. Berlin: Suhrkamp, 2014.
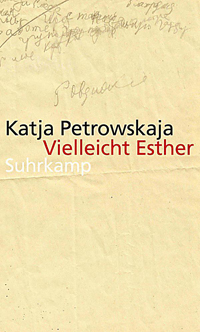
Am Anfang waren Geschichten. Ein paar Episoden, ein Kabinett voll Figuren und Ereignissen, spärlich beleuchtet und kümmerlich unterhalten, aber mächtig genug, ein Leben zu beherrschen. 100 Jahre nach Lenin geboren, ist die Ich-Erzählerin in Katja Petrowskajas Buch «Vielleicht Esther» nicht nur leicht im Koordinatensystem der Weltgeschichte zu verorten, sondern als Nachfahrin ermordeter und entkommener polnisch-russischer Juden auf fundamentale Weise mit dieser verknüpft: Der Zweite Weltkrieg ist der Bodensatz ihres Daseins, die nicht versiegende Quelle, die ihr Träumen wie ihr Denken speist.
In dem Urstrom verfliessen überlieferte Erinnerungen und Erzählungen mit eigenen Emotionen, kaum je mischen sich aber aktive Auseinandersetzung und offene Rede dazu. So wird die junge Frau in den 1980er Jahren immer wieder von einem «Gefühl des Verlusts» umfangen, doch verpasst sie es, rechtzeitig Fragen zu stellen, und steht nach dem Tod ihrer Grosstante vor der nackten Geschichte: Als Informationsträger bleiben ihr nur noch Dokumente und Orte – in die beide sie sich fortan vergräbt.
Diese Ausgangslage ist beileibe keine, die das Buch zu einer Empfehlung macht. Im Gegenteil: Holocaust-Erzählungen und Schreiber(innen), die in dritter Generation dem von Eltern wie Grosseltern unter dem Deckel gehaltenen Grauen nachspüren, hat die Literatur schon so viele gesehen, dass die Konstellation nachgerade abschreckt. Wer aber irgend an die Macht der Sprache glaubt, muss Petrowskajas Suche rettungslos verfallen.
Katja Petrowskaja ist Ukrainerin, sie schreibt aber, seit 1999 in Berlin lebend, auf Deutsch – und damit nicht nur in der Sprache des einstigen Feindes, sondern, so will es das Russische, auch in der «Sprache der Stummen». Stummheit wiederum spielt in ihrer Familie über das Verschweigen des Vergangenen hinaus eine wichtige Rolle: Jahrhundertelang hatten ihre Ahnen als Taubstummenlehrer Kindern «das Sprechen» beigebracht. Und heute bringt Petrowskaja das Deutsche, das sie wie ein «angeklebtes Geschlecht» auf der Zunge trägt, mit wunderbaren Bildern zum Klingen und mit unerbittlicher Präzision zum Sprechen: Als Nichtmuttersprachlerin hinterfragt sie die Routinen unseres Redens und klopft Worte und Wendungen, die uns unbesehen durchgehen, auf unhaltbare Hohlräume ab. Liest sie etwa im Bericht eines Pfarrers, dass sich 1945 eine «nicht enden wollende Kolonne von Juden» auf dem Todesmarsch von Mauthausen nach Gunskirchen befunden habe, kommt sie nicht umhin zu bemerken: «Als stünde es in ihrem Willen, ob es ein Ende hat.»
Ins ganze Buch eingewoben, sind solch feine (Sprach-)Beobachtungen dafür verantwortlich, dass der Text zum dichten Leseerlebnis gerinnt und weder an den mosaikartigen Episoden zerbricht, von denen er in kurzen Kapiteln berichtet, noch in den Seitenästen des Stammbaums versickert, den er ausbreitet. Dieser liefert zwar das Personal aller Geschichten, im Zentrum der Reflexionsräume, die sie öffnen, steht «Verwandtschaft» aber nur insofern, als sie die menschliche Gemeinschaft als Ganze umfasst. Die Babuschka, die 1941 in Kiew von einem Wehrmachtsoffizier erschossen wird, als sie ihn – das Jiddische fatalerweise für ein Bindeglied zum Deutschen haltend – auf der Strasse anspricht, trägt noch nicht einmal einen Namen. Vielleicht hiess sie Esther, meint ihr Enkel. Allem voran hiess sie Mensch, lautet das Plädoyer des Buches.
Ob sich die Episode – die titelgebende und manch andere – so zugetragen hat, kann «die Geschichte» freilich nicht bezeugen. Archive und Orte, die die Autorin konsultiert und besucht, fördern mehr Fragen zutage, als sie Antworten liefern, verweisen auf neue Verwandte, alte Ungereimtheiten, Ungewisses und Unerträgliches – wobei: «Für das Unerträgliche gibt es kein Wort. Wenn das Wort es erträgt, dann ist es auch erträglich.» Um zu ertragen, möchte man umgekehrt sagen, braucht es Worte und Geschichten. Dass letztere am Ende ebenso wie am Anfang dieses meisterlich klugen Buches stehen, ist so gesehen nur folgerichtig.
Claudia Mäder ist Germanistin und Redaktorin dieser Zeitschrift. Sie lebt in Zürich.











