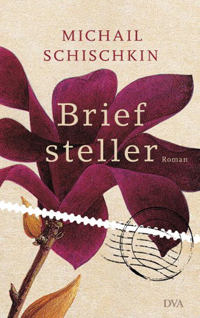«‹Bildungsbürger›
ist ein verlogenes Wort»
Wer als Schriftstellerin oder Schriftsteller erinnert werden will, ist auf eine intakte intellektuelle Trägerschicht angewiesen. Dass diese in der Schweiz seit Jahren kleiner wird, hat nicht nur Einfluss auf den literarischen Kanon, sondern auch auf die Identität des ganzen Landes.

Herr von Matt – was ist Ihre erste literarische Erinnerung?
Mein erstes gelesenes Buch hiess «Peterli, die Geschichte eines Wellensittichs». Das zweite: «Der dicke Peter» (lacht). Ich weiss auch nicht, warum meine Eltern, die sonst ganz vernünftige Leute waren, dachten, es fasziniere mich, wenn eine literarische Figur Peter heisst.
Würden Sie sich lieber an mehr Literatur erinnern oder mehr Literatur vergessen?
Ich möchte mir «Die Brüder Karamasow» von Anfang bis zum Schluss vergegenwärtigen können! Darum lese ich wichtige literarische Texte immer wieder neu. Es ist übrigens ein Irrtum, anzunehmen, man habe ein Buch gelesen, wenn man es nur einmal gelesen hat. Aber das Vergessen ist schon ein Problem.
Kann man überhaupt «literarisch vergessen gehen»?
Was für eine Floskel! Wöchentlich liest man sie irgendwo. Doch sobald eine Zeitung schreibt, ein Autor sei vergessen, beweist das ja, dass er eben gerade nicht vergessen ist. Die Floskel impliziert, dass niemand mehr da ist, der sich erinnert. Oder noch schlimmer: dass es auf jene, die sich dennoch erinnern, nicht ankommt, etwa weil sie «Bildungsbürger» sind. Das ist die Keule, die ich am meisten hasse. Was die Journalisten mit der Diagnose «vergessen» tatsächlich sagen: der Autor ist aus dem öffentlichen Diskurs verschwunden. Also ist es peinlich, in den Medien von ihm zu reden. Es könnte die Leute langweilen.
Sie meinen: der zeitgenössische Kulturjournalismus und das Feuilleton trauen selbst ihrer intellektuellen Trägerschicht, den Bildungsbürgern, nichts mehr zu?
«Bildungsbürger» ist ein verlogenes Wort. Im 19. Jahrhundert stieg das Bürgertum auf, wurde reich und holte den Adel ein – was Wohlstand und gesellschaftliches Ansehen betrifft. Die Soziologie unterschied dann zwischen den «Wirtschaftsbürgern», die durch wirtschaftlichen Erfolg aufstiegen, Bankiers etwa und Unternehmer, und jenen, die dies durch intellektuelle Leistungen erreichten – Professoren, Forscher oder Juristen, den «Bildungsbürgern». Das waren wertfreie soziale Kategorien. Dann kamen die 68er und machten das Wort «Bildungsbürger» zum Schimpfwort für Leute mit einem angeblich vorgestrigen Kulturbegriff. Heute werden oft schon schlichte kulturhistorische Grundkenntnisse als «bildungsbürgerlich» diffamiert. Die 68er gingen damals ja auch auf den Schulkanon los – weil er eine «bürgerliche Repressionsmassnahme» sei. Also schafften sie ihn ab – das wirkt sich bis heute aus.
Einspruch: ein Kanon der deutschsprachigen Literatur existiert doch auch heute noch!
Ja. Aber er ist viel kleiner. Heute gibt es vielleicht zehn selbstverständlich anerkannte Autoren: Büchner, Kleist, Kafka – das ist die Topgarde – daneben Celan und Ingeborg Bachmann. Lessing, Goethe und Schiller werden unter Vorbehalten toleriert und einigermassen gelten lässt man noch Fontane und Brecht. Das ist jetzt krass vereinfacht, aber es zeigt die Tendenz. Ganz unverkennbar ist die Verherrlichung der Topgarde: «Kleist ist toll.» Oder: «Büchner ist Wahnsinn.» Oder: «Kafka ist unglaublich.»
Sie meinen, dass vor lauter Vorbehaltslosigkeit Tiefenschärfe verlorengeht?
Ja. Und dass man sich gewisse Aussagen nicht mehr leisten kann. Man kann ohne weiteres sagen: «Goethe ist verschnarcht!», obwohl es Blödsinn ist. Aber wer etwas gegen Kafka sagen würde, wäre erledigt. Das ist, als ob einer sagte, Federer sei ein schlechter Tennisspieler. Ich finde Kafka gewaltig, aber er hat viele Kolleginnen und Kollegen.
Immerhin hat Federer kein eigenes Adjektiv, auf das man ihn reduzieren kann. Wird hingegen in einer Diskussion «Oh, wie kafkaesk!» gerufen, ist sie gelaufen.
Genau! Und «heute vergessen» ist eben ein ähnlich abschliessender Begriff. Weil unterstellt wird, dass es seine Gründe hat, dass jemand vergessen geht. Es gibt eine ganze Tradition hochstehender Literatur, die aus dem allgemeinen Bewusstsein verschwindet, weil kein einziger Journalist sie mehr erwähnt. Der Kanon ist auch im öffentlichen Diskurs geschrumpft. Das ist ein ernsthaftes Problem. Und es ist ein vergleichsweise neues Problem.
Das ist kontraintuitiv: 2017 ist doch die schlechteste Zeit fürs Aus-dem-Diskurs-Verblassen – Internet sei Dank?
Stimmt, ich kann alles finden, jederzeit. Brauche ich die erste Szene von «Hamlet», finde ich sie sofort im Internet. Aber ich muss vorher wissen, was ich finden will. Deshalb kann das Internet kein Ersatz sein für einen lebendigen Diskurs über aktuelle und vergangene Literaturen. Medial wird die Schweizer Literatur momentan reduziert auf die letzten fünfzig Jahre. Plus Walser, Meyer, Keller. So verlieren wir einen Teil unserer Geschichte. Literatur geht nie «alleine» verloren, sondern es trifft immer auch einen wichtigen geschichtlichen Datenspeicher. Der Verlust einer grösseren Perspektive auf die eigene literarische Tradition geht einher mit einem Verlust an historischem Bewusstsein. Das kann sogar fast plötzlich geschehen. So verschwand nach 1945 Cäsar von Arx auf einen Schlag aus dem öffentlichen Interesse. Er war viele Jahre lang der meistaufgeführte Dramatiker der Schweiz gewesen. Dann erlosch er. Und er hat sich erschossen.
Warum?
Der Tod seiner Frau hatte auch damit zu tun. Aber literarisch ging er unter in dem ungeheuren Zustrom moderner Literatur aus Frankreich und Amerika nach dem Krieg. Denken wir nur an die amerikanische Kurzgeschichte! Es war ein Aufbruch in eine Moderne, der vorher nicht möglich war. Und in der Schweiz kam plötzlich dieser Frisch. Der hatte zwar bereits um 1930 mit dem Schreiben begonnen, aber er fand einen neuen Ton. Frisch sagte einmal zu mir: «Ich habe damals haarscharf noch die Kurve gekratzt.» Damit meinte er, dass er als Schriftsteller den Anschluss an die Nachkriegsmoderne hätte verpassen können. Da hatte Frisch einen guten Instinkt. Von Arx fing an mit sehr modernen Stücken und hat dann zum Teil auch Dialektstücke geschrieben, die höchst erfolgreich waren: «Vogel friss oder stirb». Aber er war auch der Autor nationaler Festspiele im Auftrag des Bundesrats, der sogar teilweise eingegriffen und ihn «korrigiert» hat.
Von Arx war also auch eine Stimme geistiger Landesverteidigung. Ging er deshalb vergessen?
Ja, auch. Aber er war politisch durchaus aufgeschlossen. Von Arx war Vollblutdramatiker. Wagen wir den Test: haben Sie diesen Namen schon gehört?
Gehört schon, aber nicht mehr.
Wirklich, oder sagen Sie es nur?
Nein, ich habe wirklich nur den Namen schon einmal gehört.
Und wo, wenn ich fragen darf?
Bei Max Frisch. Im Tagebuch.
Ha! Das wüsste ich aber! Frisch und von Arx haben einander nicht gemocht. Für Frisch war er vielleicht zu erfolgreich, und von Arx spürte, dass der andere einer von denen war, die kommen. Von Arx hat das nur schlecht ertragen. Man muss aber sagen, dass die «Neue Zürcher Zeitung» unter Feuilletonchef Werner Weber sich der Tradition bewusst war und immer wieder Köpfe, die in Gefahr waren, vergessen zu werden, erwähnte und charakterisierte. Da wurde bewusst am kollektiven literarischen Gedächtnis gearbeitet. Heute geschieht das nur noch punktuell, ausgehend von Einzelinitiativen oder aufgrund glücklicher Umstände.
Welche glücklichen Umstände?
Ein gutes Beispiel ist der Kanton Aargau, dort wird aktiv am literarischen Gedächtnis der Region gearbeitet, auch mit Editionen. Neulich erst im Fall Hermann Burger. Er war genau in dieser Situation, und die Frage hiess: kippt er aus dem öffentlichen Diskurs? Daraufhin hat man in Zusammenarbeit mit dem Literaturarchiv in Bern seinen unbekannten Erstling präsentiert und ihm eine grosse Ausstellung gewidmet, die auch erfolgreich war – das ist doch vorbildliches Erinnern. Ich habe gelegentlich gesagt: man muss in der Kleinstadt leben, um in der Schweiz unsterblich zu werden (lacht).
Aber auch ein Kanton Aargau kann ja nicht einfach sagen: «Jetzt arbeiten wir an unserer literarischen Erinnerung.» Man kann Archive bauen, aber die Leute müssen sich auch dafür interessieren.
Regionen und kleinere Städte haben ihr eigenes Gedächtnis und ein starkes Interesse an der eigenen Tradition. Dort kann ein Schriftsteller länger gegenwärtig bleiben als in Zürich. Aber man muss natürlich sagen, dass sich die ganze Situation seit der Gründung des Schweizerischen Literaturarchivs verändert hat. Dort wird gezielte Erinnerungsarbeit auf höchstem Niveau geleistet. Dennoch kriegt ein Schriftsteller in einer Kleinstadt rascher einen Brunnen oder ein Gässchen als in Zürich.
Wenn Sie einen Platz, einen Berg oder einen See nach einem Literaten oder einer Literatin benennen könnten – was würden Sie nach wem benennen?
Ich glaube nicht an den Nutzen von einem «Bräker-See» oder einer «Von-Arx-Büste». Denken wir an das Denkmal auf dem Platz vor dem Kunsthaus: Niemand weiss mehr, wer der Mann auf dem Sockel ist. Wenn es nach den Leuten geht, könnte dort statt Albert Heim auch Hans Meier stehen. Das Im-Diskurs-Bleiben ist der springende Punkt.
Dann träumen Sie nicht heimlich von einem Peter-von-Matt-Weg?
Das ist eher ein Albtraum. Nach wenigen Jahren weiss keiner mehr, wer das war. Das bin dann nicht mehr ich, sondern nur noch eine Tafel (überlegt). Ich bin dagegen, dass man immer nur über die Gegenwart schimpft wie wir jetzt, aber es braucht einen Willen zur Minimalkenntnis einer verbindlichen literarischen Tradition. Das hat weniger mit Vergessen oder Nichtvergessen zu tun als mit der Art des Erinnerns. Ein gutes Beispiel ist Gotthelf: einer der gewaltigsten Schriftsteller, die es je gab, sicher der grösste Romancier der Schweiz und einer der grössten des deutschsprachigen Raums. In der Schweiz kennen alle den Namen. Gotthelf ist also ganz sicher nicht vergessen. Nur können Sie mit niemandem über seinen erschütternden Erstling «Der Bauernspiegel» reden.
Dafür können Sie mit jedem über «Homo Faber» sprechen – weil uns das Buch sozialhistorisch näher ist.
Das ist eine Projektion. Gotthelf gilt als «Bauernliteratur aus der guten alten Zeit». Aber niemand weiss, welche moderne Psychologie darinsteckt. Bei der Redewendung «Wie zu Gotthelfs Zeiten» denkt man an Bauern, die soffen und sich prügelten, raue Sieche – und man denkt, das geht mich nichts mehr an. Dabei gibt es keinen gnadenloseren Analytiker der menschlichen Existenz als Gotthelf. Keiner hat die Bosheit so unerbittlich analysiert und beschrieben.
Sie haben an der Universität etliche Gotthelf-Seminare abgehalten. Wie reagierten die Studenten?
Ich denke, sie dachten zuerst: «Jetzt gehen wir halt zum von Matt, wenn wir sonst schon kein rechtes Seminar finden!» (lacht). Die Vorstellungen von Gotthelf gingen zuerst bei allen eher in Richtung «literarische Bernerplatte». Nach drei Wochen habe ich die Leute aber gehabt, dann fingen sie an, an den Texten zu arbeiten. Das wurde spannend und ging in die Tiefe. Solche Prozesse faszinierten mich. Wenn ich sah, wie sich die Studenten intellektuell veränderten. Wenn sie innert Wochen zu neugierigen Kennern wurden.
Stichwort Studium: ist das Aus-dem-Diskurs-Verblassen nicht auch das probate Mittel, um einen gewichteten Überblick der Literaturgeschichte zu gewinnen?
Sicher. Aber es geht mir um mehr, nämlich um das kollektive literarisch-kulturelle Gedächtnis, einen zentralen Punkt der Identitätsbildung, nicht zuletzt eines Landes. Wer «Der arme Mann im Tockenburg» nie gelesen hat, kann nicht sagen, er kenne die Schweiz! Wir brauchen ein verbreitertes Bewusstsein der Traditionslinien.
Die Gefahr ist gross, in Heimattümelei abzudriften – wie umgeht man das Risiko?
Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre boomte eine Art Wiederentdeckungstrend. Da wurden jede Menge Texte und Autoren der Schweiz von diversen Verlagen wieder aufgelegt. Heute sind einheimische Wiederentdeckungen ökonomisch fast unmöglich geworden, man muss froh sein um einzelne geglückte Fälle. Das hat auch mit dem Wandel des Literaturbetriebs zu tun: Es muss in Literaturhäusern, Literaturmedien, im Fernsehen und Radio ein Interesse bestehen, und notabene nicht nur im Kulturradio – vor allem aber herrscht heutzutage in der breiteren Öffentlichkeit eine Art kultureller Trivialpatriotismus, der alles hochjubelt, was sich an bestehende Schweizklischees anlehnt.
Wie meinen Sie das?
Man ist doch aktuell schampar für die Schweiz – auch in der Kultur! Die Schweiz ist toll! Schweizer Autorinnen und Autoren sind toll! Toll, dass es sie noch gibt! Schellenursli und Heidi!
Sie haben Ihr ganzes Leben der Literatur gewidmet: als Professor an der Uni, als Schriftsteller, Herausgeber beim Verlag Nagel & Kimche, beim Bachmannpreis als Juror und auch in vielen weiteren Jurys. Wie viel kann man in welchem Feld für das Erinnern tun?
Es ist immer wieder die Differenz zwischen Diagnose und Therapie. Die Diagnose ist leicht, Schimpfen auch. Die Therapie ist schwer und teuer. Dabei gibt es eine grossartige Reihe, sie heisst «Schweizer Texte», herausgegeben von den besten Germanisten (ich bin nicht dabei). Da reiht sich eine versteckte Kostbarkeit unserer Literatur an die andere, aber in der Öffentlichkeit bleibt es dazu so still wie in der Wüste Gobi.
Herausgeberisch kann man also etwas dagegen unternehmen. Und was können Kritiker gegen das Vergessen tun?
Viele Kritiker wissen gar nicht, welche Macht sie haben! Allein das Nennen eines Namens in einem Nebensatz kann wirkungsvoller sein als eine ganze Rezension. Wenn einer käme und sagte, dieses oder jenes Buch erinnere an Adelheid Duvanel, das brächte etwas. Aber den Namen Duvanel habe ich seit Jahren in keinem Medium mehr gelesen, obwohl sie eine der Grossen der neueren Schweizer Literatur ist. Solche Prosa hat es seit Robert Walser nicht mehr gegeben! Man möchte ausrufen: «Gopfertami, lässt sich da wirklich nichts ändern!?»
Was nützen Empfehlungen von Kollegen der langfristigen Erinnerung?
Sehr, sehr viel könnte das nützen.
Es gab ja einst viele Empfehlungen von Thomas Mann…
Ja, der hat doch fast alles gerühmt, was man ihm vorlegte! Aber schon damals galt: 70 Prozent der gesamten literarischen Produktion verschwindet. Andere Werke können in einen anderen Kanon rutschen. Von Heinrich Federer gibt es die Autobiografie «Am Fenster» – darin stehen eindrückliche Schilderungen vom Leiden eines Asthmatikers. Heute ist es in medizinischen Fachkreisen ein anerkanntes Buch (lacht).
Aber Gedenktage und Jubiläen nützen doch bestimmt der Erinnerung?
(Überlegt) Dem langfristigen Präsentsein im Diskurs sind solche Aktionen, Gedenkfeiern und Jubiläen nicht nur zuträglich. Todestage werden ja nur bei den Leuten gefeiert, die so oder so noch relativ gegenwärtig sind. Es kann da auch Strohfeuer geben.
Welche jüngeren Texte gingen Ihrer Meinung nach völlig zu Unrecht unter?
Mir fällt ein Einzelfall ein: Es gibt von Lukas Bärfuss die Erzählung «Die toten Männer». Das finde ich etwas vom Besten, was in den letzten 20 Jahren in der Schweiz geschrieben worden ist. Nur hat es meines Wissens nie eine lebendige Diskussion darüber gegeben. Und von Peter Bichsel ist zwar viel die Rede, aber nie von seinem hintergründigen kleinen Roman «Cherubin Hammer und Cherubin Hammer». So schade!
Eine letzte persönliche Frage: wie erhalten Sie sich eigentlich Ihre Leidenschaft für die Literatur?
Fischer, Weintrinker und Bücherleser verlieren ihre Leidenschaft nie.