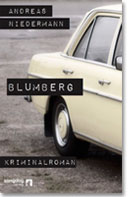Viel Rauch um…
Meine Kritiker und ich haben häufig unterschiedliche Auffassungen von Literatur. Das ist gut so. Aber zuweilen geht ersteren der Fokus auf das, was eigentlich zählt, völlig verloren. Eine Kritik der Kritik.

Meine ersten Erfahrungen mit der Kritik machte ich nicht als Opfer, sondern als Täter. Als freier Journalist schrieb ich neben Reportagen und Satiren auch Film- und gelegentlich Theater-, Kunst- und Fernsehkritiken für den «Nebelspalter» und den «Züritipp». Ich ging nicht zimperlich um mit den Künstlern, lobte gern, aber verriss noch lieber. Die meisten Filme, die ich kritisierte, kamen von weither, kaum einer der Filmemacher las wohl jemals meine Kritiken. Nur ein einziges Mal wurde ich mit der Reaktion eines Kritisierten konfrontiert: als der Kabarettist César Keiser aus Protest sein Gratisabonnement des «Nebelspalters» abbestellte, nachdem ich eine Komödie seines Sohnes verrissen hatte.
Umgang mit Kritik
Jahre später war ich dann der Kritisierte. 1998 kam mein erster Roman «Agnes» heraus und wurde – was, wie ich da erst erfuhr, alles andere als selbstverständlich ist – gleich in den wichtigsten deutschsprachigen Feuilletons besprochen. Die meisten Kritiken waren gut, wie das bei Erstlingen üblich ist, die entweder gar nicht oder wenn, dann positiv besprochen werden. Es macht keinen Spass (und hat auch wenig Sinn), einen Anfänger, den noch niemand kennt, öffentlich zu schlachten. Einzig im «Literaturclub», wo das Streiten über Bücher zuweilen reiner Selbstzweck ist, nannte Elke Heidenreich den Roman eine «eiskalte Präzisionsmaschine» – wenigstens schien sie das Buch gelesen zu haben. Seither habe ich in regelmässigen Abständen Bücher veröffentlicht, dafür gute wie schlechte, aber auch mittelmässige oder nichtssagende Kritiken erhalten und musste lernen, damit umzugehen.
Über gute Kritiken freut man sich. Dann vergisst man sie wieder. Schlechte Kritiken hingegen bleiben länger im Gedächtnis. Nicht, weil sie eine öffentliche Demütigung bedeuten, viel eher, weil sie einen zum Widerspruch herausfordern, man aber selten die Möglichkeit hat, ihnen öffentlich zu entgegnen. Es ist ja nicht so, dass Autoren zum Spass schlechte Bücher schreiben, um Kritiker zu ärgern. In der Regel wissen sie sehr wohl, was und weshalb sie es tun. Ich streite oft mit Kritikern, die mich verrissen haben, weise ihnen Schludrigkeit nach, wenn sie die Handlung heillos durcheinandergebracht haben, und lache sie aus, wenn sie nicht einmal die Namen der Protagonisten richtig geschrieben haben. Ich kontere ihre Argumente, weise ihnen nach, wie ungenau sie gelesen oder wie wenig sie verstanden haben. Das alles geschieht allerdings nur in meinem Kopf, manchmal auch in einem Brief oder einer E-Mail, die ich dann nicht abschicke. Nur einmal drückte ich auf «Senden»: Es war kurz nach Mitternacht, und ein paar Gläser Wein hatten meine Empörung gesteigert und meine Vernunft eingeschläfert. Wie froh war ich, als sich am nächsten Morgen zeigte, dass die Mail nicht zugestellt worden war. Ich hatte den Namen des Adressaten falsch geschrieben.
«Über gute Kritiken freut man sich. Dann vergisst man sie wieder. Schlechte Kritiken bleiben länger im Gedächtnis.»
Kritiker schreiben nicht für Autoren, sie schreiben für Leserinnen und Leser. Ihre Urteilskraft ist ihr Kapital, und Urteile lassen sich nicht mit Argumenten widerlegen. Man kann Kritiker aller möglicher Fehler überführen, an ihrem Urteil wird das kaum etwas ändern. Denn Urteile sind Gefühlssache. Sie kommen zuerst, die Argumentation wird meist im Nachhinein konstruiert – was erklären dürfte, weshalb einzelne Kritikpunkte oft schwer nachzuvollziehen sind. Ein Kritiker warf mir beispielsweise einmal vor, dass in meinem Buch zu viel getrunken und geraucht werde, eine Kritikerin, dass ich nicht genügend Nebensätze machte. Bei beiden Vorwürfen handelt es sich nicht um Argumente für oder wider den Text, ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Gründe waren, weshalb sie meinen Roman nicht mochten. Nein, sie mussten ihr intuitives Urteil irgendwie abstützen, und sei es mit noch so klapprigen Argumenten. Eine Kritik der Kritik darf also nicht bei den Urteilen der Kritiker ansetzen, obwohl es natürlich meist die Urteile sind, die uns Kritisierte verärgern. Sie muss eine Medien- und Betriebskritik sein.
Die Kritik der Kritik ist Medienkritik
Die Literatur hat in unseren Feuilletons – verglichen mit der zeitgenössischen Kunst, der neuen Musik oder der Photographie – einen sehr hohen Stellenwert, auch wenn Literaturredaktoren gerne klagen, sie hätten viel zu wenig Platz, um alle wichtigen Neuerscheinungen zu besprechen. Aber Literaturkritiker werden für ihre Arbeit so schlecht bezahlt, dass sie es sich eigentlich gar nicht leisten können, etwas genauer über ein Buch nachzudenken oder es vielleicht sogar ein zweites Mal zu lesen. So bestehen die meisten Kritiken im deutschen Sprachraum aus etwas Autorenbiographie, viel Handlungszusammenfassung und einem kurzen, oft wenig fundierten und begründeten Urteil – weniger ambitionierte Kritiker zitieren auch gern aus der Verlagswerbung oder dem Klappentext. Die Kriterien, die Kritiker aller Arten auf den Text anwenden, sind zudem selten jene, die für uns Autoren von Bedeutung sind: Meist geht es dabei ebenso wenig um die sprachliche Qualität wie um die Form oder die Ästhetik des Textes. Viel öfter werden Bücher dafür kritisiert, dass die Protagonisten darin nicht «sympathisch» oder «interessant» sind, dass sie nicht in emanzipierten Ehen leben oder in ihren Gefühlsäusserungen nicht so differenziert und selbstkritisch sind wie…Literaturkritiker. Während ich diesen Text schreibe, flattert die erste Kritik zu meinem neuen Roman herein, die – unter krasser Missachtung der Sperrfrist – drei Wochen vor dem Buch erscheint. Darin wird mein Roman als «antifeministisches Manifest» bezeichnet, weil die Protagonistin ein Leben als ganz normale Mutter und Hausfrau führt. Und: über die Qualität des Textes verliert der Kritiker auf zwei Seiten kein einziges Wort.
Dass es kein Zufall ist, dass in der Tessin-Reisebeilage fast alle Inserate für das Tessin werben, wird kaum jemanden erstaunen. Dass aber auch das Feuilleton nicht frei von solchen Gegengeschäften ist, dürfte viele Leser überraschen, hat wenigstens mich überrascht, als mir vor vielleicht zehn Jahren ein Redaktor einer seriösen Tageszeitung verkündete, er könnte noch mehr für meine Bücher tun, wenn mein Verlag nur gelegentlich ein Inserat schalten würde. Ich hakte nicht nach, was genau er damit meine, und leitete das Angebot auch nicht an meinen Verlag weiter. Der Rezeption meiner Bücher in dieser Zeitung hat das nicht geholfen.
Wo die Arbeitsbedingungen besser sind, entstehen auch bessere Kritiken. Ein befreundeter Autor, der für die «New York Review of Books» lange Rezensionen schreibt, erzählte mir, er bekomme von der Redaktion jeweils einen Stapel Bücher eines Schriftstellers und ein paar tausend Dollar als Honorar. So könne er sich über Wochen mit einem Werk befassen, Bezüge zwischen verschiedenen Texten des Autors herstellen, Entwicklungen beobachten, ein differenziertes Urteil fällen. Die fundiertesten und intelligentesten Kritiken, die ich in meiner Laufbahn erhalten habe, wurden denn auch allesamt in angelsächsischen und zu einem kleineren Teil in lateinamerikanischen Medien veröffentlicht. Und sie waren fast alle von Schriftstellerinnen oder Schriftstellern geschrieben, die der Arbeit von Kollegen einen Grundrespekt entgegenbringen, weil sie wissen, was es bedeutet, wenn die Arbeit von mehreren Jahren in ein paar Sätzen abgetan wird.
Erstaunlich ausführliche und qualitativ hochwertige Kritiken entstehen seltsamerweise auch da, wo gar nichts bezahlt wird, nämlich im Internet. Das vom Institut für Neuere deutsche Literatur der Philipps-Universität Marburg gegründete und betriebene Kritikportal literaturkritik.de etwa versammelt unzählige ehrenamtlich verfasste Besprechungen von erfahrenen Autorinnen und Autoren. Und selbst unter den Leserkommentaren bei Amazon und anderen Internetbuchhandlungen finden sich neben eher schlichten Stellungnahmen («Mein Sohn findet diese Lektüre sehr langweilig. Er würde diese Lektüre nie kaufen. Leider steht diese Lektüre im Abi-Lehrplan drin.» – Originalkommentar zu meinem Roman «Agnes») oft erstaunlich differenzierte Rezensionen.
Kritikerkritik
Ganz aus der Verantwortung für die Misere der Kritik kann man die Kritiker aber nicht entlassen. Sie sind zwar keine Eunuchen, wie Hemingway meinte1, aber zu viele Kritiker opfern ein Buch für die eigene schöne Formulierung – oder für einen Kalauer. In meinem Fall wird dann etwa von «Hochstamm- oder Niederstammkultur» geschrieben. Besonders gut kann man diese Art des Autorenopfers beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb beobachten, wo vor laufender Kamera kritisiert wird und ein Witz mehr wert ist als ein intelligenter Gedanke oder kritische Fairness.
Noch gravierender ist die Tendenz mancher Kritiker, ihren literarischen Geschmack zum ehernen Gesetz zu machen. Statt dass sie bei einem Autor sagen: «Den kritisiere ich nicht, mit dem kann ich nichts anfangen», werfen sie ihm vor, dass er nicht die Literatur schreibt, die sie gerne lesen würden, beispielsweise eine mit vielen Nebensätzen. Kein vegetarischer Gastrokritiker würde ein Steakhouse bewerten, in der Literaturkritik ist das aber leider gang und gäbe. Unter dem Titel «Where I’m Reading from»2, «Woher ich lese», hat Tim Parks kürzlich in der «New York Review of Books» vorgeschlagen, alle Kritiker sollten ihre Lesebiographien veröffentlichen, damit die Leser ihre Stellungnahmen besser einordnen könnten. Es sei, meint er, illusorisch zu glauben, ein Kritiker könne ein Buch unvoreingenommen lesen. Unvoreingenommen zu sein, schreibt Parks, würde bedeuten, von nirgendwoher zu kommen, niemand zu sein.
«Noch gravierender ist die Tendenz mancher Kritiker, ihren literarischen Geschmack zum ehernen Gesetz zu machen.»
Nicht zu unterschätzen ist auch der Herdentrieb der Kritiker: Hat der Löwe unter ihnen eine Gazelle erlegt, kommen bald schon die Hyänen, um sich über die Reste herzumachen. Ich habe mehr als einmal erlebt, wie Kritiker mir von Texten vorschwärmten, die sie Tage später, als sie die Urteile ihrer Kollegen gelesen hatten, in der Luft zerrissen. Man kann als Autor auch Opfer von Rivalitäten unter Kritikern werden, die sich aus Prinzip widersprechen. Die besten Chancen für faire Kritiken hat man oft in mittelgrossen Zeitungen, deren Kritiker nicht mit jenen der grossen rivalisieren.
Manchmal beissen Kritiker sich im Werk eines Autors fest, als gälte es, die Welt vor seinen Büchern zu schützen. Ist der Autor erfolgreich, steigert das den Furor des Kritikers noch. «Hier sitzt die deutsche Literaturkritik einem kollektiven Missverständnis auf», schrieb einmal ein einsamer Rufer in der Wüste über die positive Rezeption meiner Bücher. Mehr noch als meine Bücher schienen ihn die guten Kritiken zu ärgern, die ich bekam. Überhaupt der Erfolg. Eigentlich hatte ich schon seit «Agnes» darauf gewartet, dass ich eines Tages heruntergeschrieben würde, passiert ist es erst bei «Nacht ist der Tag», meinem vorletzten Roman. Im Ausland bekam das Buch fast nur gute Kritiken. Für die Schweiz war es offenbar nicht gut genug, unter anderem, weil darin zum Beispiel zu viel getrunken und geraucht wird.
Bedrohliche Nähe
Zu viel getrunken wird auch im Literaturbetrieb. Insbesondere an Messen und Festivals, wenn es nicht zu vermeiden ist, dass Autoren und Kritiker aufeinandertreffen. Und dann, auch das muss gesagt sein, kommt es oft zu schönen Begegnungen und man merkt, dass man gar nicht so weit voneinander entfernt ist, dass Urteile nicht sakrosankt sind und dass fast alle im Betrieb – ob sie nun Bücher schreiben, kritisieren oder verlegen – eine grosse Liebe und Begeisterung für Literatur teilen. Literarische Texte durchbrechen die Grenze unseres persönlichen Raums, sie kommen uns ganz nah, fordern uns heraus, greifen uns an, bewegen uns. Deshalb lösen sie so starke Gefühle in uns aus, seien es nun positive oder negative. Die Nähe, die beim Lesen entsteht, kann sehr schön sein, wie jene zu einem geliebten Menschen, aber sie hat auch etwas Bedrohliches. Wenn wir sie nicht zulassen können, wenn wir sie als Übergriff empfinden, müssen wir das Buch aus unserem Raum vertreiben, es verreissen oder – wie Denis Scheck es in seiner Sendung «Druckfrisch» gerne tut – in den Müll werfen. Jedes Mal, wenn ich auf einem Podium oder im Fernsehen mit Kritikern über Bücher stritt, gingen die Diskussionen noch lange nach der Veranstaltung weiter. Und ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, meine Urteile seien immer fundierter und fairer als jene der Kritiker gewesen. Die Vehemenz, mit der wir über Bücher streiten, ist doch im Grunde nur der Beweis dafür, wie ernst wir sie nehmen – und wie wichtig sie uns allen sind.
«God knows, people who are paid to have attitudes toward things, professional critics, make me sick; camp-following eunuchs of literature.» Ernest Hemingway, Brief an Sherwood Anderson, 23. Mai 1925. ↩
Unter diesem Titel erschien im Mai 2015 eine Sammlung von Tim Parks Essays und Kritiken bei «New York Review of Books». ↩