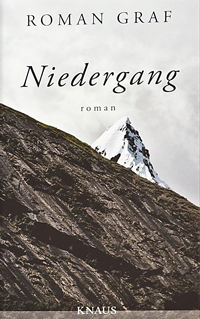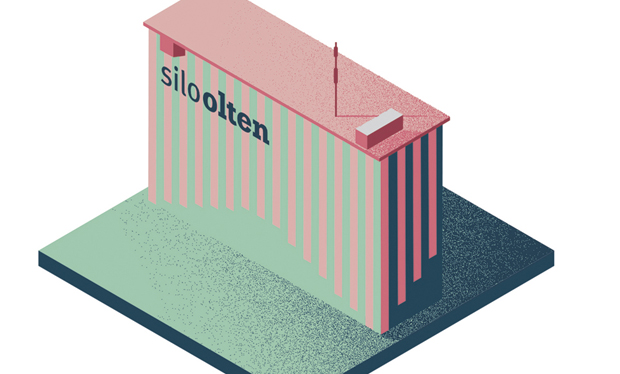8902 Urdorf
Skizze eines Agglomerationstagebuchs

Auf der kargen Wiese vor dem Haus stehen eine Rutsche und eine Schaukel, verloren zwischen den Bauaussteckungen. Der Junge aus dem Nachbarhaus schreit wie am Spiess. Er hat sich auf die von der Sonne brütend heisse Rutsche gesetzt. Normalerweise aber ist es ruhig. Ab und zu bellen die Dalmatiner des Nachbarn.
Der Sommer in Berlin war wüst und kalt. Bei einem Gewitter kamen Hagelkörner vom Himmel, gross wie Aprikosen. Ende letzten Jahres bin ich dann doch noch zurückgekommen – dieses Jobangebot aus Zürich, das ich nicht ablehnen konnte. Und so zog ich von der Frankfurter Allee, Berlin-Friedrichshain, in den Heidenkeller, Urdorf. Eine Zwischennutzung, bis die Wohnblocksiedlung abgerissen wird. Die Miete ist genauso hoch wie in Berlin. In der Schweiz alleine in einer grosszügigen Zweizimmerwohnung zu leben, bedeutet für mich, aus dem Stadtzentrum in die Agglomeration zu ziehen. Nach dem Umzugstag im Dezember sass ich zwischen Bananenschachteln und Migrossäcken, den Drehtabak aufgeraucht. Ich ging vor die Tür und mir war klar: kurz nach Mitternacht bekomme ich nur noch Filterzigaretten im Gasthof Schwanen. Leider war an eben diesem Abend der Jetoneinwurf des Automaten defekt. Im Hintergrund lief «What a Wonderful World» ab Band. Da kommt heute abend kein anderes Lied mehr, dachte ich. Und sehnte mich nach einem Berliner Spätkauf.
Der Winter in Urdorf war zäh und dunkel. Die eine Hälfte des Herzens hing noch in Berlin, die andere schwer in Urdorf. Meine Nachbarin in Berlin fragte mich einmal im Treppenhaus, warum ich so viel alleine sei. Weil ich gerne für mich sei und schreibe, sagte ich. Das verstehe sie gut, bei ihr würde es auch Tage geben, an denen der Fernseher nicht laufe. Wenn ich abends in Urdorf durch die Strassen gehe, sehe ich in Wohnzimmer mit grossen Fernsehern, selten sitzen Menschen davor.
Der Winter in Urdorf hat mir auch gezeigt, dass man sich vor schwermütigen Männern in Acht nehmen muss.
Die Dunkelheit hier ist eine andere als in der Stadt. An einem Abend im Dezember sass ich auf dem Laminatboden in meinem Schlafzimmer und schaute Fotos meiner Berlinzeit an. Nick Cave heulte durch die Wohnung. Ich dachte an den Piloten. Der eigentlich Kriegsreporter ist. Wenn er beim ersten Gin Tonic erzähle, als was er wirklich arbeite, würde sich kein leichtes Gespräch entwickeln, sagte er. Mir war auch nicht nach leichten Gesprächen – und so dachten wir, den Hauch einer Zukunft zu haben. Die Narben waren echt. Die Liebe auch. Aber seit eben diesem Abend im Dezember hängt ein Satz von Robert Walser über meinem Bett: «Moment, bleiben Sie stehen! Ihnen schaut da die Seele zum Körper heraus!»
Dann kam der Frühling und ich hatte mich in meinem neuen Leben zurechtgefunden. Die Wohnung ist nach wie vor spartanisch eingerichtet. Wenn ich telephoniere, hallt es. Auf der anderen Seite der Leitung fragt man, ob mir Urdorf gut tue. Ob ich mich auch nicht zu sehr zurückziehe? Ich werde mehr Bücher kaufen gegen das Hallen.
Wenn ich heute daran denke, dass ich Urdorf in einem Jahr verlassen muss, gefällt mir dieser Gedanke nicht. Einerseits, weil ich ein langsamer Mensch bin, und andererseits, weil ich hier gut arbeiten kann. Wenn ich in Zürich in den Zug steige, weiss ich: Jetzt habe ich Ruhe, bis ich wieder in die Stadt fahren will. Natürlich lässt sich die Wohnsiedlung nicht schönreden. Die Architektur ist offenbar einfach passiert. Alle Wohnblöcke sehen gleich aus, unterscheiden sich einzig durch die Töne der Pastellfarben, in denen sie angemalt sind. Mein Block? Rostrot. Meine Wohnung? Dritter Stock rechts. Die Wohnung links sieht übrigens gleich aus, einfach seitenverkehrt.
Das erste halbe Jahr habe ich ausschliesslich in der Stadt eingekauft. Eines Morgens habe ich dann entschieden, dass ich hier einkaufen sollte. Seit drei Monaten gehe ich also ab und zu ins Einkaufszentrum Spitzacker. Alleine schon, weil ich die Kehrichtsäcke fürs Limmattal nur dort kaufen kann. Zwischen Denner, Coop, Migros, einem Frisör und einer Drogerie gibt es ein Bistro und davor einen Dinosaurier. Wenn Kinder dem Dinosaurier eine Münze in den Mund werfen und sich in seinen krummen Rücken setzen, schüttelt er sie sanft durch.
Im Bistro Spitzacker sitzt Frau Schnyder. Jeden Nachmittag am gleichen Tisch. Vormittags geht sie zum Friedhof. An den ungeraden Tagen besucht sie auf dem Weg ins Bistro ihre Freundin im Spital. Schenkelhalsbruch. Sie sei Witwe, erzählt sie mir. Das darf aber niemand wissen. Die Männer in ihrem Alter meinen, die ganze Schönheit sei für die Trauer um den verstorbenen Ehemann draufgegangen, aber sie möchte gerne nochmals jemanden kennenlernen. Auf dem Tisch vor sich breitet sie tausend Teile eines Puzzles aus. Seit der Emil tot sei, setze sie dieses Puzzle zusammen, sagt sie. Immer wieder und immer schneller. «So bleibt der Geist beweglich», lacht sie. Statt ein Foto von Emil auf eine Tasse oder eine Kochschürze zu drucken, habe ihr der Sohn das Puzzle geschenkt. Das sei doch originell. Wahrscheinlich aber auch die Idee ihrer Schwiegertochter gewesen, der Sohn sei nicht gut mit Geschenken. Sie lacht. Die Puzzleteile, die sie schon zusammengesetzt hat, zeigen braunes Fell. Emil war der Hund, nicht der Mann. Ich bin erleichtert.
Nur einmal pro Woche ist es wichtig, dass ich pünktlich in der Stadt bin, nur einmal die Woche werde ich in einem Büro erwartet. Die S9 ist allerdings regelmässig zu spät. Heute ist so ein Tag, an dem ich erwartet werde, drum gehe ich früher los und warte am Bahnhof. Neben mir ein Junge mit seinem Grossvater. Er schaut auf das Schild, das – weiss auf blau – «Urdorf» sagt. Wer Urdorf sei, will er wissen. «Das ist kein Mensch, das ist ein Ort.» Und an den Bahnhöfen sei immer die Ortschaft angeschrieben, erklärt der Grossvater. «Drum wohnst du hier, weil du uralt bist», lacht der Junge. Ich lache auch. Der Junge kommt zu mir rüber, die Arme vor seinem Batman-Shirt verschränkt. «Und du bist auch alt», grinst er mich an. «Nein, ich bin nicht alt», verteidige ich mich. «Doch, bist du», sagt er und spuckt mir auf die Turnschuhe, dann versteckt er sich im Wartehäuschen. Es gibt Tage, die sanfter beginnen. Der Grossvater eilt herüber und reicht mir ein Taschentuch. «Mein Sohn erzieht meinen Enkel antiautoritär. Sind die Turnschuhe denn neu?», fragt er. «Nein, sind sie nicht», entgegne ich. Der Grossvater ist erleichtert. Ob das dem verzogenen Jungen erlaube, fremden Menschen auf die Turnschuhe zu spucken, will ich fragen. Aber das Wort «verzogen» erinnert an «erziehen» – und darauf wird in dieser Familie offensichtlich verzichtet. Ich drehe mir eine Zigarette und bin mir nicht sicher, ob ich erst dem Grossvater oder dem Jungen ein Bein stellen möchte.
Heute bin ich Pendlerin. Und wenn ich pendle, komme ich auch immer zur gleichen Zeit aus dem Büro, wie alle anderen auch. In der vollen S15 denke ich, wie gut es mir geht, dass ich mich dem Menscheln so selten aussetzen muss. Und in einem Viererabteil ist sogar noch ein Platz frei. Mir gegenüber eine Mutter in lila Leggings. Verblasste Mädchentattoos auf den Armen. Sternchen hier, Herzchen da. Für jeden Lebensabschnitt ein Motiv aus dem Katalog. Die Tochter neben ihr trägt ein Krönchen auf dem Kopf und starrt mich an. Dann beugt sie sich zur Mutter rüber und flüstert ihr ins Ohr. Die Mutter wirft mir entschuldigende Blicke zu. So geht das vom Hauptbahnhof bis zur Hardbrücke im Minutentakt. Ich wünsche mir, dass die beiden in Altstetten aussteigen. Der Zug fährt weiter, die beiden sind sitzengeblieben. Im Treppenhaus denke ich, der spuckende Junge und diese garstige Prinzessin wären ein gutes Paar. Auch im Alter. Sie würde ihm die Spucke wegwischen und er ihr den Asthmaspray reichen, während sie sich zusammen die «Tagesschau» anschauen.
Zwischen meiner und der anderen Wohnungstür steht ein Schuhregal. Darauf Turnschuhe in Grösse fünfundvierzig. Da bin ich mal einen Tag in der Stadt, komme nach Hause und habe einen Nachbarn. Ich schliesse die Tür hinter mir zweimal ab. Rauche eine Zigarette am Fenster. Vor dem Nachbarblock sitzt der Mann im weissen Plastikstuhl. Seine Haltung verrät, dass er seit Jahren auf dem Stuhl sitzt. Ich lasse das Schlafzimmerfenster offen. In der Nacht höre ich sein Gebiss klappern.
Im Briefkasten liegt der Abholschein für ein Einschreiben. Ich muss also zur Post. Ich frage beim Frisör im Einkaufszentrum Spitzacker nach dem Weg. Das muss man erst einmal hinbekommen, derart zurückgezogen zu leben. Und siehe da: Frau Schnyder steht vor mir in der Schlange. «Fräulein Nora, haben Sie das Festprogramm schon gelesen?», fragt sie. «Ich werde nicht da sein», sage ich. «Da müssen Sie aber einen guten Grund haben, Fräulein Nora! Die Liebe?» «Die Arbeit», sage ich. Ihre Tochter sei bei der Frauenriege dabei. Und zusammen mit dem Männerturnverein kochten sie Älplermagronen. Und beim EHC Urdorf-Stand gebe es Würste vom Grill, die seien ganz passabel. Ob ich es mir nicht noch einmal überlegen möchte. Die Arbeit lasse sich nicht verschieben, erkläre ich ihr. Aber ich sei doch Schriftstellerin, da komme es doch nicht so drauf an. Das Duo «Die Entertainer» eröffne das Fest und dann spiele die Gugge «Stiereschränzer», die würden das ganz ordentlich machen. Meine Brust ist eng. Ich wünsche mir, dass mein Handy klingelt, dass mich jemand aus dieser Situation befreit. «Die jungen Menschen gehen dann im ‹Schwanen› tanzen, bis in die Nacht hinein», lächelt Frau Schnyder. Da würde ich doch unter Gleichgesinnte kommen, da solle ich doch hingehen. Sie könne ja nicht mehr tanzen, weil die Hüfte quietsche.
Am Abend habe ich Besuch. Er sitzt auf meinem Balkon zwischen Altglas und einem halbvollen Kehrichtsack. Urdorf erinnere ihn an Amerika, sagt er. «Weisst du noch, wie wir mit der Italienerin in der gelben Regenjacke und den beeindruckenden Augenringen Wein getrunken haben?», frage ich. «Sie trank, bis sie sich mit beiden Händen am Tresen festhalten musste», lacht er. «Der Zauber einer betrunkenen Nacht», sage ich. «Verloren stand sie am Flipperkasten», sagt er, die Stirn dramatisch in Falten gelegt. «Schau nicht so tragisch», lache ich. Wir meinen es gut miteinander. Das ist viel. Vor uns ein Sonnenuntergang über dem Limmattal, den es so schön nur in Urdorf gibt.
Am nächsten Tag schreibt er eine Nachricht, die alles aus dem Takt bringt. Ich kaue Nägel, reisse Nagelhäutchen ab. Lese seine Nachricht im Kopfstand. Im Einkaufszentrum Spitzacker kaufe ich Kräuter für den Balkon und ziehe 40 Liter Blumenerde hinter mir nach Hause. Der Mann im weissen Plastikstuhl schaut kritisch, die Verpackung werde gleich reissen, warnt er mich. Soll sie doch reissen, denke ich, dann bewegt sich der Mann vielleicht, dann springt er von seinem Plastikstuhl auf. Die Verpackung hält.
In die Blumenkästen pflanze ich Chrysanthemen in Orange und Lila. Die Blumenkästen werde ich nicht mitnehmen können, wenn ich ausziehen muss. Wehmut überkommt mich. Vielleicht werden sie den Winter aber gar nicht erst überleben. Aus dem Fenster gegenüber schreit die Nachbarin, dass es doch reichlich spät sei, jetzt noch zu pflanzen. Ich schreie zurück, dass es gut sei, wenn man sich um etwas kümmern könne. Aber wer sich denn um die Pflanzen kümmere, fragt sie, so viel wie ich unterwegs sei. Da ist ja auch kein Mann im Haus, dem man erklären könnte, wie er die Pflanzen nicht vertrocknen liesse… – «Und auch nicht ertränken!», schreit sie weiter. Ihre Ehe sei um ein Haar am schwarzen Daumen ihres Mannes gescheitert. Seit dann sitzt ihr Mann wahrscheinlich im weissen Plastikstuhl vor dem Haus. «Wollen sie Kinder?», schreit sie. «Nein!», schreie ich zurück. Schnaubend schliesst sie das Fenster und zieht den selbstgehäkelten Vorgang zurecht. Ihr Mann zuckt zusammen und setzt sich gerade hin.
Mein Handy klingelt. Er sagt, dass es schön wäre, mit mir zu reden. «Ich fahre weg und melde mich, wenn ich zurück bin», sage ich. Ich sitze zwischen den Pflanzen und weiss nicht, wer sich die nächsten Tage kümmern könnte. Ich überlege kurz, die Nachbarin zu fragen, ob sie die Tage einmal zum Giessen vorbeikommen möchte. Dann fürchte ich, dass sie mir womöglich die Wohnung umstellt und bei allen Fenstern ihre selbstgehäkelten Vorhänge anbringt. Ich fülle die Salatschüssel und den Spaghettitopf bis obenhin mit Wasser, fädle die Schuhbändel meiner Turnschuhe aus, schneide die Enden ab und lege die Bändel ins Wasser, die anderen Enden stecke ich in die Erde der Töpfe. Hilfe zur Selbsthilfe. Ich schliesse die Balkontür, lasse die Fensterläden runter und nehme meine Reisetasche. Ich betrachte die Turnschuhe auf dem Schuhregal vor der Wohnung und ärgere mich, dass ich mich nicht traue, den unbekannten Nachbarn zu fragen, ob er sich kümmern könnte.
Nach einer Woche bin ich zurück. Die Chrysanthemen lassen die Köpfchen vorwurfsvoll hängen. Die Kräuter sind braun. «Wer hat die Pflanzen gegossen?», schreit die Nachbarin aus dem Fenster. «Die haben selber getrunken», schreie ich. Schnaubend schliesst sie das Fenster und zieht den selbstgehäkelten Vorhang zurecht. Ihr Mann hält sich die Ohren zu und dann mit den Händen am Plastikstuhl fest.
Ich rufe ihn an. In drei Wochen möchte ich ihn sehen. «Warum erst in drei Wochen?», fragt er mit matter Stimme. «Weil ich mich kümmern muss», sage ich und hoffe, dass die Pflanzen durchhalten. Ein ungemütliches Gespräch führt man besser auf einem gemütlichen Balkon. Wir werden uns die wichtigen Fragen stellen, auf die die Antworten nicht einfach zu haben sind. Wir werden sie in den Widersprüchen suchen und im Zwiespalt steckenbleiben. Auch das ist offenbar: einfach passiert.