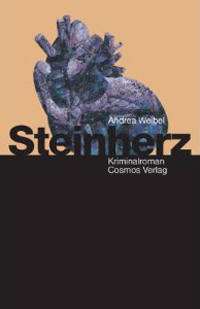Charlotte Brontë und das Nichts
Sein Debüt wurde in den USA ein Riesenerfolg, da war er gerade 20 Jahre alt. Weniger bekannt ist: Fantasy-Autor Stefan Bachmann ist auch ausgebildeter Musiker. Aber wie kommt jemand überhaupt auf die Idee, zu schreiben oder Musik zu machen?
Es gibt eine Anekdote, an die ich jedes Mal denken muss, wenn ich nervös lächelnd vor einer Buchlesung auf der Bühne sitze. Die viktorianische Autorin Charlotte Brontë wurde von William Makepeace Thackeray zu einem schicken Dinner in London eingeladen und der Verlauf des Abends im Tagebuch von Thackerays Tochter festgehalten:
«… Zwei Gentlemen führen sie herein: eine kleine, zierliche, ernste Dame … Sie kommt in das Zimmer, Handschuhe an den Händen, äusserst still, ein bisschen grimmig. Unsere Herzen schlagen schneller, mit grosser Begeisterung. Dies ist also die Schriftstellerin, die mit der unvorstellbaren Kraft ihrer Bücher ganz London zum Reden, Lesen, und Spekulieren bringt … Alle warteten auf ein brillantes Gespräch, doch es kam nie auf. Nach einer Weile ging Miss Brontë zu einem Sofa im Arbeitszimmer, sprach manchmal ein paar leise Worte zu unseren Gouvernanten. Die Damen sassen erwartungsvoll rundherum. Die Konversation wurde trüb, und trüber noch … Am Ende sagte Miss Procter, es sei einer der langweiligsten Abende, die sie je erlebt habe.»
Einen ähnlichen Vorfall durfte ich vor ein paar Jahren erleben: Sir Terry Pratchett und ich wurden beide zu einem Anlass in New York eingeladen, da wir den gleichen US-Verlag haben. Ich durfte ihn treffen, war natürlich voller Ehrfurcht. Wir signierten je unser Buch füreinander, ich mein erstes, er sein fünfzigstes. Als ich mein Buch überreichte, sagte er ganz leise: «Oh, how lovely.» Den Rest des Abends sass er stillschweigend neben seiner Lektorin und schaute nett und ein bisschen verlegen in die Ferne. Ich hörte ihn kein weiteres Wort sagen, weder zu mir noch zu den anderen Gästen.
Dieses «Oh, how lovely» werde ich für immer schätzen, und wenn es nach mir ginge, stünde es als Klappentext auf jedem meiner Bücher und dann später auch auf meinem Grabstein. Doch ich glaube, es gab an diesem Abend den einen oder anderen Gast, der wie Frau Procter ein bisschen enttäuscht war. Man hat die Bücher dieser Autoren verschlungen, sie bewundert, sie dann eingeladen und darauf gewartet, dass sie genauso genial mit dem gesprochenen Wort umgehen wie mit dem geschriebenen. Tatsächlich gibt es viele Autoren, die so silberzüngig unterwegs sind, wie sie schreiben. Aber die Erwartung, dass diese zwei Fähigkeiten Hand in Hand gehen, finde ich immer wieder amüsant. Denn was bewegt jemanden dazu, zu schreiben anstatt laut zu erzählen? Was bewegt jemanden dazu, im stillen Kämmerlein stundenlang über Menschen, die gar nicht existieren, zu kritzeln, zu redigieren und nachzudenken? Und weiter, was bringt jemanden überhaupt dazu, in die Künste einzusteigen, an den Saiten einer Gitarre zu zupfen, in die Tasten eines Klaviers zu greifen, zu komponieren oder zu malen? Wieso sprechen nicht einfach alle?
«Ich denke, dass Musik und Schreiben das Resultat einer Suche
nach alternativen Ausdrucksmöglichkeiten sind.»
Am Anfang, als Kind, ist es wahrscheinlich einfach Neugierde, die einen eine Geschichte aufschreiben oder sich an einem Musikstück versuchen lässt. Doch wenn man bedenkt, wie intensiv man sich während einer Karriere in der Musik oder Literatur mit seiner Arbeit beschäftigt, genügt eine solche Erklärung nicht. Vielmehr denke ich, dass Musik und Schreiben das Resultat einer Suche nach alternativen Ausdrucksmöglichkeiten sind und dass sie oft aus einer Unzufriedenheit mit dem Verbalen hervorwachsen.
Die mündliche Sprache wird in unserer Kultur sehr geschätzt. Small Talk, egal wie banal das Thema, ist der Massstab sozialer Kompetenz. Ausserdem hat sie eine wichtige Funktion für die Aufrechterhaltung von Psyche und Selbstwahrnehmung. Sie sagen vielleicht: «Ist das Wetter nicht schön heute?» – ich stimme zu, und Sie fühlen sich gesehen, nicht mehr ganz so alleine mit Ihrer Ansicht, dass das Wetter wirklich ganz angenehm ist.
Aber was, wenn man einer Sprache nicht mächtig ist? Was, wenn man aus einem anderen Land stammt, wenn man wie Lewis Carroll stottert oder wie Charlotte Brontë in unmenschlichen Internaten und in den Tiefen des Yorkshire-Moors aufgewachsen ist, die Mutter tot, der Vater überstreng? Wie kommuniziert man dann?
Es gibt Tausende von künstlerischen Werdegängen, doch etwas, das wie eine Art Leitmotiv in vielen Künstlerbiografien auftaucht, ist eine grosse Unruhe in jungen Jahren, eine Reise, ein Verlust, der Wegzug von einem Zuhause und das Gefühl, diese emotionale Umwälzung nicht kommunizieren zu können. Das Gefühl, plötzlich nicht mehr richtig verstanden zu werden.
Der Autor W. Somerset Maugham wurde als Diplomatenkind in Paris geboren, lernte erst als Zweitsprache Englisch und wurde für seinen Akzent an den englischen Internaten gehänselt. Salman Rushdie wuchs zwischen den Kulturen des postimperialen Indiens und Englands auf. Hossein Amini, Oscar-prämierter Drehbuchautor, zog mit elf Jahren von Teheran nach England. Manchmal geht es vielleicht um kleinere, weniger dramatische Umwälzungen und Unruhen: interkulturelle Spannungen, so unscheinbar sie sein mögen, etwa zwischen der englischen und amerikanischen Kultur wie bei Agatha Christie oder Frances Hodges Burnett. Agatha Christies Vater war Amerikaner, Frances Hodges Burnett zog als Jugendliche von England nach Knoxville, Tennessee. Als Kind spürt man solche Verpflanzungen extrem, wenn auch oft unterbewusst. Man sieht eine neue Welt, aber zuerst nur von aussen. Dazugehören tut man noch nicht, auch nicht verstehen. Langsam bemerkt man, dass andere Menschen auch nichts verstehen, dass die, die im Inneren dieser neuen Welt aufgewachsen sind, nichts Aussergewöhnliches darin sehen, weil sie sie nie von aussen betrachtet haben. Und dann will man ihnen vielleicht davon erzählen.
Eine meiner frühsten Erinnerungen, nachdem ich aus Amerika in die Schweiz gezogen bin, ist die, dass ich nie Deutsch sprechen wollte. Die älteren Geschwister waren laut und gesprächig, ob auf Deutsch oder Englisch machte für sie keinen Unterschied. Ich aber war still. Mit drei oder vier Jahren sagte ich auf Deutsch immer nur «Nein», egal was der Kontext des Gesprächs war. Ein älteres Pärchen mit Hund spazierte an uns vorbei und grüsste. «Nein.» – «Schoggi oder Erdbeer?» – «Nein.»
Eher unsympathisch, dieses Kind, doch im Rückblick bin ich froh um jedes dieser Jahre, in denen ich mich noch nicht traute, Deutsch zu sprechen, vor allem wenn es tatsächlich das ist, was in mir das Interesse für das Schreiben und Musizieren weckte.
Mittlerweile spreche ich ganz gerne. Und doch finde ich, das Sprechen wird weitherum ein bisschen überbewertet. Sich laut zu äussern wird als ehrlicher betrachtet, ist direkt, sinnlich, unmittelbar. Dabei gibt es so viele andere Ausdrucksmöglichkeiten, die oft präziser und interessanter sind. Man hört immer wieder, ein Bild sage mehr als tausend Worte. Auch mit einigen sorgfältig gewählten Worten lässt sich ein Bild konstruieren. Ein musikalischer Akkord kann ganze Gefühlswelten hervorzaubern, und Düfte, Kochen, Mode oder die Natur sind ebenfalls Sprachen, die überaus machtvoll jenen Menschen Geschichten erzählen, die sich Zeit für sie nehmen. Der Prozess allerdings, der diese Geschichten entstehen lässt, ist kein schneller, und manchmal auch nicht spektakulär. Es geht dabei zuerst nur um das Stillsein, um das Denken, das Vorausdenken, um Geduld.
Es ist die Ellipse am Ende eines Abschnitts,
die die karge Weite einer Landschaft spürbar macht.
Als ich mit dem Klavierunterricht anfing, sagte meine Klavierlehrerin, wichtig seien nicht die Töne, die man trifft, sondern der Ort dazwischen. Das Nichts zwischen einem C und einem E, das ist Musik. Das ist das Schöne, das einen berührt. Es sind die Pausen – Energie, Stille und Leere –, die gute Musik ausmachen. Ohne dieses Nichts lässt Klang gleichgültig. Es ist eigentlich ein kosmischer Witz, ein Paradox: Nichts ist wichtig, aber das Nichts ist am wichtigsten.
Das Gleiche gilt für das Schreiben. Was man nicht schreibt, was man weglässt, was man stundenlang austüftelt und dann wieder streicht, ist genauso wesentlich wie das, was schliesslich auf dem Papier zu sehen ist. Es ist die Ellipse am Ende eines Abschnitts, die die karge Weite einer Landschaft spürbar macht. Es ist auch diese Leere, die etwas Universelles zu etwas Persönlichem machen kann und umgekehrt. Diese Hohlräume, die man sich in Gedanken ausmalen und dann selber betreten kann, sind das, was Horror beängstigend macht, Thriller spannend, Dramen tragisch und berührend.
Also suchen Künstler ihre Stimme dort, wo sie das Gefühl haben, sie könnten diese grossen Weiten finden, formen, überbrücken und weitergeben. Weniger esoterisch ausgedrückt: ich denke, dass alle Menschen einen Weg suchen, um sich mitzuteilen und dadurch ihr Selbst zu bestätigen. Man versucht immer wieder der Welt zu sagen, wer man ist, was man fühlt, und hofft dann, dass ein Echo zurückkommt und dass es andere gibt, die ebenso fühlen. Musik und Schreiben sind auch nur Small Talk. «Ist das Wetter nicht schön heute?» – «Ja.» Und schon ist eine ganze Welt entstanden, die Unendlichkeit zwischen 0 und 1.
Dieses ganze Gerede soll niemanden davon abhalten, zu Buchlesungen zu gehen oder mit Autoren zu sprechen. Die meisten Autoren sind liebe, normale Menschen, und ich sehe schon, wie sich einige gegen die Idee sträuben, dass sie nur wegen einer bewegten Kindheit gut schreiben. Ausserdem bin ich – und ich würde meinen, alle Schriftsteller – dankbar für die Leser, die sich in dieser schnelllebigen Welt die Zeit nehmen, zu einer Lesung zu kommen. Vielmehr finde ich es wichtig, die verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten zu differenzieren, und das Stille, oder das Nichtverbale, genauso zu schätzen wie das Gesprochene. Das Schweigen ist nicht etwas, das man nur dulden soll, sondern das integral zu allen Kunstarten gehört, die man jemals geliebt, gelesen oder gehört hat. Und letztlich, wenn es zutrifft, dass Literatur und Musik öfters als Mittel gewählt wurden, um das Verbale zu umgehen, soll das keine Schwäche sein, sondern ein anderer, gleichwertiger Weg.
Eigentlich hat es Terry Pratchett bei der Verlagsparty in New York genau richtig gemacht. Was musste er mir oder den anderen Gästen noch sagen? Er hatte schon 50 Bücher mit seinen Gedanken gefüllt. Charlotte Brontë hätte es bei dem Dinner bei den Thackerays auch nicht besser ausdrücken können. Sie hat ihre Stimme gewählt, und die war das Schreiben. Auf ihre Art, und mit ihrem Schweigen, hat sie alles, was man über sie, die Schriftstellerei, die Musik und die Kunst wissen muss, gesagt.