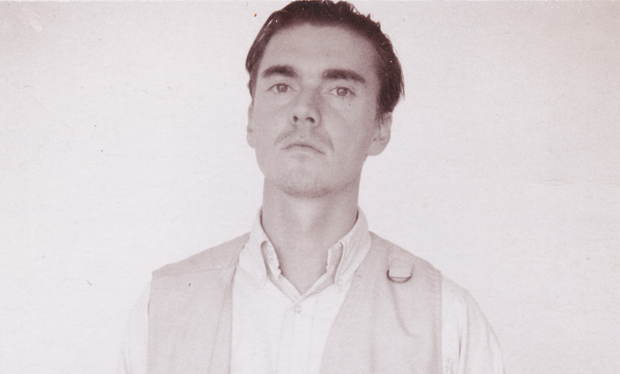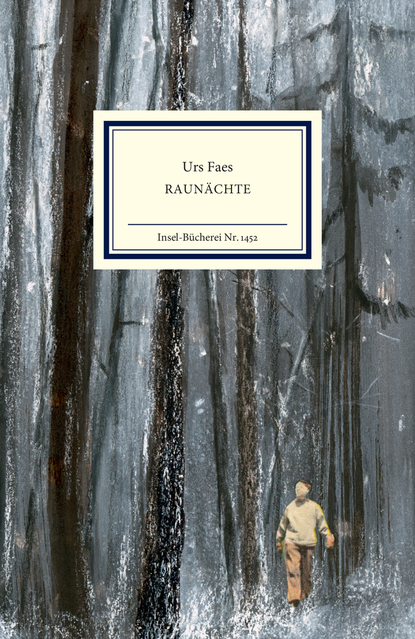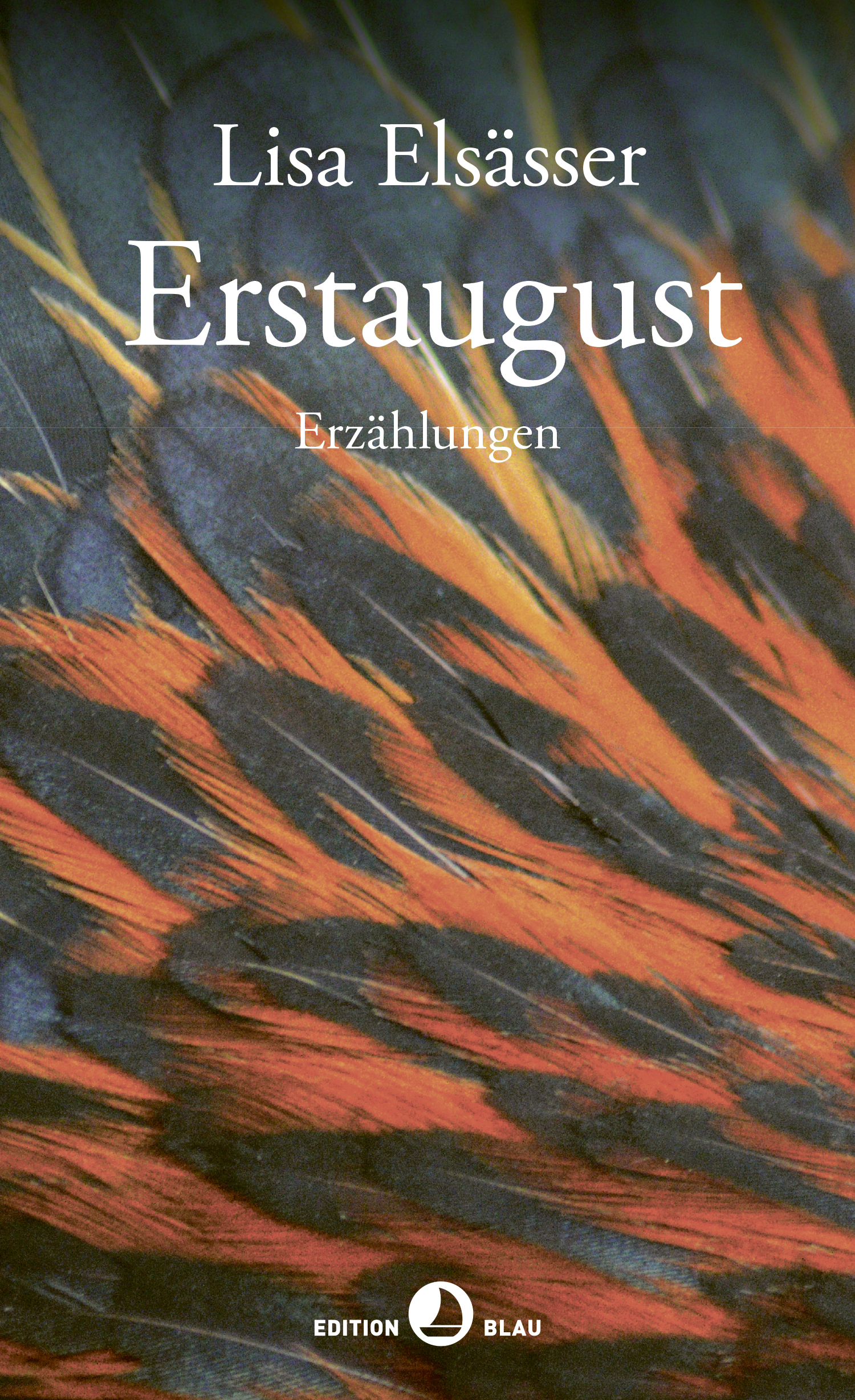Der Reporter stirbt für sich allein
Gedanken zu Wesen und Habitus des Reporters.

Es gab einmal ein Spiel, das hiess «Reporter». Wenn ich mich richtig erinnere, war auf dem Kasten, der es enthielt, ein Mann in einem Trenchcoat oder Cordsakko abgebildet, der telephonierte. Im Hintergrund eine Weltkarte, davor ein Flugzeug und irgendwo sass jemand am Schreibtisch vor einer Tasse Kaffee. Das Wichtigste war aber eine gelbe Telexmaschine, die auch gleichzeitig das magische Gadget des Spiels war: Wer ihre Räder wie die Farbbänder einer Schreibmaschine weiterdrehte, erfuhr, glaube ich, in einem schmalen Sichtfeld von seinem nächsten Auftrag «auf weltweiter Jagd nach Nachrichten», so der Untertitel des fabulösen Brettspiels. Die romantische Idee vom Reporterberuf, die durch das Spiel in meiner von der Neugier befeuerten Kinderseele entstand, entsprach ziemlich genau dem Urbild des Reporters, wie es Tintin, der gezeichnete Held des belgischen Künstlers Hergé, verkörperte. Tim, so sein Name in der deutschen Version des Comics, war stets mit Trenchcoat und Hund Struppi auf der Seite des Guten unterwegs, um gegen Verschwörer und Verbrecher zu kämpfen. Den Reporterberuf übte er dabei eigentlich nur en passant aus, er war Begleitumstand und Auslöser der spannenden Abenteuer, die ihn von einer Schwarzen Insel vor Schottland bis in die Wüste der Pharaonen, in den Dschungel des Arumbaya-Fetischs und die Anden zum Sonnentempel rund um die Welt auf Reise schickten. Damit waren in meinem Kopf die Parameter für die Form «Literarische Reportage» gesetzt. Nicht von der Egon-Erwin-Kisch-Seite her, also von der klassischen Reportage im literarischen Stil, sondern aus der als Literatur verstandenen Idee der Reportage, die im Grunde nichts anderes ist als die Novelle, wie Goethe sie definierte: die kurze Erzählung einer unerhörten Begebenheit. Dass es sich darin meist um die unheimliche Seite des Lebens dreht, ergibt sich fast von selbst. Denn die gute literarische Reportage ist im Grunde nichts anderes als der verzweifelte Versuch, die Abgründe der menschlichen Seele auszuloten, das eigentlich Unfassbare in Worte zu fassen. Dabei gilt die alte Sentenz des Dichters Terenz als Grundsatz: Ich bin Mensch, nichts Menschliches ist mir fremd. Unerschrockenheit als Herangehensweise, Offenheit dem Geschehen gegenüber, aber auch das Akzeptieren unserer grundsätzlichen Fremde, wo immer wir auch sind, denn wenn nichts fremd ist, ist es im Grunde alles. «What am I doing here?» heisst denn auch ein Band des vielleicht vorbildlichsten aller modernen Reporter und Reisenden im Geiste Tintins: die Rede ist von Bruce Chatwin, dessen Neugier ihn bis in die entlegensten Winkel der Welt – vom Hindukusch bis nach Patagonien – führte, um dort die unglaublichen Geschichten der Menschen, die er traf, aufzuschreiben. Der ideale Text reibt sich dabei kopfschüttelnd an dem Sand, den er sich aus den staunenden Augen zu wischen versucht.
Was eine gute literarische Reportage noch braucht? Den kalten, klaren Blick auf das Surreale im Leben, «schön wie die zufällige Begegnung eines Regenschirms mit einer Nähmaschine auf dem Seziertisch» (Comte de Lautréamont), den detektivischen Spürsinn eines Kriminologen und das gleichzeitige Wissen um die Perspektive des Aussenseiters, der den «Fall» nie ganz klären wird. Und immer wieder: die Reise. Denn wenn eine Schriftstellerin wie die Grossmeisterin der erratischen Prosa, Annemarie Schwarzenbach – im offenen Ford mit Bündner Kennzeichen an der Seite ihrer Freundin Ella Maillart –, durch die Wüsten fuhr und von den Reisen ihre Erzählungen mit nach Hause brachte, waren das Texte, die bis heute so sternenklar funkeln wie die schwarzen Nächte unter schmerzlich erlittenen Fernhimmeln.
Auf alle meine Helden der literarischen Reportage trifft aber zu, was Blumfeld in ihrem Lied «Anders als glücklich» singen: «Ein Kind von Traurigkeit/alt und gebrechlich/zwischen Wahn und Wirklichkeit/es endet tödlich/ich weiss, so wird es sein/sterben ist erblich/und jeder stirbt für sich allein.»
Ja, literarische Reportagen schreiben in Einsamkeit gegen den Tod an.