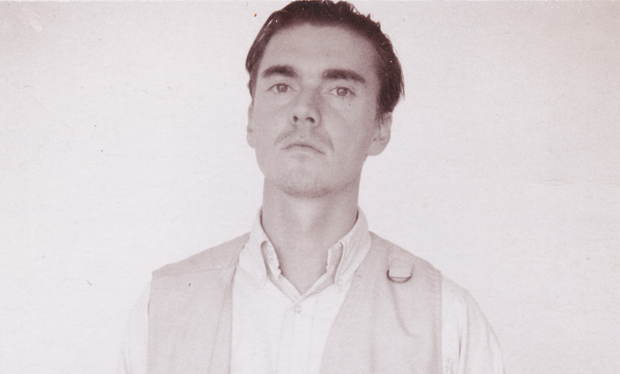Am Küchentisch der europäischen WG
Er wagt sich immer wieder aus der gemütlichen helvetischen Stube heraus – um etwa in Sibirien mit widerborstigen Katern zu hausen: Urs Mannhart ist mit Freud und Leid des Reporterlebens bestens vertraut. Und seit kurzem auch mit dem schmalen Grat zwischen literarischer Fiktion und urheberrechtlicher Realität.

Urs, begeben wir uns auf eine Reise durch die letzten zehn Jahre deines Schaffens. 2004 erscheint dein Erstling «Luchs». Darin geht es um ein Luchsprojekt im Berner Oberland. Dein zweiter Roman spielt bereits südlich des Simplons. Der neuste nun in ganz Europa. Auch als Reporter hast du dich immer weiter weg von zuhause bewegt: Einst hast du aus der Berner Agglomeration berichtet, inzwischen aus Russland oder dem Kosovo. Ist dir die Schweiz für deine Geschichten zu eng geworden?
Das würde ich so nicht sagen. Grossartige, welthaltige Geschichten können auch in einem Kaff spielen. Jede Geschichte hat ihren Ort. Mit «Luchs» wollte ich einen Roman schreiben, der das romantische Naturbild der Städter mit dem ablehnenden Städterbild auf dem Land konfrontiert. Hierzu bildete das Berner Oberland den passenden Hintergrund. Bei «Bergsteigen im Flachland» hingegen war es mein Ziel, ein europäisches Bild, so fragmentiert unser Kontinent auch ist, zu zeichnen. Aber es wäre dies auch mit helvetischen Schauplätzen zu erreichen, schliesslich gibt es genügend Menschen, die die Welt in die Schweiz tragen.
Was gab denn die Initialzündung zu «Bergsteigen im Flachland»?
Es waren vor allem Reisen, die mir Europa nähergebracht haben. Unser Kontinent gleicht einer WG mit vielen verschiedenen Zimmern. Bleibt man im schweizerischen Zimmer sitzen, scheint alles mehr oder weniger perfekt zu funktionieren. Doch spätestens wenn man am Kühlschrank auf Mitbewohner trifft, kann es zu Konflikten kommen, und die WG-Bewohner merken: Sie sind aufeinander angewiesen.
In einer leicht chaotischen WG wohnt auch Thomas Steinhövel, einer der Protagonisten deines umfangreichen Romans, in dem viele unterschiedliche Geschichten passgenau ineinanderlaufen. Hattest du den Plot von Anfang an akribisch geplant?
Im Gegenteil. Ich habe sieben Jahre lang an dem Buch geschrieben – wobei ich stets auch anderweitig beschäftigt war, als Velokurier und als Nachtwächter in einem Asylzentrum. Der Roman war lange ein chaotisches Puzzle verschiedener Figuren, Schauplätze, Migrationsbewegungen. Der Reporter Thomas Steinhövel ist erst später dazugestossen. Er lieferte das Amalgam, das lose Teile verbindet.
Du bist selbst auch Reporter. Steinhövel seinerseits reist für einen Hungerlohn durch Europa, um Reportagen zu recherchieren, die dann von unverständigen Redaktoren zusammengestrichen werden. Wie autobiographisch ist die Figur?
Von allen Figuren spielt bei Steinhövel sicher am ehesten Biographisches rein. 2008 habe ich mit Beat Schweizer den Kosovo besucht, der «Kleine Bund» stellte uns vier Seiten zur Verfügung. Danach kam es leider zu keiner Publikation mehr, weil dem Blatt die Mittel fehlten. Insofern geht es tatsächlich um eigene Erfahrungen – aber schliesslich ist es ein Roman, vieles ist rein fiktiv, Steinhövel ist ein prototypischer Reporter. Für gewisse Schauplätze, die er im Roman besucht, dienten mir aber die Reportagen Thomas Brunnsteiners als Vorlage, eines österreichischen Reporters, dessen Arbeiten ich sehr schätze. Seit 1999 habe ich seine Reportagen, die in der NZZ erschienen, gesammelt. Ich habe mir zudem erlaubt, eine Figur aus einer seiner Reportagen zu entlehnen und literarisch weiterzuentwickeln.
Der Niedergang des (Reportagen-)Journalismus ist sein Leitmotiv. Steinhövel klagt darüber, dass niemand mehr lange Reportagen liest. «Reportagen zu schreiben ist kein Beruf mehr», heisst es gegen Ende des Romans. Bist du da optimistischer als deine Figur?
Was die Medien angeht, bin ich tatsächlich nicht besonders zuversichtlich: Heute kann man sich schnell informieren, aber die kurze Form einzelner Informationen schafft dabei erhebliche Schwierigkeiten. Ein paar Dinge stimmen mich auch hoffnungsvoll: z.B. das Magazin «Reportagen» – dank dieser einzigartigen Publikation kann ich wieder längere journalistische Arbeiten veröffentlichen.
Wieso aber sind die Reportagen jenseits solcher Nischenpublikationen auf dem absteigenden Ast? Sind es ökonomische Zwänge, die die Redaktionen grösserer Zeitungen davon abhalten, langen Texten viel Platz einzuräumen, oder haben sich die Lesegewohnheiten in eine Richtung verändert, die Kürze verlangt?
Beides. Das liegt einerseits an der auf den Redaktionen weitverbreiteten Angst, der Leserschaft zu viel zuzumuten – alle fürchten sich, eine Bleiwüste zu produzieren. Andererseits war eine Wochenendbeilage wie die «NZZ-Zeitbilder» sicher enorm teuer, trotz des geringen Honorars, das die Journalisten bekamen. Auf jeden Fall ist es schade um jede Zeitung, die keine Reportagen abdruckt. Wenn man sich die jüngsten Abstimmungsresultate ansieht, befürchte ich, dass das Verständnis für etwas komplexere Zusammenhänge auch deswegen mehr und mehr verlorengeht.
Den Eindruck haben wir auch. Wenn nun aber für die Leser die Länge eine Herausforderung ist, welche Anforderungen stellt dann eine gute Reportage an dich als Autor?
Zunächst einmal ganz praktische: für jemanden, der es gewohnt ist, oft allein zu sein und viel Zeit für seine Notizen zu haben, ist das Unterwegssein in einer Gruppe anstrengend. Im Norden Sibiriens zum Beispiel, wo ich letztes Jahr war, teilte ich mir mit einem Fotografen, einer Übersetzerin und einem widerborstigen Kater eine Einzimmerwohnung, drei Wochen lang. Da bleibt nicht viel Ruhe, um zu schreiben. Gleichzeitig ist eine Reportagereise enorm wertvoll, eine einzigartige Erfahrung, die tiefe Freundschaften wachsen lässt.
Wie muss man sich die Planung einer solchen Reise vorstellen: Wie kommst du zu der sibirischen Katze, wer öffnet dir die Türen zu den fremden Welten?
Häufig bin ich – zusammen mit dem Berner Photographen Beat Schweizer – an abgelegenen Orten unterwegs, so auch in Sibirien. Da ist das Verständnis für Journalisten nicht besonders gross. Somit kann man den Leuten nicht einfach das Diktaphone ins Gesicht halten, sondern braucht eine Vertrauensperson – und Zeit. Deswegen arbeiteten wir gerne mit Jelena Ilinowa, einer ukrainischen Übersetzerin. Ohne sie wäre vieles aussichtslos gewesen. Anfangs blieben Beat und ich oft im Hintergrund und liessen sie mit den Leuten schwatzen oder ein Bier trinken. Manchmal bestand sogar der Verdacht, wir seien Gesandte von Moskau, die überprüfen sollen, ob gut gearbeitet wird. In den ersten drei Tagen muss man als Reporter gar nichts erreichen wollen. Erst wenn die Leute vergessen, dass wir da sind, kommen die Geschichten ins Rollen. Kommen Themen zur Sprache, die ich fragend nie anzusprechen wagen würde.
Und abgesehen von der praktischen Seite: Wie gehst du handwerklich vor – steckt in einer gelungenen Reportage mehr Journalismus oder mehr Literatur?
Wenn ich unterwegs bin, denke ich oft, es wäre doch besser und jedenfalls gemütlicher, einfach Schriftsteller zu sein. Und wenn ich als Schriftsteller arbeite und also tatsächlich gemütlich herumsitze, denke ich oft, es wäre eben schon wertvoll, wieder einmal aufzubrechen für eine Reportage. Handwerklich sind die beiden Dinge, wenn ich am Schreibtisch sitze, miteinander verwandt, unterscheiden sich aber im Anspruch: Bei einem Roman bin ich frei, kann über alles schreiben, alles erfinden, solange es im Rahmen der Fiktion glaubwürdig ist. Eine Reportage hingegen muss überprüfbar bleiben, journalistisch wasserdicht sein, egal wie literarisch sie daherkommt. Bei der Erarbeitung von «Bergsteigen im Flachland» fand ich es witzig, dass meine Lektorin oft gerade jene Stellen unglaubwürdig fand, die auf eigenen Reisen basierten. In solchen Fällen kann ich nicht darauf pochen, dass ich es nun mal tatsächlich so erlebt habe, denn die Geschichte muss ja für die Leserin, den Leser funktionieren. Also muss ich das Ganze überarbeiten, anders beschreiben.
Gerade haben wir die Episode gelesen, in der sich Thomas Steinhövel in einen norwegischen Helikopterkurs einschleicht, ohne zu bezahlen. Wie hast du da recherchiert?
Das ist genau so ein Beispiel für eine wahre Geschichte, die die Lektorin als unglaubwürdig taxiert hat! Ich habe tatsächlich versucht, diesen Kurs zu besuchen. Erst in Norwegen erfuhr ich, dass Journalisten nur zu speziellen Kursen Zugang erhalten – die aber, das schien mir klar, ein falsches Bild von der Sache vermitteln würden. Weil ich den ganz gewöhnlichen Kurs absolvieren wollte, habe ich mich im Windschatten anderer Teilnehmer hineingeschmuggelt. Meine Lektorin hat mir die Episode erst nicht glauben wollen, und so habe ich zusätzliche Erklärungen einarbeiten müssen, um die Sache plausibler zu machen.
Die literarische Reportage hat in der Schweiz durchaus Tradition, Hugo Loetscher hat sie gepflegt oder auch Niklaus Meienberg, den du als grosses Vorbild bezeichnest. Was fasziniert dich an ihm?
Seine schnoddrige und zupackende, linke Einstellung und dass er ein Firmengelände lieber über den Zaun betrat als durch die Rezeption. So kommt es zu guten Geschichten. Andererseits glaube ich, dass ein Roman auch Dinge leisten, aufzeigen kann, die einer Reportage aufzuzeigen nicht möglich sind. In meinem Buch zum Beispiel beschreibe ich anhand einer Figur die Arbeitsbedingungen, unter denen Produkte hergestellt werden, die wir ganz selbstverständlich konsumieren. Und ich weiss von einigen Lesern, dass sie Erdbeeren aus Huelva ganz anders betrachten, seit sie in meinem Roman gelesen haben, wie der rumänische Mathematiklehrer Mihai Tinescu dort sein Geld verdient.
Findest du, dass es der Schweizer Literatur oder überhaupt den zeitgenössischen Romanen an politischer Aktualität fehlt? Oder anders: braucht’s wieder mehr Meienberg in unserer Literatur?
Es wäre unklug, das zu fordern. Häufig zeigen sich die Dinge nicht so klar, und eine erst als banal wahrgenommene Kurzgeschichte wirft plötzlich einen langen Schatten, dessen Kontur klar politisch wirkt. Vielleicht müssen nicht die Schriftsteller politischer werden, sondern darf man die Gesellschaft zärtlich einladen, Literatur politischer wahrzunehmen. Was «Bergsteigen im Flachland» betrifft, so ist es mir natürlich willkommen, wenn mein Roman auch politisch verstanden wird.
Du machst diese Lesart ja sehr explizit und gewissermassen unumgänglich. Marlene Steinhövel, eine deiner Figuren, attestiert der Schweiz ganz unverhohlen eine «xenophobe Stimmung». Ist sie dein Sprachrohr?
Ich kann meine Figuren nicht als Sprachrohr missbrauchen. Marlenes Ansichten sind überspitzt, es dienen ihre Meinungen niemandem als dem Roman – aber klar, das Thema ist mir wichtig. Die Xenophobie erlebe ich zum Beispiel bei meiner Arbeit als Nachtwächter im Asylzentrum. Im Zentrum wohnen 160 Menschen. Und jedes Mal, wenn es zu Konflikten kommt – was auch zu Messerstechereien und dem Heranbrausen der Ambulanz führen kann –, wird im Dorf wieder über die Asylanten gelästert. Aber wenn man 160 Schweizer in einem derart desolaten Gebäude zu sechst in einem kleinen Zimmer zusammenpferchen würde, ginge es sicher auch nicht lange, bis es zur ersten Schlägerei käme.
Du bist oft im Ausland unterwegs. Wie nimmt man dich als Schweizer dort wahr?
Darauf kann ich am besten mit einem Erlebnis antworten, das ich auf einer Nachtzugsreise durch die Ukraine machte. Der Mann, mit dem ich das Abteil teilte, vernahm erstaunt, dass die Schweiz kein Meer hat. Da meinte er: «Wenn ihr wirklich ein Meer wolltet, würdet ihr eines bauen, das Geld dazu habt ihr ja.» Treffender kann man kaum beschreiben, als wie wohlhabend die Schweiz im Ausland gilt. Ähnlich interessant finde ich aber das Bild, das die Schweizer den Ausländern von sich zu vermitteln versuchen: Noch immer muss man mitanhören, wie Schweizer Fremden erklären, dass sie aus dem Land der vielen Berge und der vier Sprachen kämen. Dieser Kitsch macht mich jeweils ganz grantig! Solche Leute würde ich am liebsten schütteln und ihnen sagen, dass sie endlich anerkennen sollten, dass in der Schweiz heute weit über hundert Sprachen gesprochen werden.
Lass uns am Ende von der Welt in die Schweiz zurückkehren. In den USA gibt es den Trend, dass berühmte Journalisten den grossen Zeitungen den Rücken kehren und wieder lieber über Lokales berichten. Du hast im Lokalen angefangen, sowohl als Journalist wie als Autor – könntest du dir vorstellen, wieder dorthin zurückzukehren?
Ja. Seit einiger Zeit wohne ich in Moutier; es reizt mich, etwas über diesen Ort zu schreiben. Ich verstehe noch nicht, was die Separatisten umtreibt, aber die Idee eines neuen Kantons finde ich bestrickend schön. Das sind revolutionäre Entwürfe, das ist Weltpolitik in Lokalformat! Themen, die vor der Haustür liegen, bin ich ganz und gar nicht abgeneigt.
Das vorliegende Gespräch mit Urs Mannhart fand anlässlich des 19. Internationalen Literaturfestivals Leukerbad im frühen Juli 2014 statt. Wir danken den Presse-verantwortlichen für die freundliche Organisation.
Urs Mannhart bei «Zürich liest»: Freitag, 24. Oktober 2014, 19.00 Uhr, Cabaret Voltaire, Zürich