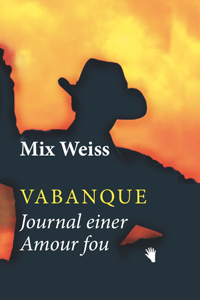Die Freiheit, die wir meinen?
Sein Verlag bewirbt Matthias Nawrats Romandebüt als Zeugnis der «Generation der Unentschlossenen». Aber: gibt es diese Generation überhaupt? Und wenn ja: was macht sie aus? Der Newcomer aus Biel über den «Zwang zur Freiheit», die Luxusprobleme der «Twentysomethings» und die Lösung für alle Probleme: den Würfel.

Matthias, hältst du dich für «unentschlossen»?
Ich wäre wohl kein Schriftsteller, wenn ich unentschlossen wäre – man braucht einen starken Willen, wenn man all diese Jahre des einsamen Arbeitens an einer fixen Idee durchstehen will. Allerdings, so viel stimmt, ist das Schreiben für mich auch ein Ausweg aus einer Art der Unentschlossenheit. Ich wusste zwar nach dem Abitur, dass ich viele Möglichkeiten habe, meine Zukunft zu gestalten – aber ich wusste, wie wahrscheinlich viele andere auch, nicht, was ich eigentlich damit anfangen will. Ich habe dann zunächst mit dem Biologiestudium angefangen, studierte dann aber nebenbei alles Mögliche – wie Philosophie oder Geschichte oder Soziologie. Als Schriftsteller kann ich nun alles sein, zumindest in der Vorstellung.
Du gehörtest also einmal dazu, zur sogenannten «Generation der Unentschlossenen»?
Wenn man so will, schon. Ich glaube aber nicht, dass «Wir zwei allein» eine Generation der Unentschlossenen porträtiert. Diese «Generation» ist eher eine Kategorie für die Werbung als ein soziologisches Phänomen.
Konkreter?
Ich weiss nicht, ob man von einer ganzen Generation Unentschlossener überhaupt sprechen kann, denn es stimmt nicht, dass wir alle – die «Jungen» zwischen 20 und 35 – unentschlossen sind. Wir leiden heute allerdings mehr unter dem «Sichentschliessenmüssen». Unter diesem Druck entscheiden wir uns aber durchaus. Die Entscheidungen beziehen sich bloss auf kürzere Zeiträume. Empirisch betrachtet und bezogen auf zwischenmenschliche Be-ziehungen ist es heute beispielsweise viel leichter, mehrere Liebesbeziehungen hintereinander zu führen, als das vor 50 Jahren der Fall war. Und diese Möglichkeiten will auch niemand missen! Man entscheidet sich ganz grundsätzlich mal nach hier, mal nach dort. Ich glaube, wir sind einfach viel stärker mit dem Zwang zur Freiheit konfrontiert, als es die Generationen vor uns waren – können aber auch besser damit umgehen!
«Zwang zur Freiheit» – das klingt aber auch nach einem zusammengeschusterten Luxusproblem.
Klar ist es ein Luxusproblem! Man könnte aber genauso gut sagen: Leute, die heute zu etwas gezwungen werden, haben den Luxus, sich eben nicht entscheiden zu müssen. Und weil wir eben diese Art von Luxus haben, leiden wir. Ich glaube, dass Entscheidungen wie ein Befreiungsschlag wirken können. Es gibt immer die Phase vor der Entscheidung, in der man hin und her gerissen ist und unter dem Druck, sich entscheiden zu müssen, leidet, bis man sich eben durch die Entscheidung aus dieser Sackgasse manövriert – genau das wirkt wie ein Befreiungsschlag. Da steckt nicht umsonst das Wort Freiheit drin.
Der Philosoph Isaiah Berlin hat den Begriff in negative und positive Freiheit aufgespaltet. Werden wir also hier etwas genauer: Handelt es sich beim Entscheiden um die Freiheit von etwas oder Freiheit zu etwas?
Beides! Weil man erstens entscheiden darf – das ist die Freiheit zu etwas. Und danach, wenn man entschieden hat, diktiert einem das, wozu man sich entschieden hat, eine Weile lang, wie man sich zu verhalten hat. Das ist auch eine Form der Freiheit, weil man dann nicht mehr immer wieder neu wählen muss, man ist von diesem Zwang befreit. Die Entscheidung vereinigt beide Seiten des Begriffs. Und unser Leben besteht daraus – niemand will doch unendlich lang in einem Zwischenzustand schweben, also müssen wir aktiv werden.
Warum nicht einfach würfeln, wenn wir unentschlossen sind?
(lacht) Es gibt ein Buch von Luke Rhinehart aus den 1970ern. Das heisst «Der Würfler». Es geht um einen Psychoanalytiker, der herausfindet, dass es ihn befreit, wenn er einfach alles auswürfelt. Das wendet er dann auch in der Psychoanalyse an und das Ganze entwickelt sich im Verlauf des Buches zu einer sozialen Bewegung. Die Idee bringt es ein Stück weit auf den Punkt. Denn: entscheidend ist nicht unbedingt, was man macht, sondern dass man etwas macht. Letztlich kommt man nämlich aus diesem Spannungsverhältnis, in dem man sich fragt: «Was wäre gewesen, wenn…», nie heraus. Eine Never-Ending-Story – aber würfelt man alles aus, dann ist das wenigstens eine lineare Story, weil man diese Gleichzeitigkeit von mehreren Optionen in einen Zeitverlauf reiht, so dass man die Ausnutzung dieser Möglichkeiten optimiert.
Mich erinnert diese Argumentation an die Geschichte vom «Ossi vor dem West-Kühlregal», der – statt sich mit bunten Produkten einzudecken – unverrichteter Dinge wieder geht, weil er sich nicht entscheiden kann…
…das trifft das Dilemma mit den materiellen Entscheidungsproblemen ganz gut. Ich komme ja ursprünglich aus Polen. Und ich war schockiert, als ich als Kind unmittelbar vor dem Mauerfall nach Deutschland kam und plötzlich im Supermarkt erstmals zwischen Snickers, Mars, Bounty, Raider und Milky Way wählen musste, mich also entscheiden musste. Denn: wir «drüben» hatten diese vielen Möglichkeiten nicht, wir hatten im Glücksfall nur die Entscheidung zwischen «Schokolade» oder «keine Schokolade».
Wie hast du als Kind auf diese plötzliche Vielfalt an materiellen Auswahlmöglichkeiten reagiert?
Ich bin diesem Schock mit einer konsequenten Überaktivität begegnet und habe versucht, alles zu konsumieren, was möglich war. Irgendwann gab es dann eine Gegenreaktion und ich entwickelte eine Art von Nostalgie gegenüber dem alten Gesellschaftssystem, in dem ja objektiv betrachtet fast nichts möglich war – ich gefiel mir ein bisschen in der Rolle eines Asketen. Vielleicht lag das auch daran, dass ich selber nicht dort erwachsen wurde, denn meine Eltern haben sicher viel mehr unter dem Mangel gelitten als ich. Sie durften weder am Kühlregal noch politisch viel entscheiden und waren auch zwischenmenschlich oftmals stark eingeschränkt.
Sind wir also eher orientierungslos als unentschlossen?
Vielleicht. Und zwar könnte das vor allem für bestimmte Lebensphasen und vornehmlich für das erste Drittel des Lebens gelten, in dem man die Weichen für den Rest stellt. Es fängt beim einzuschlagenden Bildungsweg an: Die Leute, die eine Ausbildung machen wollen, wählen heute nicht mehr das, was Vater und Urgrossvater schon machten. Und die können einem bei all diesen neuen Möglichkeiten auch keine Orientierung bieten, denn sie kennen sie ja selbst nicht. Auch bei den Leuten, die heute aus dem Gymnasium kommen, ist die Hauptfrage: «Was mache ich denn jetzt?» Es gibt dementsprechend auch mehr Studiengangswechsler als vor 50 Jahren. Und wenn man mit dem ersten Studium fertig ist, stellt sich die gleiche Frage zum wiederholten Mal…
…am Ende wird man vor lauter Orientierungslosigkeit Schriftsteller?
(lacht) Ja, oder Künstler. Aber auch die Kunstszene ist heute leicht desorientiert. Sie hat keinen wirklichen Feind mehr! Die wissen eigentlich gar nicht mehr, was sie kritisieren sollen. Die Kunstkritik der 1960er Jahre hat unter anderem eine Freiheit und eine Selbständigkeit des Individuums gefordert! Das ist aber in unseren modernen Produktionsverhältnissen längst erreicht. Jeder macht heute nur noch Projekte, zwei Jahre hier, drei Jahre dort. Man schränkt sich und seine vielen Freiheiten höchstens von Projekt zu Projekt ein. Sogar Beziehungen sind zu Drei-Jahres-Projekten geworden. Ich stelle fest, dass genau deshalb in meinem Freundeskreis eine gewisse Sehnsucht nach festen familiären Strukturen spürbar ist. «Jetzt bauen wir ein Haus, dann bekommen wir zwei Kinder und sind die klassische Familie.» Man schaue sich nur die sogenannten «alternativen» Familien im Prenzlauer Berg in Berlin an – wer hätte denn vor zwanzig Jahren gedacht, dass das Ideal der Familie ein derartiges Comeback feiern würde?
Dieses Ideal nimmst du in deinem soeben erschienenen Erstling auf. Dein namenloser Ich-Erzähler hat sein Studium abgebrochen und lebt nun als Gemüselieferant, insgeheim träumt er aber von der grossen Liebe und baut sich im Kopf die heimelig-zweisamsten Luftschlösser. Ist er nicht eigentlich einer, den man instinktiv einen «Versager» nennen will?
Nein, er ist eher ein Verweigerer. Er will nicht teilnehmen an der Gesellschaft, weil ihm das zu kompliziert ist. Er hat in gewissem Sinne den Eindruck, dass Handeln sowieso obsolet ist, weil es zu nichts führt. Er ist also aktiv apolitisch. Er führt vielmehr eine Kneipenexistenz, zu Hause bewegt er sich zwischen Sessel und Yuccapalme – gleichzeitig ist sein geistiger Horizont sehr weit. In diesem Loch, das er selber gewählt hat, und in dieser freiwilligen Abgabe aller Entscheidungen taucht dann plötzlich diese Person auf, die unerreichbar erscheint, weil sie sich ebenfalls immer herauswindet und eine Art Projektionsfläche bietet für romantische Vorstellungen: die junge, erfolglose Künstlerin Theres.
Deine ganz eigene Hommage an die Romantik, an das Ideal des positiv gewendeten «Taugenichts»?
Durchaus. Der Protagonist ist ein Romantiker – und Theres, die Weltentrückte, ist sein Objekt der Begierde. Sie hat dunkelste Abgründe, funktioniert gesellschaftlich noch weniger als er selbst – sie ist also anziehend-unberechenbar. Die älteste Geschichte der Welt, wenn man so will…
…und auf «Repeat»: der Ich-Erzähler wiederholt sich permanent in Wort und Tat. Er befindet sich in einer Schleife, einerseits in einer des Alltags und andererseits in einer seiner Träume und Ideale…
Es stimmt, dass er sehr viele verschiedene Träume und Ideen hat, aber ein zentrales Charakteristikum der Idee ist ja, dass sie nicht unbedingt zur Verwirklichung auffordert. Sie ist zwar schön – als Idee –, er will sie aber gar nicht verwirklichen. Heute, so mein Eindruck, wird der junge Erwachsene eher angezogen von etwas, das Widerstand leistet. Er fordert keine Freiheit, sondern Widerstand, könnte man sagen. Er sucht sich also Menschen oder Haltungen aus, die ihm das Gefühl geben, dass eben nicht alles einfach möglich ist, sondern dass man sich schon bemühen muss, um gegen alle Widerstände das zu erreichen, was man will. Das Ziel junger Menschen ist nicht das, was leicht, was einfach und was konsensfähig – sprich: naheliegend – ist. Sie wollen das Exotische, Unerreichbare. Zumindest einen Hauch davon.
Ich behaupte: Der Erzähler leidet, wie viele unserer Altersgenossen, unter «Ennui», wie es die französischen Existentialisten nannten. Unter einer für Grossstädter typischen Langeweile, einer Lethargie. Er ist in diesem Sinne eben kein aktiver, entdeckender – romantischer – Taugenichts, sondern das genaue Gegenteil: ein echter Taugenichts.
Diese Grossstadtlethargie, in der man auf nichts mehr Lust hat, ist etwas, das ich täglich beobachten kann. Da gibt es die systemische Geschlossenheit des Berufslebens, das Angeödetsein vom Mitmenschen, das Gefühl der Übersättigung durch den materiellen Konsum. Im 19. und 20. Jahrhundert waren die Grossstädte das prägende Phänomen, weil das die Orte waren, an denen die Industrialisierung alles umkrempelte und das Bürgertum entstand. Im Prinzip ist aber heute die ganze Welt eine Grossstadt; deswegen ist auch die Sehnsucht grenzenlos geworden.
Kumulierende Sehnsüchte und die damit einhergehende Überforderung des einzelnen gab es aber immer schon. Ist es folglich eine Art Hilflosigkeit des Literaturbetriebs, deine 190seitige Liebesgeschichte als einen «Generationenroman» zu verkaufen und zu besprechen?
Es ist immer konstruiert, wenn jemand behauptet, er hätte etwas über eine bestimmte Generation geschrieben. Merkwürdigerweise gibt es diese Abstempelungen schon lange. Die Lost-Generation, die Beat-Generation, die Popliteratur der 90er: Generation Golf. Und auch heute gibt es Kollegen, die sich sogar selber als Schriftsteller «unserer Generation» bezeichnen. Ich weiss nicht recht, was das soll. Ein Schriftsteller setzt sich ja nicht einfach hin und überlegt sich, ein Buch über seine Generation zu schreiben.
Was überlegt er sich denn?
Er erfindet einen Protagonisten, fühlt sich in diesen ein und lebt, solange er an seinem Buch schreibt, mit diesem Protagonisten mit. So schreibt er ein Stück der Welt mit in dieses Buch ein. Das hat aber für sich betrachtet noch gar nichts mit einer «Generation» zu tun, diese Zuschreibung kommt von aussen. Gerade als Naturwissenschafter weiss ich, dass es sich dabei immer nur um Hilfskonstruktionen handelt. Hilfselemente, um überhaupt über Dinge sprechen zu können oder bestimmte Fragestellungen beantworten zu können.
Dein Ich-Erzähler ist nun jemand, der nicht einmal über Hilfskonstruktionen wirklich kommuniziert. Er verweigert sich auch hier. Und schlimmer noch: Die Grenzen zwischen dem, was der Erzähler sich selbst sagt, und dem, was er anderen mitteilt, verschwimmen. Das hält den Leser zwar bei der Stange, du nötigst ihn aber auch, anzunehmen, dass es sich um eine Art autistischen Erzähler handelt. Er unterfordert sich, seine Umgebung und den Leser.
Sieh es einmal anders: Der ganze Text spielt damit, dass man am Ende nicht mehr weiss, ob das jetzt wirklich passiert ist oder nicht. Kommunikation zerstört Vorstellungen, zerstört Ideen. Würde er beispielsweise mit Theres direkt kommunizieren, wäre ihm ja relativ schnell klar, was gefühlsmässig bei ihr Sache ist: nämlich offenbar nicht das Gleiche wie bei ihm. Aber sein romantisches Streben nach Theres darf nicht aufgelöst werden durch die Kommunikation. Schon allein aus Gründen der Dramaturgie.
Ich habe einmal nachgeschlagen. «Theres» kommt vom altgriechischen «Ther», was so viel bedeutet wie «jagbares Tier». War dir das bewusst?
Tatsächlich? Nein, das war mir nicht bewusst. (lacht) Der Name Theres war für mich nur als Klangbild wichtig. Er wirkte auf mich sehr exotisch, weil ich in Deutschland gross geworden bin. Da gibt es Theresa oder Therese, aber Theres hörte ich zum ersten Mal, als ich in die Schweiz kam. Aber dein Fund verweist auf etwas sehr Wichtiges: Mein Roman lebt von der ganz klaren Aufteilung zwischen nicht definiertem Subjekt und ganz klar definiertem Objekt. Deshalb wiederholt der Erzähler auch ständig den Namen von Theres – er will sie trotz ihrer Ungreifbarkeit greifbar machen.
Er selbst hat keinen Namen.
Richtig. Darin subsumiert sich eigentlich alles Besprochene. Er weiss selbst nicht genau, wer er ist – er wählt sich nämlich nicht. Ich hatte mir verschiedene Namen überlegt, aber ich habe irgendwann festgestellt, dass er keinen Namen haben darf, denn sobald man für etwas einen Namen, einen Begriff hat, wird es greifbar. Für den Erzähler wäre das unpassend und für die Romankonstellation wohl sogar tödlich gewesen.