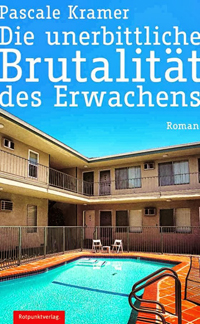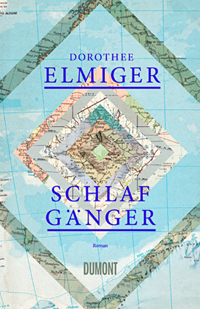… et omnia vanitas.
Ein Essay.

Auf diesen Zeilen möchte ich mich mit dem Gedicht «vanitas» auseinandersetzen, das in meinem Gedichtband «Sablun»1veröffentlicht ist. Es geht mir nicht darum, wie das Gedicht gebaut ist, das ist nicht mein Geschäft. Nur darum, wie es entstanden ist. Ich möchte versuchen, den Schritten seines Entstehens nachzugehen. Kehren wir also an den Anfang zurück! Dort finden wir ein schwarzweisses Pressefoto von suggestiver Kraft, das ich hier mit Feder und Pinsel nachzuzeichnen versuche:

Dieses Foto lässt sich, wie ein Text, auf mindestens drei Arten lesen: Als Pressefoto übermittelt es eine Botschaft über die Zustände in einer Umgebung, die von einem Objektiv eingefasst wird. Damit richtet sich das Foto an den Verstand und befriedigt in erster Linie ein Informationsbedürfnis. Aber Informationen erreichen ihr Ziel besser, wenn sie auch an die Emotionen des Betrachters appellieren. Als Kunstwerk kann das Foto dank eines reflektierten und kalkulierten Einsatzes künstlerischer und «dichterischer» Mittel das ästhetische Gefühl und den Geschmack des Betrachters ansprechen. In diesem Foto kombinieren und verstricken sich diese Funktionen. Damals hatte ich es aus der Zeitung geschnitten und dabei die Legende abgetrennt. Wir alle wissen, wie schwer es ist, mit noch so gut gewählten Worten gegen Bilder anzukommen, «ein Bild sagt mehr als tausend Worte», sagt der Volksmund. Ein Foto schafft es zu denunzieren und zu ermahnen, durch schlichtes Vorführen. Es braucht dafür häufig keine Legenden.
Und wenn man das, was man sieht, beispielsweise einem Radiopublikum mitteilen möchte? Man muss die visuelle Botschaft in eine sprachliche übersetzen. Das habe ich versucht. Entstanden ist der folgende Text. Er ist als ausführliche und subjektive Legende zum Foto zu verstehen, oder als verbale Illustration des visuellen Texts. Die Schwierigkeit liegt darin, dass das Foto entbehrlich wird und der Text selbsterklärend.
Was zeigt nun also dieses Foto? Ein Stück Land, das geografisch klar zugeordnet werden kann: ein ausgetrockneter Arm des Aralsees in Kasachstan und einen verlassenen Fischerkahn mitten in einer verwüsteten Landschaft. Als Titel für den Text habe ich den geografischen Namen gewählt, nicht zuletzt auch wegen des schönen Klangs: Es tönt fast wie ein rätoromanisches Wort.2 Man könnte auch noch erwähnen, dass Aral auch eine Erdölmarke ist mit einem dunkelblauen Logo, das Blau so lebhaft und frisch wie das Wasser, ein auf einer Spitze stehendes Viereck mit einem quergezogenen Schriftzug aus dicken weissen Grossbuchstaben. Die beiden A klingen ebenfalls frisch und versprechen reines Wasser – obwohl sie für Erdöl stehen. Sie simulieren Wasser und meinen Feuer. Und wenn man ARAL rückwärts liest, heisst es LARA… Aber das ist eine andere Geschichte. Hier also der Text, der ausdrücklich sagt, was er sieht, wo das Foto nur zu zeigen braucht. Ich habe ihn so belassen, wie er im Februar 2015 über die Radiowelle ging3:
Aral
Mitten in Sand und Salz und dürrem Gestrüpp steht ein Fischerkahn, von Rost zerfressen. Er steht so schief, dass er nur um ein Haar nicht kippt. An seine Seite lehnt eine Treppe. Wohl die Treppe derjenigen, die den Kahn ausgeweidet und alles Brauchbare mitgenommen haben.
Aber dieser Kahn hat nicht Schiffbruch erlitten, ist nicht auf Grund gelaufen oder gestrandet wie andere. Dieses Schiff ist nie zugrunde gegangen, zugrunde gegangen ist etwas anderes, nämlich das Element, das ein Schiff zu einem Schiff macht: das Wasser. Das Wasser eines riesigen Sees voller Fische.
Unerbittlich brennt die Sonne auf die Landschaft. Der Kahn wirft seinen Schatten in den verlassenen Sand. Wie wenn der Kahn dem Sand sein Kainsmal einbrennen würde.
In dieser verwüsteten Landschaft scheint das Schiff absurd. Aber man sieht ja nur einen Arm des erstickten und ausgetrockneten Sees. Der einst riesige See schwindet und versiegt zusehends. Das Wasser, das ihn einmal speiste, haben sie abgeschöpft, um Baumwollplantagen zu wässern. Nach einem Plan aus Zeiten Stalins.
Wo Leben sprudelte, ist nun Wüste. Wo Fische schwammen und sich Schiffe kreuzten, schaukeln nun Kamele ihres Weges.
Es scheint zu spät zu sein, den Aralsee in Kasachstan zu retten. Zu viele haben das Wasser auf ihre Mühlräder geführt, lange bevor es dorthin gelangen und in den See münden konnte.
Satellitenbilder zeigen den Aralsee als müdes grünes Auge, das sich nach und nach schliesst.
Der verlassene Fischerkahn ist Zeugnis menschlicher Unvernunft und Unersättlichkeit: ein vergeblicher Kahn, gestrandet im Nichts.
Dieser Text fokussiert auf den ökologischen Aspekt, auf die empörende Zerstörung eines Ökosystems durch den Menschen. Aral steht für die Anmassung, Gier und Ignoranz des Menschen, der eine Landschaft des Lebens in eine apokalyptische oder mindestens dystopische Landschaft verwandelt. Letztere kann als Symptom gelten für den Klimawandel, der die einen umtreibt und vor welchem andere lieber die Augen verschliessen. Ausserdem bringt der Text eine jener existentiellen Ängste an die Oberfläche, nämlich die Angst, schutzlos unter brütender Sonne verdursten zu müssen. In unseren Breitengraden ist die Sonne Garant für das Leben, in der Wüste bedroht sie das Leben, peitscht erbarmungslos auf die entblösste Erde. Die Wüste auf dem Foto ist aber nicht natürlich entstanden, sie wurde vom Menschen geschaffen. Es ist der Mensch, der dieses Stück Erde auf den Kopf gestellt hat: Der Kahn, eine eigentliche Antiarche, ist verlassen, sich selber überlassen. Der See hat sich in Dampf aufgelöst. Die Natur hat sich mit der neuen Situation arrangiert. Jetzt navigieren metaphorische, behaarte Wüstenschiffe durch einen Sandsee. Die Kamele, wie geschaffen für eine solche Umgebung, geben mit dem wenigen Gestrüpp der ganzen Szenerie eine leicht optimistische Note. Offenbar ist die Natur flexibel und passt sich immer von neuem an. Der Mensch zählt nichts in dieser verwandelten, ihm nun unwirtlichen Umwelt. Der Natur ist der Mensch mit seinem Handeln und Misshandeln einerlei. Man vergisst nur zu gerne, dass die Natur die Welt minus Mensch ist und deshalb sehr gut auch ohne ihn auskommen würde.
Mein Prosatext «Aral» hat in mir den Wunsch geweckt, zu reduzieren, alles Überflüssige, Zufällige und Volatile verdampfen zu lassen und daraus eine Essenz zu destillieren. Das Foto ist als Kunstwerk ein gutes Beispiel für effizient eingesetzte künstlerische Mittel, es ist direkt, klar, eindeutig. Der abgewogene Einsatz der Mittel erhöht die Überzeugungskraft. Es brennt sich ein in unser Bewusstsein. Diese Prinzipien möchte ich auf ein Gedicht übertragen und anzuwenden versuchen. Dafür enthält der letzte Satz des Prosatexts «Aral» bereits den Kern. Der erste Satzteil fasst das Gesagte zusammen: «Der verlassene Fischerkahn ist Zeugnis menschlicher Unersättlichkeit und Unvernunft.» Der zweite Satzteil beschreibt mit dichterischen Mitteln das zentrale Motiv: «Ein vergeblicher Kahn, gestrandet im Nichts.»
Es geht mir nicht darum, ein Gedicht zu schreiben, welches das Verhalten der Leserschaft gegenüber der Umwelt verändern möchte. Das wäre wohl ehrlich und gut gemeint. Aber gut gemeint ist nicht immer gut gehandelt. Ehrlich gesagt bin ich der Meinung, dass Gedichte keine passende Form sind für solche politischen Botschaften.
Mein Gedicht soll eher ein paar Schritte in die Abstraktion gehen, Blickwinkel und Sinneshorizont erweitern und einige wenige Elemente mit symbolischer Bedeutung aufladen. Den ökologischen Aspekt sowie die komplexen Fragen zu Ursachen und Wirkungen, zu Schuld und Verantwortung lasse ich beiseite. Diese Fragen mögen wie gesagt andernorts erörtert werden. Das Gedicht soll den Zustand und die Konstellation von Gegenständen auf einem kleinen Stück Erde beschreiben, so wie sie sind. Die benannten Dinge sollen nichts anderes tun, als zu bedeuten. Wenn man unbedingt eine Anklage finden möchte, kann man eine solche vielleicht in der Bezeichnung des Sees als «verwüstenden» (Vers 9) finden, eine Bezeichnung, die zwischen «einer, der versandet» und «einer, der zerstört» oszilliert. In der rätoromanischen Originalversion wird der See als «desertader» (Vers 10) bezeichnet. Die Bedeutung dieses Worts oszilliert zwischen Deserteur (einer, der flüchtet oder sich verflüchtigt) und Verwüster (einer, der zerstört). In beiden Fällen wird die Verantwortung vom Menschen an den See delegiert. Der See handelt und wird dadurch vermenschlicht.
Ich habe also versucht, das Prinzip des Fotos – zu zeigen, ohne zu sagen – auf mein Gedicht anzuwenden, und deshalb alles Anekdotische, Nebensächliche, Zufällige und daher Verzichtbare eliminiert. Dies gilt auch für Orts- und Zeitangaben.
Im Fokus des Gedichts steht also der Kahn in seiner Verlassenheit und Trostlosigkeit. Sonne, Wind, Salz und Sand ausgesetzt. Unnütz geworden, deplatziert und absurd. Die Daseinsberechtigung eines Gebrauchsgegenstands ist, dass er gebraucht wird. Es ist ja nicht so, dass der Kahn seine Funktionalität verloren hätte. Der Kahn ist geblieben, was er immer war. Verändert hat sich nur die Umgebung. Dieses Stück Welt ist zu einem Stück verkehrter Welt geworden. Die Wasseroberfläche wurde annulliert, der sandige Seegrund wurde zur Oberfläche. Diese Umkehrung der Welt kondensiert sich in der rätoromanischen Originalversion des Gedichts im Ausdruck «nav invana», wo das Adjektiv «(in)van(a)» (vergeblich, eitel) die Umkehrung des Substantivs «nav» (Kahn) ist.4
Das Stück Realität, welches das Foto eingefasst hat, könnte im wörtlichen Sinn als Stillleben oder mit dem italienischen Begriff als «natura morta» gelesen werden, als ein Stück Natur, das mehr tot ist als lebendig. Aber auch im technischen, kunsthistorischen Sinn als Stillleben, wie sie im Barock sehr verbreitet waren, in dieser Epoche mit ihrer Obsession für «die letzten Dinge», die Vergänglichkeit und «Eitelkeit» des menschlichen Lebens. Diese Darstellungen dienten als «memento mori», als Ermahnung an die Sterblichkeit: Man sollte stets den Tod vor Augen haben, um ein gutes Leben zu führen, welches den Weg für ein noch besseres Leben im Jenseits ebnen sollte. Diese Ermahnung wird von symbolischen Objekten transportiert, die nicht nur das sind, was sie sind, sondern auch das, was sie bedeuten: Schädel oder «Totenköpfe», Sanduhren, überreifes Obst und Blumen in letzter Blüte vor dem Verwelken, dazu Insekten und Würmer, die nur darauf warten, über sie herzufallen. Diese Objekte materialisieren das Konzept der menschlichen Vergänglichkeit. Diese allegorischen Gemälde werden mit dem lateinischen Begriff als «vanitas» bezeichnet. Die «Vanitäten» haben ihren Ursprung in der Bibel und beziehen sich auf die Anfangsworte des Buchs Ecclesiastes: «Vanitas vanitatum et omnia vanitas», oder auf Deutsch in den Worten der Zürcher Bibel von 1531:
Alle ding wie man sy ermisst und betrachtet / sind sy eytel / under allen dingen nichts aber schwechers und unstäters dass der mensch.5
Eine weitere Referenz ist beispielsweise der Psalm 103 in der rätoromanischen Übersetzung von Durich Chiampell von 1652, der in einer pessimistischen Vision die ganze Ungewissheit, Leere und Hinfälligkeit des menschlichen Lebens zum Ausdruck bringt, das er mit Heu vergleicht, das von einem kleinen Windstoss gebodigt und weggeblasen wird. Chiampell stellt voller Resignation fest:
Lg ais in quaist muond noass fatt ün gioech,
Tuot üna uanitade.6
(In dieser Welt ist alles Spiel / alles Eitelkeit.)
Mein Gedicht wählte als Titel das lateinische Wort vanitas. Der Gedanke der Vergänglichkeit, der Nutzlosigkeit, der Absurdität kristallisiert sich im Kahn, der deplatziert scheint, es aber nicht ist: de-platziert oder verschoben hat sich der See, Grundvoraussetzung, damit der Kahn Kahn sein kann. Ohne Wasser hat der Kahn keine Daseinsberechtigung, keine Bedeutung, keine Funktion. Der Kahn steht hier für Überflüssigkeit. Ohne Flüssigkeit ist das einstige Gefährt statisch geworden, ein Denkmal im ursprünglichen Wortsinn, ein Mahnmal. Es ist zur Allegorie geworden. Wenn wir an den Topos des «Lebensschiffs» denken, wissen wir, was ein unbeweglich gewordenes Schiff bedeutet.
Das Gedicht «vanitas» ist ein verbales Destillat, kurz vor dem Schweigen. Schweigen möchte nun auch ich. «Der Autor hat den Mund zu halten, wenn sein Werk den Mund auftut», sagte Nietzsche. Ich bin sofort bereit, diese Regel zu befolgen, umso mehr, als ich mir sehr bewusst bin, dass der Dichter keinesfalls ein guter Leser oder Interpret der eigenen Werke ist. Nun ist es höchste Zeit, das Gedicht zu Wort kommen zu lassen:
vanitas
nav
invana
inclinada
bütta
sia ultima
sumbriva
aint il sablun
giò’l fuond
dal lai
desertader
cruschan
uondagiond
chamels
vanitas
schiefer
eitler
Kahn
wirft
seinen letzten
Schatten
in den Sand
auf dem Grund
des verwüstenden
Sees
kreuzen
schaukelnd
Kamele
Wo ist der Mensch in dieser ganzen Geschichte? Der Mensch schaut zu und fragt sich, was er nur angerichtet hat.
Ausgezeichnetes Werk: «sablun», Chur, Chasa Editura Rumantscha, 2017.
«Sablun», Chasa Editura Rumantscha, Chur 2017 (S. 68). ↩
Tatsächlich findet man im Dicziunari Rumantsch Grischun DRG (Band 10, S. 82) für Tschlin die Aussprache [αral] für Vallader Iral «Dreschtenne, Holzgeleit etc.»! ↩
Der Text «Aral» entstand für die Sendung Impuls von Radio Rumantsch und wurde im Februar 2015 gesendet. ↩
Anmerkung des Übersetzers: Dieses Sprachspiel konnte in der deutschen Übersetzung nicht nachempfunden werden. Jedoch bringt das Adjektiv «eitel» im Deutschen einerseits die archaisierende Konnotation von «nav» in den Anfang des Gedichts zum Ausdruck und andererseits stellt es einen Bezug her zur Malerei des Barock, auf welche auch der Titel «vanitas» verweist. ↩
Ecclesiastes 1,1 gemäss der sogenannten Froschauer-Bibel von 1531, S. 848, Web: http://www.e-rara.ch/zuz/content/pageview/1930041 [03.03.2018] ↩
Durich Chiampell, «Un cudesch da psalms…», Basel 1562, Web: http://www.e-rara.ch/bau_1/content/titleinfo/1636852 [25.1.2018] ↩