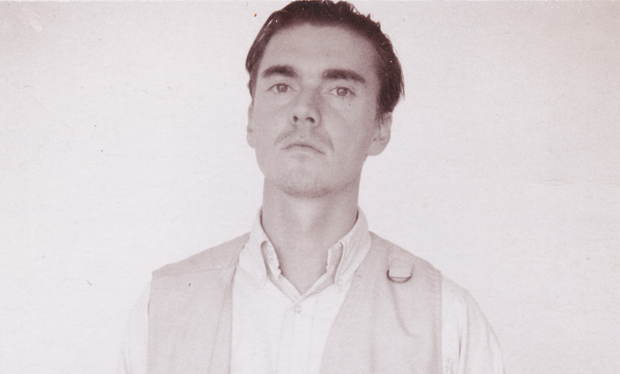Grand Hotel
«Hier ist die Réception, guten Abend, Mr. Harrison, how can I help you?» Die Stimme antwortet mir in breitgekautem Amerikanerenglisch. Ich habe den Namen vom Display des Telefons abgelesen: Es ist eine Regel des Hauses, dass man den Gast immer beim Namen nennen muss. Damit er versteht, dass wir wissen, wer er ist. Der Gast […]
«Hier ist die Réception, guten Abend, Mr. Harrison, how can I help you?»
Die Stimme antwortet mir in breitgekautem Amerikanerenglisch. Ich habe den Namen vom Display des Telefons abgelesen: Es ist eine Regel des Hauses, dass man den Gast immer beim Namen nennen muss. Damit er versteht, dass wir wissen, wer er ist. Der Gast muss immer die Gewissheit haben, mehr als nur eine Zahl auf einem Schlüssel oder einer Tür zu sein. Eine Frage des Stils, und im Grand Hotel geht nichts über den Stil.
Der Akzent – und das, was er sagt – verrät mir seine Herkunft: New York, vornehme Gegend, 5th Avenue oder etwas in dieser Art, wo die Gutbetuchten leben, gestresste Leute, gewohnt, alles zu bekommen und sofort, sie haben mindestens ein Lifting hinter sich, besitzen einen Mops oder einen anderen tragbaren Kläffer, Tiere, die nur Reiche lieben können. Ich antworte auf Englisch und kaue dabei die Wörter breit, genau so, wie ich es den Schauspielern in den Leihfilmen abgeschaut habe.
«Das ‹Cangelli› ist perfekt, wenn Sie typische Küche wünschen, aber wenn Sie gestatten, würde ich Ihnen eher das ‹Quattro Colonne› empfehlen. Die Küche ist moderner, könnte man sagen. Stilvolles Ambiente. Ja. Sehr angenehme Gäste, Mr. Harrison, wie Sie übrigens auch.»
Er lacht. Das ist ein gutes Zeichen. Sie lieben es, wenn sie erkannt werden.
«Selbstverständlich. Um acht für zwei. Einen sehr guten Tisch.»
Man muss immer von einem sehr guten Tisch sprechen, auch wenn er dann erbärmlich in einer dunklen Ecke steht.
«Wenn Sie gestatten, reserviere ich Ihnen einen Tisch mit Blick auf die Küche. Das ist eine exklusive Position.»
Sie lieben das Exklusive. Selbst wenn es sich dabei um trostloses Mittelmass handelt. Sie müssen nur fest daran glauben, brauchen nur eine Vergleichsgrösse.
«Am ehesten wohl mit ‹Le Cinque› vergleichbar, Mr. Harrison, in ‹Mayfair›.»
Im Vergleich erkennen sie sich wieder, sie fühlen sich sicher, er ist die Bestätigung dafür, dass ich erkannt habe, mit welcher Sorte Gast ich es zu tun habe.
«Ich weiss, dass Sie es kennen, Mr. Harrison, deswegen erlaube ich mir, Ihnen ein Restaurant zu empfehlen, das Ihnen gefallen wird. Ausgezeichnet, um acht für zwei. Das Taxi erwartet Sie um zehn vor acht.»
Immer auch an das Taxi denken! Das beweist erstklassige Organisation und Sorgfalt. Das ermöglicht dem Gast, sich um nichts zu kümmern, sich keine Sorgen zu machen. Und es erhöht das Trinkgeld.
Ich vermerke im Hotelbuch Zimmer, Restaurant, Personenzahl und Uhrzeit. Man weiss nie. Oft verlieren die Gäste alles, was man ihnen anvertraut. Dann rufe ich im «Quattro Colonne» an. «Enzo? Hallo, ich bin’s. Hör zu, einen Zweiertisch, heute abend um acht. Ja, einen guten, wenn möglich mit Blick auf die Küche. Ja, ich weiss, aber versuch es halt. Ein dicker Fisch. Harrison. Mit H, wie der von den Beatles. Genau. Und tu mir einen Gefallen: Führ sie erst mal in den Keller. Erzähl ihnen was Schönes und zeig ihnen die Barolo-Kollektion, einen wirst du sicher los. Sag ihnen auch, dass es dir eine Ehre sein werde, sie nach dem Essen nach unten auf ein Glas Chinato einzuladen. Ja. Einfältiger Typ, Amerikaner. Ja, eben, ein fetter Fisch, du wirst sehen, das gibt Trinkgeld.»
Das werde auch ich sehen. Deswegen muss das Restaurant ein Erlebnis sein. Sie wollen immer ein Erlebnis, sie erwarten eines. Etwas Einzigartiges, das in Erinnerung bleibt und später erzählt werden kann. Wir konstruieren die Wirklichkeit nach ihren Vorstellungen. Eine perfekte Wirklichkeit.
Mit den Amerikanern ist es am einfachsten: Sie sind leichtgläubig, geben unglaubliche Trinkgelder und bewahren noch ein Italienbild aus den Zeiten der Bella Vita, Sechzigerjahre, Lambretta, jeden Abend ein Fest. Wenn man ihnen das Richtige anbietet, läuft alles rund. Wichtig ist, dass man sie nicht unterbricht, sonst verlieren sie den Faden und geraten aus dem Konzept. Daraus entsteht Misstrauen, und aus dem Misstrauen Ablehnung gegen alles, egal was. Es reicht, sie ausreden zu lassen – et voilà, mehr braucht es nicht. Danach kann man auch das exakte Gegenteil dessen anbieten, worum sie eben gebeten haben, das Spiel ist gewonnen. Das richtige Lokal zu empfehlen ist eine Frage des Könnens: Für alle, die von irgendwoher kommen ausser aus New York, ist jedes Lokal okay. Man muss es einfach mit einer Beschreibung würzen, die irgendeinen Hinweis auf das Ambiente mit irgendeinem Gericht kombiniert. Es macht nichts, wenn es dieses Gericht auf der Speisekarte nicht gibt und auch nie gegeben hat. Die Zauberformel «eine Saisonempfehlung des Chefkochs» reicht. Fehlt das Gericht auf der Speisekarte, ist in Gottes Namen gerade nicht Saison. Während ich ein Restaurant empfehle, muss der Gast sehen, wie er selbst in einem bestimmten Licht an einem bestimmten Tisch sitzt, einen bestimmten Wein trinkt und das Saisongericht isst, das er über meinen Gaumen schon im Hotel vorkostet.
Mit den Gästen aus New York verhält es sich etwas anders. Es gilt etwas Exklusives zu finden, etwas, das vielleicht irgendwie mit dem Namen eines grossen Modeschöpfers zusammenhängt, der aus einer Laune heraus auch mal ein Restaurant eröffnet hat. Kein Problem, wenn die Küche nur beinahe akzeptabel ist. Es muss ein trendiges Lokal sein, das Lokal der Stunde, das Zentrum der Movida, des Universums, eines, über das In-Zeitschriften berichten. Kurz, ein Restaurant Typ Schaufenster, ein Aquarium für die Leute, die etwas zählen. Der passende Ort ist der, von dem man den Daheim-gebliebenen erzählen kann, zwischen dem Neid derjenigen, die noch nicht dort waren, und den Lobreden derjenigen, die es bereits getestet haben.
Ein Segen sind übrigens die Japaner: Die gehen überallhin, wenn es nur karierte Tischdecken und Pasta gibt und nach einer schönen Trattoria aussieht. Staubige italienische Provinzdekadenz, wenn möglich gepaart mit einem beschürzten Wirt im Esssaal und der Ehefrau respektive Mamma in der Küche. Das ist für sie Italien. Eine Korbflasche Wein (den sie nicht vertragen, weswegen sie schon beim zweiten Glas betrunken sind), einen Topf Spaghetti und dann ab in die Oper, um sich mit Tickets zum zehnfachen Preis Verdi anzuhören.
Kompliziert hingegen die Europäer: Es kommt auf das Land an. Meist genügt ein Blick auf ihre Kleidung: Stil Gammler in Edelmarken? In diesem Fall muss man sondieren, ob ein Aquarium-Lokal gewünscht wird: höchste Konzentration an Gin Lemon bei niedrigster an Orangenhaut. Für Unkomplizierte hingegen ist, geschickt gewürzt mit Beschreibungen aus dem Stegreif, jedes Lokal perfekt. Wobei man idealerweise denjenigen den Vorzug gibt, die dem Réceptionisten Ende Monat einen grossen Prozentsatz gewähren, so und so viel für jedes reservierte Gedeck.
Bei allen, die von der Geliebten begleitet werden, fällt meine Wahl auf eines der Restaurants, die ich als Industriellenkantinen ansehe: grau-anonyme, aber klassische Küche, ein Sternen-Ambiente mit Kellnern, die seit 1960 ihren Dienst tun, eine Rechnung mit vielen Nullen und selbst auf dem Dessert noch Rucola.
Die Russen wollen gewöhnlich Seafood, Fisch. Das ist für sie Luxus. Réceptionisten sind immer mit entsprechend geschulten Restaurantbesitzern befreundet, die dem Gast herrliche Langusten-Pyramiden und Sturzbäche rohen Fischs anbieten. Das ganze womöglich begossen mit Fusel, der unerklärlicherweise in unterschiedlichen Flaschen mit höchst noblen Etiketten wohnt. Aber erst ab der zweiten Flasche: Die erste muss immer von guter Qualität sein. Danach ist der Geschmackssinn betäubt, wird auch die Maus zum Braten. Man kann ihnen sogar Fünfliterflaschen-Frascati servieren: Adäquat abgefüllt, ist immer alles von bester Qualität. Einer Qualität, die auf der Rechnung selbstverständlich voll berechnet wird.
Kompliziert ist es auch mit den Arabern und Spaniern: Sie pflegen spät oder sehr spät zu essen, und es kann schwierig werden, zu fortgeschrittener Stunde ein noch geöffnetes Restaurant der gehobenen Klasse zu finden. Aber für einen Réceptionisten gibt es ja immer und zu jedem Preis eine Lösung.
Bei den Schweizern stellt sich dieses Problem nicht: Sie essen früh. Wenn sie aus Zürich sind, sind sie wie die Amerikaner aus New York, nerven bloss mehr. Ein Zürcher ist praktisch die einfache Version eines New Yorkers. Warum in Zürich alle entweder Architekten oder Designer sind, war mir schon immer ein Rätsel, aber sie wollen jedenfalls immer ein trendiges Lokal. Der durchschnittliche Durchschnittsschweizer ist dagegen schlicht knausrig und will Qualität zu günstigen Preisen. Eine Bauarbeiterportion mit italienischem Touch, damit es lecker aussieht. Etwas findet sich immer für sie.
Die Italiener übrigens sind ja eine ganz schwierige Kundschaft: Misstrauisch! Wenn man ihnen den perfekten Ort auf den Leib schneidern will, muss man feinfühlige und mit maximaler Präzision ausgeführte Erkundigungen anstellen. Sorgfältige Fragen, aber nicht zu viel Arschkriecherei, sonst fliegt der Betrug auf. Die besten waren schon immer die Zahlungskräftigen: Warten am Empfang viele Leute, muss man leicht die Stimme heben, während man betont, dass ihre Wahl exzellent sei. Das ist im Normalfall gutes Trinkgeld wert, und je mehr Personen dabei sind und es sehen und hören, umso höher fällt es aus.
Bei allen Gästen gilt es in diesem euphorischen Zustand zu bleiben, wenn sie zurückkehren: Man muss stets den Eingang im Blick behalten und zu ihrem Empfang hinter der Theke hervorstürzen, als ob man auf niemand anderen als sie gewartet hätte. Dann fragen, wie es war und ob sie gut gegessen hätten, und überschwenglich ihre Menüwahl loben (sie erzählen immer, was sie gegessen haben). Loben, immer loben, wie gut sie gewählt haben, und dabei die bestmögliche Mimik aus den Gesichtsfalten zaubern: Überraschung, Genugtuung, Komplizentum. Durch Nicken unterstreichen, was für ein Kenner der Gast ist. Gewöhnlich ist das Ego des Gastes nach dem ganzen Kabarett so aufgebläht, dass es sich Luft machen muss, insbesondere wenn es mit Wein begossen wurde: Damit wird es Zeit für das zweite Trinkgeld. An der Farbe der Karte erkenne ich, ob ich mit den Komplimenten weitermachen soll oder ob ich mich besser kurz halte, eine gute Nacht wünsche und auf die nächsten warte. Die vielleicht grosszügiger sind.
Es ist neunzehn Uhr vierzig, Herr und Frau Harrison treten an den Empfang. Das Taxi wartet bereits. Ich komme hinter der Theke hervor und geleite sie hinaus. Mr. Harrison ist angezogen wie ein Orchestermusiker: schwarzes koreanisches Hemd, schwarzes Sakko mit schwarzem Paillettenkragen, schwarze Hose, spiegelblanke schwarze Schuhe und ein infolge eines Liftings straff gespanntes Gesicht.
Vor allem lächelt er nicht. Wenn er es täte, würden sich seine Arme heben, so straff ist die Haut. Frau Harrison ist angezogen wie Moira Orfei in den besten Zeiten ihres Zirkus, aber stärker parfümiert. Deutlich stärker. Eine Königin von Saba für den Tanznachmittag. Sie trägt eine kleine Tasche am Arm, vornehmes Designerzeug, und aus dem offenen Reissverschluss lugt ein winziger Hund, ein gepuderter weisser Chihuahua. Wusste ich es doch. Gewisse Dinge wissen wir Réceptionisten einfach.
Mr. Harrison schiebt die Hand in die Tasche und hält mir einen 50-Euro-Schein hin. «‹Quattro Colonne›, ein sehr guter Tisch», versichere ich Mr. Harrison und schenke ihm das schönste Lächeln, das ein Réceptionist aufzusetzen vermag. «Um acht. Für zwei.» Auch wenn dieser Tisch uns alle drei nähren wird.