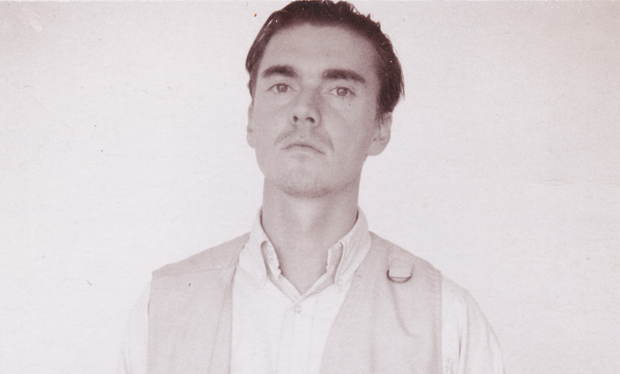Unter der kugel-unsicheren Weste
Eine gehörige Portion Wagemut, zwei gut funktionierende Augen, etwas sprachliches Handwerk – und fertig ist die Kriegsreportage? Mitnichten. Sie mag sich mit dem sezierenden Blick der Kriminalbeamtin schützen und sich ins Beobachten von Details flüchten: den Fragen um den Sinn ihres Tuns entkommt die Reporterin nimmer.

Ich bin zum ersten Mal Kriegsreporterin, und vor mir liegt meine erste Kriegsleiche. Als ich das schwarze Loch erblicke, das sich anstelle des Gesichtes im Schlamm öffnet, wende ich den Blick ab, bedecke das Gesicht mit den Händen, trete zurück, stimme in das Geheul der Bäuerinnen ein, mit denen ich den Fund gemacht habe. lch folge einem Instinkt. Mein zweiter, ebenfalls bloss sekundenlanger Blick ins Loch ist ein anderer, er ist schon bewusst, ein Willensakt, ich besinne mich auf meine Rolle und zwinge mich, die von den Ratten ausgefressene Leere mit den Augen abzutasten, um später davon Zeugnis abzulegen. Ich habe damit auch eine Kriegsmetapher gefunden. Zunächst mal ist aber das Loch eine neue, erschreckende Wahrnehmung, und ich vertraue sie dem Gedächtnis an. Ich gehe im März 1996 durch die Ruinen des tschetschenischen Dorfes Sernowodsk wie eine Somnambule im Zustand der luziden Konzentration. Ungeheure Verschiebungen der gewohnten Konstellationen der Dinge stürzen auf mich ein, drohen meine Sinne zu sprengen. Die einheimischen Frauen haben mir ein Kopftuch umgebunden, mir dadurch die Rolle der Spionin zuerkannt, zu der ich mich selbst gemeldet hatte. Eine Denunziantin des Unrechts soll ich werden.
Ich lasse mein bisheriges Leben bei den russischen Panzern vor der Dorfabsperrung zurück und sorge mich darum, ob das Gedächtnis, mein einziger Mitarbeiter und Werkzeug, nicht vor Überforderung kollabiert. Behutsam behandle ich dieses Organ, lege die Eindrücke säuberlich getrennt voneinander in eine Art Archiv, dessen Kapazität ich noch nicht kenne. Es ist eine neue Arbeitsweise ohne Tonband, ohne Notizen, in Eile während ein paar Stunden im Durcheinander des Dorfes, das eine Woche lang bombardiert worden ist. Ich greife zufällige Bildausschnitte auf, starre auf etwas, bleibe mal stehen, dann friere ich das Bild mit Worten ein, sage die Sequenz ein paar Mal für mich. Es sind ungewohnte und doch identifizierbare Bilder, die sich meine Wahrnehmung aussucht. Erfolgt die Selektion nach einem Prinzip?
Meine Sprache in diesem Dorf ist das Russische, mit ihrer Hilfe schneide ich die Flashes heraus und archiviere sie. Seit Tagen spreche ich nur Russisch, meine slowakische Muttersprache wie auch meine deutsche Schreibsprache haben sich von mir entfernt, tauchen nur selten und blass als einzelne Worte auf. Da breitet sich vor mir der Hauptdarsteller des zerstörten Dorfes aus, der allgegenwärtige Schutt, aber dies ist auch nicht annähernd das passende Wort dafür, was wir in den Höfen, Häusern, Ställen, auf Strassen vorfinden. Ich murmle auf Russisch: oskolki, oblomki, Splitter, Bruchstücke, rufe das Slowakische herbei: črepiny, prach, Scherben, Staub, füge das deutsche Wort Trümmer hinzu. Dieses Gemisch aus Materialien, diese verletzten, geschändeten Formen haben keine Namen. Es sind Dinge im Ausnahmezustand, für die kein Vokabular entwickelt worden ist. Auch für ihre Besitzer sind sie bloss Ableitungen der alten nützlichen Gegenstände. Für sie gibt es in den verschiedenen Sprachen nur Sammelbegriffe, obwohl diese Teile, Stückchen, Fetzen durch die Wucht des Krieges individuell geschnitzt und in einen Zusammenhang zu anderen Teilen gebracht worden sind, die sie sonst nie erfahren hätten. Gerade durch das Sprengen ihrer ursprünglichen Formen und durch die neue Gestaltung bekommen die Teile für mich ein Eigenleben, ein invalides, ein zerrissenes. Ihr Schmerz berührt mich. Sie sind soeben verwandelt worden, haben keine Funktion mehr und werden als namenloser Schutt wieder weggefegt oder zurechtgebogen oder ersetzt durch Formen, die man auseinanderhalten und benennen kann.
Ich sehne mich nach einer Sprache, die all diese Dinge, die keine Dinge im herkömmlichen Sinne mehr sind, in ihrem neuen Stillleben im Krieg präzise beschreiben könnte. So ohne eine Sprache fallen sie wieder auseinander, die Wahrnehmung verweigert die Weitergabe ans Gedächtnis. Ich habe längst vergessen, wie ein Hof voll des nichtssagenden Wortes Schutt aussieht, nur einzelne fassbare Bilder habe ich daraus retten können: In der Hofmitte steht ein grosses, staubiges Einmachglas halbvoll mit brauner Marmelade, und im gelben Metalldeckel klafft ein Messerstich. Ich nehme dieses Bild als Kriegstrophäe mit. Ich kenne nur einen Ausweg, einen sprachlichen. Ich will diese Dinge nicht zusammenkleben, ihre Zerrissenheit nicht verbergen, nicht täuschen mit Ganzheit, so wie ich selbst nicht als unversehrt gelten will.
Im Schreiben über den Krieg in Tschetschenien begreife ich, woher meine Sehnsucht kommt, der Zerstörung eine gerechte, eine sprachliche Existenz zu verleihen, gleich mir, die sich im Schweizer Exil in der neuen Sprache aufgerichtet hat, in ihr die Würde der Verletzten fand. Meine deutsche Sprache ist die einer ehemaligen Stummen, sie ist keine Selbstverständlichkeit, in jedem Wort ist der Überlebenswille. Diese Sprache soll nicht geglättet, mein Schicksal darf aus ihr nicht ausgemerzt werden. Meine Auferstehung in der deutschen Sprache ist das einzige Haus, das ich aufgebaut habe, die Worte sind meine gestalteten Dinge. In dieser Tat füge ich Misstöne und Anmut zusammen, der poetische Akt ist meine Haltung zur Welt.
Geboren nach dem Krieg in der damaligen Tschechoslowakei, aufgewachsen in einer sozialistischen Gesellschaft, genährt von Helden- und Kriegsgeschichten, sah ich im Dezember 1994 im Fernsehen tschetschenische Frauen – ovale Gesichter, umrahmt von dicken wollenen Kopftüchern –, wie sie eine Menschenkette gegen die nach Grosny rollenden Panzer bildeten. Dort, im unbekannten Kaukasus, erblickte ich das Urbild einer zeitgenössischen Heldin. Ich schlug dem Chefredaktor des «Tages-Anzeiger»-Magazins eine Reportage über tschetschenische Frauen vor und brach mit einer kugelsicheren Weste im Gepäck auf. Die Redaktion hatte jedoch vergessen, die Weste mit dem Wichtigsten auszustatten – den Metallplättchen. Zwar hat mir der russische Journalistenverband die Plättchen ausgeliehen, doch es ist ein treffendes Bild dafür, wie ungeschützt ich mich in die Kriegslandschaft hineinwagte. Mein Traum wurde wahr: Ich wurde eine von den Frauen im zotteligen Kopftuch, ausgestattet mit derselben Verletzbarkeit. Diese Haltung wurde zum Eigenverständnis meiner Rolle, die mein politisches Denken und Fühlen umgekrempelt hat.
Gegen meine Erwartung liegt keine apokalyptische Stille über den gegenständlichen Resten. Das Dorf ist erfüllt von Tierlauten und Bewegung der streunenden Hunde, Katzen, Hühner, losgebundenen Rinder, Schafen, die scheinbar gleichgültig neben Kadavern ihrer Artgenossen weiden. Laute des Hungers, des Durstes, des Schmerzes der vollen Euter oder einfach Sprache. Die Dominanz der Tiere ist umso verblüffender, weil ich Tiere aus Zeitungskriegsberichten nicht kenne. Ich nehme mir vor, ihnen in meiner Reportage einen gebührenden Platz zu geben. Es scheint mir, als seien die Ruinen die Wildnis, die den domestizierten Tieren zurückgegeben wurde. Bei der Ankunft der Menschen eilen vor allem Jungtiere, Fohlen, Kälber auf uns zu. Die Bäuerinnen grüssen sie zärtlich, und in mir steigen trotz des Verwesungsgeruches biblische Assoziationen auf. Gleichzeitig bin ich mir bewusst, dass die Beschreibung einer paradiesischen Versöhnung zwischen Mensch und Tier in diesem Zusammenhang danebengeraten kann. Die Redaktorin streicht dann den Bibelvergleich. Es ist Vorfrühling. Beim Anblick des Nebeneinanders von Tod und neuem Leben wühlt mich mehr als die Kadaver der Überlebenswille auf, er ist wie angestachelt vom Tod. Ein unversehrtes Dorf wirkt sogar toter als dieses, wo alle Strukturen aufgelöst worden sind. Kühe irren herum, ein Pferd galoppiert ohne Geschirr mit wehender Mähne an ausgebrannten Häusern vorbei. Es erinnert mich an Isaak Babels «Reiterarmee». Darf ich überhaupt überwältigt sein? Gleich nach dem Dorfbesuch erzähle ich diesen Kontrast verwirrt einem mich befragenden Mitarbeiter einer humanitären Organisation, und er antwortet schroff und auf seine Weise richtig:
«Das Leben gibt es so oder so, aber nicht unbedingt das Morden.»
Beim Anblick der Häuser denke ich an das nur einige Kilometer von Sernowodsk entfernte inguschische Haus, wo wir untergebracht sind. Es sieht gleich aus, aber es ist unversehrt, geräumig, über dem hohen Holztor sind Schnitzereien. Die Bäuerinnen, die in ihre vergewaltigten Häuser zurückkehren, fragen sich:
«Was sind das für Mütter, die diese Söhne grossgezogen haben?»
Ich versuche nachzuvollziehen, wie der Erziehungsüberbau zusammenbricht. In mir geistert das russische Wort umunepostischimo, dem Verstand unerreichbar. Ich ahne, dass man die Antwort nicht im Kopf suchen darf, und stelle mir das Absacken vor, senke die Schultern, gehe breitbeinig. Es scheint mir, dass, wenn ich dort unten angekommen bin, es dort einen rauschartigen Zustand gibt.
Ein einmaliges Glück der Schreibenden fällt mir zu: Ich finde die Form und die Sprache, noch bevor ich das Dorf betrete. Ich gehe neben den Frauen auf der Hauptstrasse auf das rauchende Dorf zu. Die gleichmässigen, eilenden Schritte, dieses einzige Geräusch, unser Schweigen und die Einsamkeit der verminten Äcker offenbaren mir plötzlich die Form – wir gehen, wir gehen, wiederhole ich im Rhythmus der Schritte: Meine Reportage wird eine chronologische Beschreibung unseres Dorflaufes, ein Protokoll mit dem entsprechenden Stil in knappen, schmucklosen Sätzen sein. Diese Gewissheit zieht mich durchs Dorf. Was auch geschehen mag, ich weiss, was zu tun ist: die ganze Kraft aufs Sammeln von Details ausrichten. Später könnte ich den Bezug zwischen den einzelnen Szenen herstellen, oder er würde sich von selbst durch die konsequente Beobachtung ergeben. Dazwischen könnte ich kleine Überlegungen streuen und die Dramaturgie, die das Leben geschickt führt, klarer zu einem Bogen spannen.
Der unmittelbare Blick wechselt mit dem sezierenden ab, sie überlappen sich teilweise. Das wird meine Methode sein. Während ich mit den Bäuerinnen zusammen wehklage, nehme ich schon unseren tierisch anmutenden Gesang auseinander. Gleichzeitig ist mein Weinen aufrichtig und setzt sich fort. Werden die Schrecken und das Chaos durch eine denkende Distanz und eine Struktur bewältigbarer, oder ist dies bloss ein professioneller Reflex? Das Im-Geist-Stenografieren gibt mir zwar im Kriegsgeschehen einen psychischen Halt, später am Schreibtisch werde ich die Detailvernarrtheit hinterfragen: Ist es von Belang zu berichten, dass der Tote, den die Soldaten ausnahmsweise weder verbrannt noch verscharrt haben, nur noch einen Fetzen Stirn im Gesicht hat? Verletze ich nicht eh mit meinem phänomenologischen Eifer die Pietät vor dem Toten, von dem ich verfremdete Einzelheiten mitteilen werde, als wäre er lediglich ein Gegenstand, ein Kriminalfall? Ist dies gerechtfertigt als Stilmittel, um die Pietätlosigkeit des Krieges hervorzuheben, die pietätlosen Ratten, die das weiche Fleisch der Wangen bevorzugen, den erniedrigenden Umstand, dass die Leiche tagelang ungeschützt im Regen lag, eine Anklage an den Besatzer, der nicht nur die Zivilbevölkerung mordete, sondern auch die Toten schändete, indem er Bestattungen nicht zuliess? Wie ich es auch drehe, das schlechte Gewissen, das Unbehagen über welchen Stil auch immer werde ich nicht los.
Für die Reporterin ist ja der zufällige Leichenfund wie arrangiert, er wird zu einem der Kulminationspunkte der «Kriegsstory». Ich begegne der Leiche stellvertretend für die abertausenden getöteten Zivilisten. Ich muss sie beschreiben, und ich tue es mit all den merkwürdigen Einzelheiten, die mir das Gedächtnis anbietet, in der Hoffnung, dass der getötete Mensch unter Millionen Kriegsopfern symbolische Umrisse bekommt, vielleicht Wut, Solidarität auslöst. Ich gebe ihm seinen Namen, der ihm ein Bruchstück der geraubten Würde zurückgeben sollte. Und schon eile ich mit der genau gespeicherten Szene weiter, eine Kriminalbeamtin auf Spurensuche, die ihre Funde in ein steriles Säckchen einpackt.
Überall, wo ich hinkomme, fragen mich die Frauen aufgeregt:
«Wo ist denn deine Kamera?»
«Ich bin keine Fotografin, ich schreibe», antworte ich zu ihrer grossen Enttäuschung, als hätte ich ohne die Hand am Auslöser meine Mission verraten. Ich denke an meinen Fotografen, der nicht mitkommen durfte, und leihe mir seinen erbarmungslosen Blick, eine unauffällige, fleissige Sammlerin im Trümmerwald des Krieges. Ich schaue kaum unter die Füsse, sondern um mich herum, zu den löchrigen Dächern, in die von Druckwellen der Detonationen ausgeschlagenen Fenster, gehe taumelnd, schwerelos. Zuweilen zweifle ich daran, ob ich tatsächlich fähig sein werde, aus dieser unübersehbaren Fülle irgendwelche Eindrücke zu retten. Ich hebe einige leere Patronenhülsen und geschmolzene Metallstücke von gesprengten Bomben auf, trage sie vor mir in offener Hand, als klagte ich an, als zeigte ich Fetische, Souvenirs, Beweisstücke der Existenz dieses neuen Planeten, als klammerte ich mich an sie. Vor dem russischen Kontrollposten werfe ich sie wieder weg. Später fragen mich andere Journalisten, wie viel Prozent der Häuser vollständig zerstört seien. Um mir den Anschein der nüchternen Professionalität zu verleihen, antworte ich schnell, aufs Geratewohl:
«Dreissig Prozent.»
Mit Sicherheit weiss ich nur, dass es in Sernowodsk ein weisses, halbblindes Katzenjunges gab, das Blut von einem Kuhkadaver leckte. Sein Köpfchen war dabei geneigt, und ich sah seine rote Zunge.
Als ein Mann uns vor Minen warnt, die unter Brettern, Ziegelsteinbrocken oder unter frisch zugeschütteter Erde versteckt sein könnten, und uns rät, nur auf den intakten Lehmboden zu treten, ändert sich etwas. Bis jetzt war ich die Fassungslosigkeit, die Neugier, der Schreibprozess selbst, nun breitet sich in mir die Angst aus, wie ein fremder Duftstoff. Sie ist herrisch, duldet neben sich keine anderen Empfindungen, zieht mir den Brustkorb zusammen, steuert die Gedanken und mein Tun. Ich lasse die Bäuerin vorgehen und trete vorsichtig in ihre Fussstapfen, in Erwartung, dass sie in die Luft geht. Ich überlege noch, ob die zwei Meter Abstand mich vor einer Explosion ausreichend schützen würden. Aber schon begreife ich, was ich tue, und schäme mich. Ich hole sie ein und gehe von nun an neben den Frauen einher. Die Angst verflüchtigt sich, kehrt nicht mehr zurück.
Die Redaktorin streicht dann diese Stelle, die für das Dorf zwar bedeutungslos, aber für das Verständnis meiner Berichterstattung zentral ist. Mit diesen drei, vier beschleunigten Schritten, mit denen ich mich auf die gleiche Ebene mit der Bevölkerung stelle, übertrete ich die Grenzen meines Berufes oder dringe zu seinem Kern vor. Seitdem ist Sernowodsk auch mein Dorf. Wenn ich damals im März auf der aufgeweichten Erde auf eine Granate getreten wäre, hätte ich wohl als letztes etwas Absurdes gedacht: Wieso fliegt mein Bein durch die Luft, gegen die grelle Mittagssonne? Und wie werde ich seinen Flug beschreiben müssen, damit die Redaktorin in Zürich die Passage nicht als geschmacklos streicht? Mein Staunen ist grenzenlos, geradezu ein Existential, die Treue zu den Details eine Leidenschaft, die Gelassenheit habe ich wohl von den Bäuerinnen übernommen.
Es gibt Augenblicke auf diesem Trip, in denen ich meinen Auftrag vergesse. Inmitten einer Ruine sitzt eine dünne, junge Frau, apathisch, in einem Zustand nahe dem Wahnsinn. Ich umarme sie, sie zittert, und ich denke nicht daran, wie ich sie später beschreiben soll. Wäre ich doch länger bei ihr geblieben!
Der Krieg schenkt der Reporterin viel. Äusserlich gesehen genügt es, im richtigen Augenblick die Entschlossenheit zu haben, mit offenen Sinnen durch das Dorf zu gehen und in der schlaflosen Nacht die erste Fassung niederzuschreiben. Eine Nachrecherche ist kaum erforderlich, grosse Analysen, Übertreibung, sprachliche Akrobatik oder Ironie erübrigen sich. Der Krieg verlangt von mir Wagnis, genaues Hinschauen und schlichtes Handwerk.
Und doch war alles noch anders und hat auch eine lange Nachgeschichte. Am Tag meiner Abreise aus dem Nordkaukasus erblicke ich in der Ferne abermals einen Hubschrauber. Noch ist er ein winziger Punkt. Einige Sekunden später erkenne ich, dass es ein Vogel ist. Und ich erschrecke über meine neue Wahrnehmung.
Ich kehre nach Moskau zurück. Dort überfallen mich Brechreiz, Migräne und diffuse Schmerzen im ganzen Körper, als wandere unter meiner Haut eine metallene Kraft, die mich mit ein und demselben Muster von innen tätowiert. In Moskau bin ich weicher Teig, eine Backform mit scharfen Kanten drückt sich ins Fleisch, in die Gedanken. Meine russischen Freunde sagen:
«Du hast wohl in Tschetschenien etwas Verdorbenes gegessen.»
«Ja, die Form des Hubschraubers.»
Eine gekürzte Version des vorliegenden Texts ist 1996 unter dem Titel «Treue den Details» in der Zeitschrift «Klartext» erschienen.