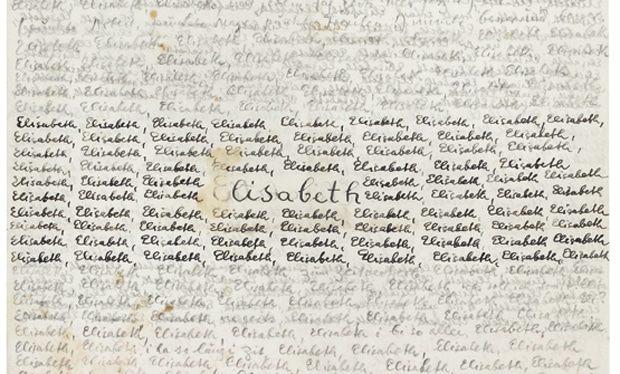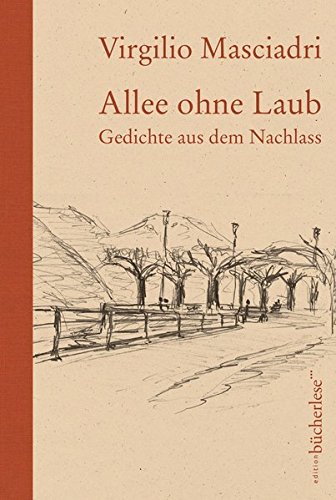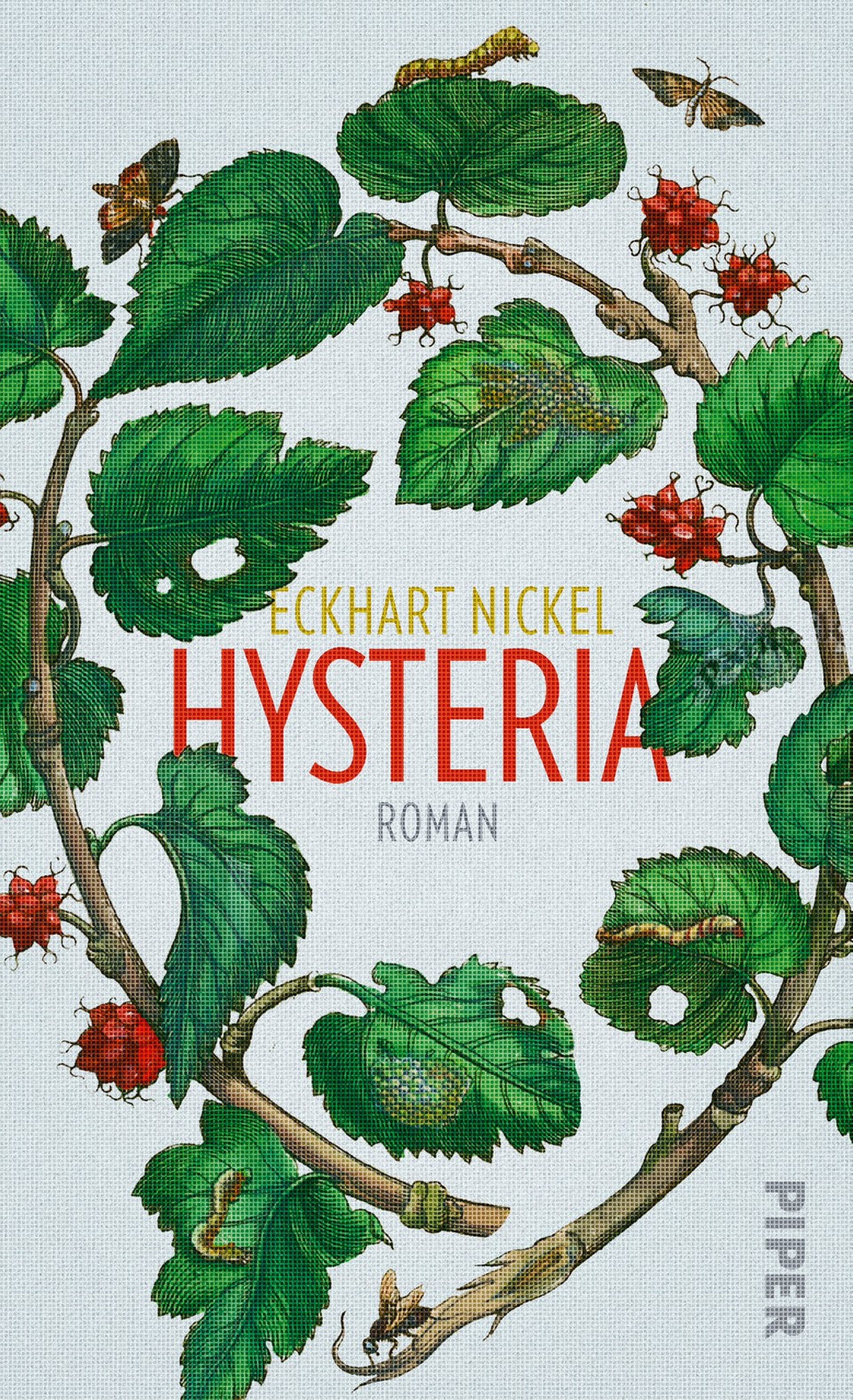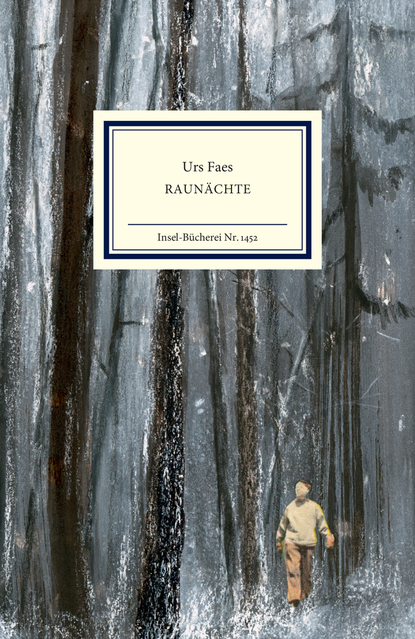Oversetting the Original
Fehler in Übersetzungen

Finstere Zeiten
Es war der Sommer der dankbaren Toten. Der Sommer der Liebe, des Friedens und der Glückseligkeit. Ich war weder verliebt noch sonderlich friedfertig oder glücklich. Am Vorabend hatte ich meine Wut und meinen Frust in einem Meer aus Bier und Likör ertränkt, und nun fühlte sich mein Schädel bedenklich verwundbar. Die ganze Nacht lang hatte brütende Hitze über der Stadt gehangen, und selbst der morgendliche Platzregen schien wenig Abkühlung zu bringen. Um mich auf Trab zu bringen, schwang ich mich auf das U-Boot in meinem stickigen kleinen Büro und versuchte, durch die Liste aller Ereignisse zurückzuzählen, als das Telefon klingelte.
«Höllenläuten», keuchte ich, schlurfte zum Schreibtisch und nahm den Hörer auf.
Obwohl sie eine Überdosis Cholesterol enthielt, biss ich herzhaft in die sterblichen Überreste der Peperoni-Pizza, die ich mir gestern abend hatte kommen lassen. «Wer ist da?», fragte ich schmatzend.
Aus dem Hörer drang eine so laute und dröhnende Stimme, dass ich sie bis ins Diaphragma spürte. «Hey, Dash, alter Sportsfreund, ich bin’s, Ray.» Ray und ich kannten uns schon aus dem Sandkasten. Er war ein vergammelter Hippie mit langen, fettigen Haaren und fusseligem Bart, kurz: ein gemässigt manierierter Perverser und dennoch seit fünf Jahren mein Seniorpartner.
«Was ist Sache?»
«Schwing dich in deine Rostbeule und komm sofort ins Tristar Hotel, LaBrea Ecke Hollywood, 3. Stock, Zimmer 327.»
«Wieso?», fragte ich mit der Bereitwilligkeit einer Kobra, die aufgefordert wird, das Kaninchen wieder hochzuhusten und sich bei ihm zu entschuldigen.
«Weil», gab er zurück und knallte den Hörer auf die Gabel.
Mürrisch und vergrämt liess ich die Pizza den Weg allen Gebäcks gehen und machte mich auf den meinen. Über dem Fluss lag dicker Mist. Der Sommer in LA war wie eine finnische Sauna: Man konnte in wenigen Minuten aus frierender bitterer Kälte in die schwülste Hitze gelangen. Irgendetwas war falsch mit dem Himmel: Der Regen kam in Wellen und wusch in mein Hören herein und wieder hinaus. In Schwingung zu sein, als Antwort auf Eindrücke, hiess, sich zu erfreuen. Die Zeit steht still in Momenten, die Joyce «Dreikönigsfeste» genannt hat, von Ezra Pfund ganz zu schweigen.
Ich parkte vor der heruntergekommenen Absteige und ging durchs Foyer zum Fahrstuhl. Zwei Zeitgenossen, die Mutti nicht mal zu meiner Bar-Mizwah eingeladen hätte, warfen mir mordlüsterne Blicke zu. Sagen taten sie nicht viel, aber sie deswegen festnehmen durfte ich die beiden noch lange nicht. Der Aufzug fuhr drei Stockwerke höher, als wie ich hätte müssen.
Als ich endlich vor der Tür von Nummer 327 stand, klopfte ich wie das Schicksal an die Pforten. Die Tür schwang langsam auf und gab den Blick frei auf meinen haarigen Compañero und eine Blondine mit Haaren bis zum Hintern und Beinen bis zum Arsch. In zufriedenem Schweigen sassen die beiden da und bliesen auf Becher heissen Weines, während ihre Kleider auf die Bohlen troffen.
«Hallo da», sagte ich.
Mein Partner bedachte mich mit einem Blick, der weniger Gefühle zeigte, als ein Dealer Steuern zahlt. «Darf ich dir Gerty Krueger vorstellen? Ihr Grossvater mütterlicherseits war dänischer Kaffeepflanzer.»
«Das kommt in den besten Familien vor.»
«Ihr Mann ist nach ’ner Sauftour verschwunden.»
«Ein Scheiss geschieht. Besondere Kennzeichen?»
«Er hat die Adresse von Gettysburg aufs Gemächt genadelt.»
Diese kleine Chandler-Persiflage ist keine echte fehlerhafte Übersetzung, sondern eine Montage aus den Lapsus mehr oder weniger verehrter Kollegen und Kolleginnen. Ich habe sie vor etlichen Jahren zusammen mit einem Kollegen gebastelt, und Sie können spasseshalber versuchen, wie bei den Oster- oder Weihnachtsrätseln mancher Zeitungen auf den Originalwortlaut zu kommen.
Ich möchte im Folgenden einige Typen häufig vorkommender Übersetzungsfehler vorstellen. Dabei geht es mir nicht um Fehler des Autors. Wenn eine Frau Kirschlimo trinkt und anderthalb Seiten später beim Kuss nach Orangenlimo schmeckt, dann korrigiere ich einen solchen Flüchtigkeitsfehler (der in meinem Fall in einem unlektorierten und im Original ungedruckten Manuskript stand) stillschweigend bzw. nach Rücksprache mit dem Autor, sofern der Text den unvermuteten Wechsel der Obstsorte nicht irgendwie plausibilisiert. Das Übersetzen wird hier zur Qualitätskontrolle und führt zur Verbesserung des Originals. Gravierender ist der folgende Fall: Die Autorin Hélène Grémillon lässt in ihrem Roman «Le Confident» (2010) einen Mann in den 1930er Jahren mit dem Fahrrad von Paris in ein Dorf fahren, das zweihundert Kilometer von Paris entfernt liegt. Er fährt um 16.00 Uhr los und kommt – im Oktober! – vor Sonnenuntergang an, was angesichts der Fahrradtechnik und der französischen Strassenverhältnisse vor neunzig Jahren schlicht undenkbar ist und was auch heutzutage wohl kein Teilnehmer der Tour de France schaffen würde. Die Übersetzerin kann an den Eckdaten nichts ändern (schon vor 16.00 Uhr hat sich an dem fraglichen Tag allerlei zugetragen, und der Fahrradfahrer ist im Dorf auch nach Sonnenuntergang noch aktiv). Sie muss den Fehler mit knirschenden Zähnen übernehmen und kann nur hoffen, dass kein(e) Leser(in) auf den Gedanken kommt, die Lage des Dorfs zu recherchieren.
Es geht mir auch nicht um Figurenfehler. Wenn literarische Figuren beispielsweise sogenannte Aposiopesen produzieren, d.h. einen zunächst geplanten Satz wie etwa «Jeden Tag bin ich zu dem Baum gegangen» beim Sprechen aufgeben und durch einen Neuansatz ersetzen («Jeden Tag bin ich dorthin gegangen») und diese beiden Satzentwürfe dann verschmelzen, dann reproduziere ich das im Deutschen, und so steht in der Übersetzung von David Foster Wallace’ Roman «Infinite Jest» jetzt: «Jeden Tag bin ich zu dorthin gegangen, um bei dem Baum zu sein.» Ähnlich verhält es sich bei Sätzen wie: «Also ich würde, definitiv würde ich da eine Verschwörung oder Falle vermuten.» In «Infinite Jest» erhält eine Figur über ihre Fehler sogar einen eigenen Charakter: Randy Lenz ist ein kokainsüchtiger Dealer, der den Intellektuellen markiert, sprachlich über seine Verhältnisse lebt und mit «furchtlos bildungswidrigen Aussprachemanieren»1 einen Schnitzer nach dem anderen produziert. Diese Schnitzer sind, wie Joachim Kalka das mal nannte, «Dialogabbreviatur[en] für einen ganzen Sozialcharakter»2 – den kleinbürgerlichen Aufsteiger eben, der auch sprachlich hoch hinaus will und unweigerlich auf die Schnauze fällt. Da Wallace solche Fehler oft sehr unauffällig einschmuggelt und ich dann statt «akzentuiert» «aktenzuiert» und statt «anonym» «amonym» geschrieben habe, kann Verwirrung entstehen, denn der Rezensent kann den Untergang des Abendlandes ausrufen, weil der Beruf des Lektors aussterbe.
U-Boote im Büro: Unkenntnis von Kulturtatsachen
Aber darum geht es hier, wie gesagt, nicht, sondern um Fehler, die tatsächlich und ausschliesslich aufs Konto des Übersetzers gehen. Welche Strukturelemente solcher Fehler gibt es? Wie kommt es zu solchen Fehlern? Kann man sie vermeiden, ihnen vorbeugen?
Eine erste Kategorie von Übersetzungsfehlern kann man schlicht Unkenntnis nennen – von Kulturtatsachen einerseits, von Sprachtatsachen andererseits. Wenn ich nicht weiss, dass «Nautilus» der Markenname von Fitnessgeräten ist, dann kann ich in einem Akt der Überinterpretation Jules Vernes Roman «Achtzigtausend Meilen unter dem Meer» assoziieren und statt des Fitnessgeräts ein U-Boot in ein Büro stellen. Statt in einem guten Wörterbuch nachzuschlagen, beweisen manche Übersetzer grosse Phantasie, um die eigenen Wissenslücken zu überbrücken. Der Romancier Louis Begley etwa entdeckte mal in der Übersetzung eines seiner Romane, dass seine Figuren in New York vor einem Hotel darauf warteten, dass ihnen jemand eine Limonade mit viel Wasser bringen möge. Merkwürdig, dachte er und sah in seinem Original nach. Und siehe da, die armen Kerle warteten auf ihre Limousine, eine stretch limo. Julia Roberts bekommt in den Schweizer Untertiteln des Films «Notting Hill» (1999) von einem eifrigen Koch einen «Versuchsvogel» vorgesetzt, und da hat der Untertitler schon richtig schön um die Ecke gedacht, denn ein guinea pig ist bekanntlich ein «Versuchskaninchen», und der Untertitler wird sich gedacht haben: okay, dann ist ein guinea fowl wohl dessen gefiederte Variante und nicht etwa ein «Perlhuhn» wie für uns humor- und phantasielose Zeitgenossen.
In Analogie zu diesem Phänomen der Überinterpretation könnte man von Unterinterpretation sprechen, wenn eine Übersetzung das Original aufs Genaueste reproduziert. Eins-zu-eins-Übersetzungen à la «Da sind Sie aber auf dem Holzweg» – There are you but on the woodway sind ein beliebtes Gesellschaftsspiel, und im Internet finden sich umfangreiche Materialsammlungen. Sie kommen leider aber als sogenannte false friends oder faux amis auch im richtigen Leben vor, wenn etwa – ein Evergreen der Übersetzungsfehlerei – pathetic als «pathetisch» und nicht als «jämmerlich» übersetzt wird oder wenn Arno Schmidt Carl Friedrich Meurer zitiert, der in seiner Übersetzung von James Fenimore Coopers Roman «The Monikins» (1835) aus dem Union Jack eine «Unions-Jacke» machte. Zu Meurers Verteidigung kann man anführen, dass man im deutschen Sprachraum des frühen 19. Jahrhunderts nur spärliche Kenntnisse der nordamerikanischen Kultur hatte. Dieses Argument zieht aber nicht bei Übersetzungen, die erst wenige Jahre alt sind. Als ich vor einiger Zeit die Urfassung von Jack Kerouacs «On the Road» von 1951 übersetzt habe, habe ich mir auch die beiden deutschen Übersetzungen des 1957 erschienenen Romans angesehen. Die Protagonisten Jack Kerouac und Neal Cassady treiben sich bekanntlich viel in Jazzclubs herum, und der Roman ist gespickt mit Anspielungen auf zeitgenössische Jazzstücke und -musiker. Hans Hermann ist in seiner Übersetzung von 1959 erfreulich sattelfest, der war offenbar ebenfalls Jazzfan. Anders Thomas Lindquist, der «On the Road» 1998 neu übersetzt hat und mit Jazz anscheinend nichts anfangen konnte – übrigens auch ein schönes Argument gegen die These, Neuübersetzungen seien grundsätzlich besser als Erstübersetzungen, da sie aus deren Fehlern ja gelernt hätten. Man sollte meinen, dass gerade die landeskundlichen Defizite, unter denen deutsche Literaturübersetzer in den Fünfzigern zu leiden hatten, im Jahr 1998 aufgeholt waren. Leider Fehlanzeige, denn bei Lindquist steckt «der Bop irgendwo zwischen seiner ornithologischen Charlie-Parker-Phase und einer anderen Phase […], die mit Miles Davis begann». Bop was somewhere between its Charlie Parker Ornithology period and another period that began with Miles Davis. Der 1946 entstandene Jazzstandard «Ornithology» wurde allein von Parker zwischen 1946 und 1954 mindestens vierzehnmal aufgenommen.
«Satzhack» & Co.: Unkenntnis von Sprachtatsachen
Nun zu den Fehlern, die auf die Unkenntnis von Sprachtatsachen zurückgehen, banaler gesagt fremdsprachliche Inkompetenz. Idiomatische Redewendungen werden nicht als solche erkannt und daher wörtlich übersetzt: «Wir haben grössere Fische zu braten» für das englische «We have bigger fish to fry», wofür wir im Deutschen die Wendung haben: «Wir haben Besseres/Wichtigeres zu tun.»
Im Einzelfall sind solche Fehler vielleicht damit zu entschuldigen, der Übersetzer habe den bildlichen Gehalt der fremdsprachlichen Redewendung ins Deutsche retten wollen. Diese Ausrede gilt aber nicht, wenn der Übersetzer den deutschen Satzbau nicht beherrscht und das produziert, was Dieter E. Zimmer mal «Satzhack»3 nannte: «Eine Frau aus meinem Haus, die ich kenne, hat mir erzählt.» Ich muss nicht ins Original schauen, um zu wissen, dass ich es hier mit dem Gegenteil von elegantem Deutsch zu tun habe, und empfehle doch sehr: «Eine Bekannte bei mir aus dem Haus hat erzählt.»
In die Kategorie syntaktischer Übersetzungsfehler gehört auch das Problem, dass sich viele Übersetzer an die Satzgrenzen des Originals klammern, die man gelegentlich verschieben kann und sollte. Als Tobias Kniebe 2005 für die «Süddeutsche Zeitung» ein Interview mit Clint Eastwood führte, hiess es nachher im Text: «Wissen Sie, was ich denke? Der Ruf, die heisseste Kanone der Stadt zu sein, hat sein Leben ruiniert.» Hier schimmert überdeutlich die Satzstruktur des Originals durch: You know what I think? His image of being the hottest gun in town ruined his life. In der deutschen Umgangssprache würde die Frageformel hier einen eigenen Satz bilden: «Wissen Sie was? Ich glaube, der Ruf, die heisseste Kanone der Stadt zu sein, hat sein Leben ruiniert.»
Eine Frage ist nun, ob und wenn ja wie ich solche Fehler vermeiden kann. Ein möglicher Ratschlag stammt ebenfalls von Dieter E. Zimmer, der gegen Satzhack empfahl: «Lieber eine entschlossene Zäsur […] als ein unentwirrbares Sprachknäuel, das ja auch im Original nicht vorhanden ist.»4 Anders gesagt, man muss sich von der Syntax der Originalsprache lösen und überlegen, welche Möglichkeiten des Satzbaus in der eigenen Muttersprache bestehen. Eine zweite Prophylaxe besteht in der alten Aufforderung aller Deutschlehrer: Lesen, Lesen, Lesen! Jede Übersetzung ist ein Alibi für neue Lektüren. Mit Grundkenntnissen über die deutsche Literatur der letzten zweihundert Jahre erwirbt man auch die Fähigkeit, halbwegs anständige deutsche Sätze zu bauen.
Zum Schluss möchte ich noch eine Fehlerkategorie vorstellen, die nicht in die bisher verfolgte Reihe ansteigender Komplexität (Wortfehler – idiomatische Fehler – Satzbaufehler) passt. Es gibt ein Phänomen, das ich motivierte Fehlleistungen nennen möchte. Auch Übersetzer sind in der Regel Menschen und denken immer nur an das eine. Und dann kann es schon mal passieren, dass man (bzw. in diesem Fall frau) den Satz hinschreibt: «Sie spürte sein Lachen bis ins Diaphragma»; im Original stand diaphragm, also «Zwerchfell». Da lacht verständlicherweise auch der Leser, denn das Aufspiessen von Übersetzungsfehlern hat eine komische Qualität. In Anlehnung an Immanuel Kants Definition in der «Kritik der Urteilskraft» kann man sagen: Das Lachen über den Fehler ist ein Affekt aus der plötzlichen Verwandlung einer gespannten Erwartung von Sinn in Unsinn. Es erinnert einerseits an den Aua-Effekt von Kalauern, kann andererseits Schadenfreude nicht verbergen: Jetzt schau dir bloss mal an, wie blöd der war. Um hier aber nicht nur als schadenfroher Kollegenveräppler dazustehen, ein durchaus beschämendes Beispiel aus meiner eigenen Produktion: Auch ich dachte 1995 (was ich Gott sei Dank also unter Jugendsünden verbuchen kann) anscheinend immer nur an das eine und habe eine frigid virgin Mary als «frigide Jungfrau Maria» übersetzt, was mir die Lektorin zu Recht um die Ohren gehauen hat: gemeint war eine kühle oder eisige Marienstatue irgendwo in Irland.
1 Hans Blumenberg: Gerade noch Klassiker. Glossen zu Fontane. München: Carl Hanser, 1998, S. 78.
2 Joachim Kalka: «It’s like this». Vom Übersetzen der Phrase. In: Schreibheft, Nr. 49 (Mai 1997), 170–172, Zitat S. 170.
3 Dieter E. Zimmer: Wettbewerb der Übersetzer. Die einstweilige Unentbehrlichkeit des Humantranslators. In: Redensarten. Über Trends und Tollheiten im neudeutschen Sprachgebrauch. Zürich: Haffmans, 1986, S. 173–207, erneut München: Heyne, 1996, Zitat S. 180.
4 Zimmer: Wettbewerb der Übersetzer, a.a.O., S. 180.
Ulrich Blumenbach
hat u.a. James Joyce, David Foster Wallace und Agatha Christie ins Deutsche übertragen. Derzeit arbeitet er an Joshua Cohens Grossroman «Witz», dessen Übersetzung aber wohl nicht vor 2020 erscheinen wird. Blumenbach lebt in Basel.