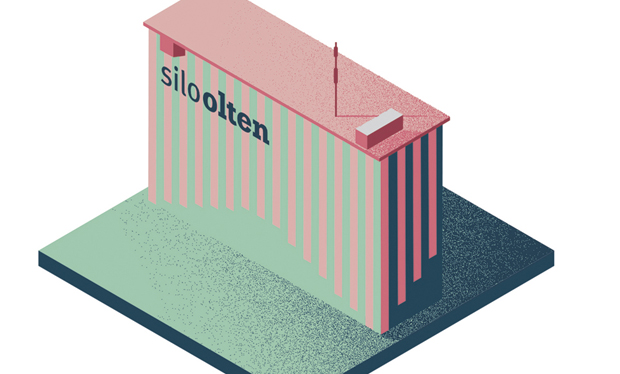Canettis Schatten
Während des Studiums gewöhnte ich mir an, die freien Nachmittage im Kunsthauscafé zu verbummeln. Ich las mich durch einen Stapel Zeitungen. Das hielt ich damals für lebenswichtig. Der gläserne Anbau mit den Topfpflanzen, den Tischtüchern und den einsam vor ihrem Gedeck kauernden Weisshaarigen erscheint mir im Nachhinein wie aus der Zeit gefallen. Vielleicht war es dieser Gegensatz, der mich reizte: das rasende Zeitgeschehen in Druckbuchstaben vor einer angestaubten, in sich ruhenden Kulisse.
Hin und wieder fiel mir dort ein Herr mit buschigem Schnurrbart auf, der mürrisch in seine Teetasse stierte, aber von den Kellnern, ausnahmslos Kurden und Libanesen, besonders zuvorkommend bedient wurde. Jedes Mal half ihm einer in den Mantel, und ich schaute der kleinen Gestalt nach, die an Rodins «Höllentor» vorbei davonwackelte. Als ich am 15. August 1994 die Nachrufe auf Elias Canetti las, wurde mir klar, wer der schnurrbärtige Herr gewesen war. Ein Literaturnobelpreisträger. Und ein vollendeter Exilant.
Grenzen, am eigenen Leib erfahren
Inzwischen gehöre ich selbst ein wenig zu den Exilanten. Im Jahr 2004 verliess ich Zürich, um in Berlin sesshaft zu werden, wie man sagt. Dass ich womöglich einem Trend folgte, konnte mir die Aufbruchsstimmung nicht verderben, noch kratzte es an meinem Selbstbewusstsein. Ich glaubte zu wissen, warum ich auswanderte: Überdruss zum einen, Neugier zum anderen.
Diese Gewissheit kam zum ersten Mal ins Wanken, als ich 2008 anlässlich einer Lesung im bulgarischen Ruse gefragt wurde, was mich bewogen habe, aus Zürich wegzuziehen. Für die Bulgaren mutete es absurd an: Jemand verlässt freiwillig die gelobte Schweiz, noch dazu Zürich, die Stadt, der sämtliche Umfragen bescheinigen, dass sie vor Lebensqualität überschäume, und wo angeblich das Geld auf der Strasse liegt. Ich flüchtete mich in eine Pointe, die soziologisch durchaus fundiert war: Ärzte, Ingenieure und Bankfachleute aus Deutschland würden nach Zürich ziehen, während im Gegenzug die Zürcher Kulturschaffenden nach Berlin auswanderten. Eine Art Bevölkerungsaustausch, scherzte ich. Der Balkan habe ja im letzten Jahrhundert ähnliches erlebt. 1913 seien die Türken in Bulgarien gegen Bulgaren in der Türkei ausgetauscht worden. Es wurde an dem Abend viel gelacht. Und über Literatur geredet. Und Wodka getrunken. Natürlich blieben die wesentlichen Fragen unbeantwortet.
Im Jahr darauf begegnete ich auf der Buchmesse in Frankfurt einer bulgarischen Germanistin, ausgerechnet einer Canetti-Spezialistin. Sie erwähnte meine scherzhafte Ausrede in Ruse. Was ihr an ihr missfallen hatte? Sie zeuge von der Arroganz eines Westeuropäers, der kaum je eine Grenze am eigenen Leib erfahren habe, schimpfte die Bulgarin. Und überhaupt. Sie kaufe mir den Wirtschaftsflüchtling nicht ab. Und die Denkfigur des selbstgewählten Exils finde sie einfach nur versnobt. Was mich wirklich aus Zürich vertrieben habe, wollte sie wissen. Im Rückblick bin ich mir noch nicht einmal sicher, ob die Dame die Frage tatsächlich aussprach. Gut möglich, dass ich sie ihr von den Augen ablas. Jedenfalls setzte sie in mir ein peinliches Grübeln in Gang. Mir war, als müsste ich mir gegenüber Rechenschaft ablegen.
Vielleicht hatte ich in Zürich eine Lofteinweihungsparty zu viel erlebt, wo ich als einziger Schriftsteller unter lauter Medienleuten, Fotografen, Architekten und Grafikdesignerinnen angestaunt wurde. Wie niedlich. Wovon ernährt sich so ein Schriftstellerchen? Ich hatte dabei weniger das Gefühl, ein exotisches Tierchen zu sein, als vielmehr den Verdacht, mich ins falsche Gehege verlaufen zu haben. In Berlin dagegen fand ich mich in Kneipen wieder, wo mein Bekenntnis, zur schreibenden Zunft zu gehören, kaum ein Augenbrauenzucken auslöste. Mal wurde mitleidig gelächelt, mal mit einer Kinnbewegung auf Umstehende gedeutet: Dort sei auch einer, drüben eine preisgekrönte Autorin, am Tresen zwei weitere Kollegen. Mindestens ein Dramatiker oder eine Dichterin war immer irgendwo. So wurde ich vom Exoten zum gewöhnlichen Schreiberling, einem der unzähligen Namenlosen im urbanen Prekariat. Das war neu für mich. Das tat weh. Zugleich weckte es mich aus meiner Zürcher Selbstgenügsamkeit.
Elias Canetti, unterbrach mich die Germanistin, habe in Zürich seine fruchtbarste Zeit erlebt. Von einem schlichten Wohnhaus an der Klosbachstrasse aus sei er in seine weitläufige Biographie eingetaucht, sei bis zu seinen Anfängen zurückgeschwommen, seine Kindheit im bulgarischen Rustschuk, dem heutigen Ruse.
Das habe bestimmt nicht an Zürich gelegen, sondern an Canettis notorischem Schreibdrang, sagte ich, vielleicht nur um die Dame zu ärgern. Zürich könne keine Heimat für Schriftsteller sein. Die Selbstzufriedenheit dort sei chronisch und epidemisch, hänge womöglich mit der Föhnlage zusammen, lasse auf jeden Fall den Geist träge werden, zum Krämergeist verkommen. In Berlin erlebte ich gleich von Beginn an eine produktive Reibung. Mein historisches Bewusstsein war, wie es sich für einen Schweizer gehört, unterentwickelt. Aber es lernte schnell, wuchs und gedieh prächtig. Kein Wunder. Zwischen Spree und Havel wimmelt es von Spuren der Historie. Die Dramen des 20. Jahrhunderts sind in das Stadtbild eingeschrieben. In den ersten Tagen stolperte ich über ins Pflaster eingelassene Messingtafeln, die die Namen jüdischer Familien nannten, die aus ihrem Zuhause vertrieben worden waren. Über die Museen, Gedenkstätten, Mahnmale, Vergangenheitsbewältigungen hinaus begegnete ich den historischen Verwerfungen in zahlreichen Lebensläufen. Ich lernte Biographien kennen, deren Brüche und Abgründe nicht psychischen Unzulänglichkeiten wie Wohlstandsneurosen oder Drogensucht geschuldet waren, sondern einem generationenübergreifenden, brutalen Schweigen, in dem das Grauen des vergangenen Jahrhunderts nachhallte.
Vermutlich sei ich das Gegenteil eines Exilanten, meinte die bulgarische Germanistin. Ich sei ohne Not aus dem saturierten Zürich geflüchtet, um mich ins Elend der deutschen Erinnerungskultur zu stürzen. Dahinter stecke wohl die schnöde Absicht, Stoff für einen neuen Roman zu gewinnen.
Als Exilant würde ich mich in der Tat nicht bezeichnen, entgegnete ich. Erst recht nicht, wenn ich mir die Lebensgeschichte eines Elias Canetti vor Augen führe, der als Jude überall angefeindet wurde. Rein praktisch gesehen ist es heutzutage ein harmloser Sprung von Zürich nach Berlin. Es gibt weder Visums- noch Grenz- oder Sprachprobleme. Das deutsche Fernsehen, die deutsche Presse, Literatur und Theater sind einem vertraut. Man befindet sich letztlich an einem Ort, den man zumindest vom Hörensagen bestens kennt. Dennoch – und das ist keine kleine Herausforderung! – ist man Ausländer. Wenn man mit dem Schweizer Pass im Mund geboren ist, kennt man dieses Gefühl eigentlich gar nicht. Gewöhnlich sind die anderen die Ausländer. Man selbst ist allenfalls Tourist, Ex-Pat, Geschäftsreisender oder Honorarkonsul. In Deutschland aber nimmt man es genau mit der Abstammung: Ich bin kein Deutscher, ergo bin ich ein Ausländer. Es wird in meinem Fall nicht unbedingt von Migrationshintergrund gesprochen, dafür liegt Zürich zu dicht an Stuttgart, aber Teil jenes ominösen Wir, das mal Weltmeister, mal Zahlmeister Europas oder Papst ist, werde ich nie und nimmer sein. In einem Land, das so beharrlich von der Suche nach seinem sogenannten Wesen besessen ist, dazu einerseits die Klassiker bemüht, den Goethe-Schiller-Wagner-Friedrich-Komplex, andererseits sich Abend für Abend die verwackelten Dokumentationen über den Bombenkrieg in England oder den Raketenbau auf Peenemünde oder Hitlers Sekretärin zu Gemüte führt, in einem solchen Land ist es schwierig, kein Ausländer zu sein.
Da könne ich mich doch glücklich schätzen, sagte die Bulgarin, die ein tadelloses, herzerwärmendes Deutsch sprach. Als Ausländer und Schriftsteller könne ich meinen Blick auf die Gesellschaft schärfen. So habe es auch Canetti getan, namentlich in «Masse und Macht». Für den Aussenstehenden gebe es keine Selbstverständlichkeiten. Jede Übereinkunft, jede Gewohnheit, ja noch die beiläufigste Routine der Einheimischen zerbrösle unter seinem wachsamen Blick. Und ihm stelle sich fortwährend die Frage, warum so und nicht anders. Und ob das Ganze überhaupt Sinn ergebe. Das seien doch die besten Voraussetzungen, um zu schreiben.
Theoretisch hatte sie recht, die Dame. Aber ich schreibe nicht über Deutschland oder über mein Leben als Ausländer in Berlin. Das interessiert mich schlicht nicht. Mag sein, dass der Leidensdruck zu gering ist. Oder mich beseelt heimlich weiterhin ein Hauch jener Zürcher Selbstgenügsamkeit. Wie dem auch sei: So wichtig mir Berlin inzwischen geworden ist, um keinen Preis möchte ich einen Roman über diese Stadt lesen, geschweige denn schreiben. Im Grunde kehre ich schreibend immer wieder nach Zürich zurück.
Das sei normal, bemerkte die bulgarische Germanistin. Schreiben heisse ja bekanntlich: erinnern.
Diesen Spruch habe ich schon immer gehasst. Ich weiss noch nicht einmal, ob er Thomas Mann, Jorge Semprun oder am Ende gar Canetti zuzuschreiben ist. In einem allgemeinen einfältigen Sinn trifft der Satz natürlich zu. Selbst eine banale Alltagsbeobachtung lässt sich im Moment des Niederschreibens nur als Erinnerung evozieren. Aber «Schreiben heisst erinnern» klingt nach einem Programm: Man kann nur über das schreiben, was vergangen ist; Gegenwart wie Zukunft sind bedeutungslos; Literatur nährt sich allein von den inneren Bildern, den Fotos, den abgelegten Dokumenten, dem ganzen Krimskrams auf dem Dachstock oder im Keller.
Das hiesse, sich eine erbärmliche Selbstbeschränkung aufzuerlegen, sagte ich zur Dame. Und, abgesehen davon sei Erinnern doch ohnehin nur der kleine Bruder von Erfinden.
Wenn ich in Berlin über Zürich schreibe, erwiderte sie, so würde ich zwangsläufig in die Vergangenheit zurückfallen, durch innere Räume streifen, in Erinnerungen wühlen.
Ich war zu müde, um ihr zu widersprechen.
«Schriftsteller neigen zu Selbstgesprächen», fügte sie nach einer Weile hinzu.
«Aber jetzt führen wir doch ein Zwiegespräch.»
«Sind Sie sicher?»
Zürich liegt in Berlin
Im November 2006 verbrachte ich zum letzten Mal mehrere Wochen am Stück in Zürich. Ich wohnte an der Scheuchzerstrasse, zusammen mit zwei Dutzend portugiesischen Bauarbeitern, in einem Mietshaus, das demnächst abgerissen werden sollte. Meine Heimatstadt im Spätherbst. Da es in Berlin faktisch bloss zwei Jahreszeiten gibt, den finsteren Winter und den lasziven Sommer, genoss ich jene Zürcher Novembertage mit ihren Technicolor-Farben und den langen Schatten. Ich sass in einem leergeräumten Zimmer vor meinem Laptop, vernahm das Rumpeln und Brüllen der Portugiesen und blickte zum Fenster hinaus auf das lachsfarbene Nachbarhaus. Drei Jahre später sollte ich von der bulgarischen Germanistin erfahren, dass just in dem Haus an der Scheuchzerstrasse Canetti mit seiner Mutter gewohnt hatte. Für den kleinen Elias sei es «das Paradies seiner Jugend» gewesen.
Ich schrieb zu der Zeit an einem Roman, der im Zürich der Achtzigerjahre spielte. Ich strengte mich an, versuchte Erinnerungen abzurufen. Ich spazierte zum Kunsthauscafé, um mich in jene Zeit zurückzuversetzen. Aber das gastronomische Konzept hatte gewechselt, ebenso das Ambiente, keine Topfpflanzen, keine Tischtücher mehr, und die Kellner sprachen ein sächsisch gefärbtes Hochdeutsch. Allein Rodins Monument stand weiterhin an seinem Platz.
Aber das genügte nicht. Mein Roman kam nicht voran. Während ich mir das Zürich der Achtziger zu vergegenwärtigen versuchte, bedrängte mich von aussen das Zürich der Nullerjahre. Das führte zu einer unproduktiven Reibung. Die sogenannte Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen verursachte Kopfschmerzen. Im Niederdorf fand ich zwar das legendäre krawallige «Malatesta», aber die Gäste dort sassen an weissgedeckten Tischen und zerlegten ihren Wolfsbarsch. Und hinter dem Viadukt starrte ich auf eine schicke Blocksiedlung, aber die alte Seifenfabrik, die an der Stelle gestanden hatte, zeigte sich nur als ein Schemen. Kurz vor dem Jahreswechsel brach ich auf. Ich überliess das Haus den Portugiesen, die entschlossen waren, bis zu dem Tag auszuharren, da die Abrissbirne auffahre. Silvester verbrachte ich grösstenteils in einem ICE. Zum Wagenfenster hinaus sah ich ein mir fremdes Deutschland vorbeirasen. Ich verlor den Glauben an meinen angefangenen Roman. Kaum war ich nach Berlin zurückgekehrt, fiel es mir jedoch leicht, die Achtzigerjahre in Zürich wieder aufleben zu lassen. Endlich sah ich ihn wieder, Elias Canetti, aber weder den Nobelpreisträger noch den Exilanten, den Todesverächter, den Frauenverschlinger oder Zürichverehrer, sondern ein altes, schnurrbärtiges Männlein, dem ein Kurde in den Mantel half, bevor es über den Vorplatz des Kunsthauses wackelte, vorbei am «Höllentor».