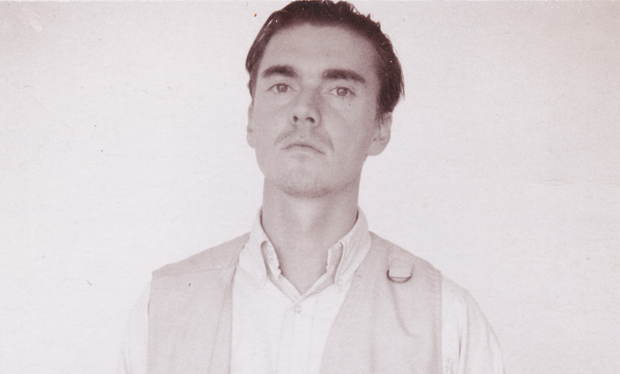Wege zur Schriftstellerei und die Rolle der «Schreibschulen»
Eine Art Synthese mit Anschlussfragen.
1. Dieser Schwerpunkt ist – ausser im Modus der Rückblende – ohne das Schlagwort von der «Institutsprosa» ausgekommen, und auch ohne die in diesem Zusammenhang oft gebetsmühlenhaft wiederholte Grundsatzfrage, ob man denn Schreiben überhaupt lernen könne. Interpretationsangebot: Nach 13 Jahren Biel und fast doppelt so langer (neuerer) Geschichte im deutschsprachigen Raum sind akademische Schreibausbildungen etabliert. Jetzt geht es um den Feinschliff.
2. Etwa, wenn es um die Zusammensetzung der Klassen und des Lehrkörpers geht. Zu den Klassen: Sicher, wenn man hauptsächlich das nachgymnasiale Sofortstudium promotet, hat man eine hohe Anzahl Bewerbungen von jungen Menschen, deren Eltern 120 000 bis 170 000 Franken im Jahr verdienen und die literarische Identitätssuche ihrer Sprösslinge finanziell absichern können, und eher wenige, die eigene Erfahrungen von Existenzangst, Migration oder Gewalt haben. Aber ist das nicht ein ziemlich realistisches Bild der Schweiz? Wenn man nicht mehr daran zu glauben bereit ist, dass aus dieser, ja, wohlstandsdurchsetzten und, ja, vielleicht «langweiligen» Umgebung gute Stoffe und «relevante» Literatur kommen können (weil doch das Publikum grossenteils ähnliche [Nicht-]Probleme hat: Identifikationspotenzial!), braucht man auch kein Schweizerisches Literaturinstitut, ja überhaupt keine Schweizer Literaturförderung.
3. Aber sollen die Eleven zumindest von dieser Welt mehr gesehen haben? Silvio Huonder fordert reifere Studierende in Biel. Sicher: Wenn eine Gesellschaft schon in die Produktion von Schriftstellern investiert, dann doch bitte in solche, an denen sie dann lange Freude haben kann, weil sie nachhaltig erzählen wollen – «müssen» – und auch können. Aber wie wäre sie zu messen, diese Reife? Lebensjahre allein machen noch keinen welthaltigen Stoff – und es gibt 19-Jährige, die in ihrem Ausdruckswillen schon sehr gefestigt sind. Ist es wie in der Fahrschule, wo ältere Prüflinge gelassener, fokussierter ans Ziel kommen? Könnte ein Praktikum «im Schreibbereich» als Zulassungsvoraussetzung Abhilfe schaffen?
4. Ist es nicht sonnenklar, dass jemand ohne einen Ausdruckswillen und ein Ausdrucksvermögen (vulgo: Talent) kein Schriftsteller werden kann? Gerade deshalb braucht es Techniken und Kniffe – ästhetische, rhetorische, dramaturgische etwa –, um vorhandenes Rohmaterial zum Glänzen zu bringen, die «eigene Stimme zu finden». Und diese kann man erlernen. Da immer weniger Verlage diese Arbeit leisten, sind die Institute willkommener «Ersatz».
5. «Die eigene Stimme finden»: Offenbar bedeutet das für die meisten Schreibtalente nicht zuletzt: Das Vertrauen entwickeln, dass da überhaupt eine eigene Stimme ist. Sich zugestehen, den ganzen Tag zu schreiben, nicht nur zu Randzeiten, unsicher, als Hobby. Ein künstlerisches Bewusstsein entwickeln und entstehen zu lassen. Jemand wie, sagen wir, Michael Fehr mag wirken, als wäre er mit seiner «Stimme», wie wir sie heute kennen, auf die Welt gekommen. Auch er hat aber wiederholt betont, dass er genau diese Phase und den Rahmen in Biel, der diese Entwicklung ermöglicht hat, gebraucht habe.
6. Interessant, dass – wie Biel-Mitgründer Daniel Rothenbühler schreibt – eine Hauptmotivation hinter der «Idee Literaturinstitut» gerade die war, Raum für eine weniger akademische Auseinandersetzung mit Literatur zu schaffen. (Interessant auch, dass just Raymond Carver, dessen Sack an Lebenserfahrung kaum praller hätte gefüllt sein können, zum stilistischen Vorbild für die angeblichen Bauchnabelschauen saturierter Bürgerkinder wurde.)
7. «Schreibschule» ist nicht gleich «Schreibschule»: Biel verfügt mit dem Mentoratskonzept und dem starken Fokus auf eigene Schreibvorhaben über ein klares, unterscheidbares Profil (und punktet auf Nebenschauplätzen wie der nicht vorhandenen Sexismusdebatte qua angemessenem Frauenanteil auf allen Ebenen). Dass in Biel der Fokus eher auf Harmonie als auf «Debatte» liegt und der Umfang der zu leistenden Pflichten eher gering sei, kann bemängelt, aber ebenso gut als Zugeständnis von grösstmöglicher Freiheit und Eigenverantwortung gelobt werden – oder gar als subversives Element gegen eine allzu grosse Verschulung. Die Kreditpunkte pro Modul jedenfalls, das suggeriert ein Blick auf den Modulplan, werden in Biel ziemlich grosszügig vergeben (psst, nicht zu laut aussprechen, Bologna hört mit).
8. Zum Lehrkörper: Will man nicht die Kulturförderung grundsätzlich in Frage stellen, ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass ein Literaturinstitut auch Arbeitsbeschaffungsmassnahme ist, Schriftstellerinnen und Schriftstellern also ein sicheres Zubrot (oder: Basiseinkommen) bietet, das sie gerade im Fall Schweiz mit ihrem sehr überschaubaren Buchmarkt dringend benötigen. Nur die allerwenigsten Schweizer Autoren können allein von Verkäufen leben, die Dozenten- oder Mentorentätigkeit ist dann eine Möglichkeit (neben Werkbeiträgen, Stipendien und Preisgeldern), sich unabhängig von Marktkriterien literarisch zu entwickeln. Publikumserfolg kann nicht das einzige Kriterium für «gute» Literatur sein.
(Die Frage, warum sich eine Gesellschaft so ein Institut leisten sollte, ist selbstverständlich legitim. Untauglich zur Beantwortung ist allerdings der meist unweigerlich an die Frage anschliessende Wertungsdiskurs: Warum Kunsthochschulen, aber keine Literaturinstitute?)
8a. Wenn Sonja Lewandowski in ihrem Essay die Gefahr nennt, dass über die Schreibstudiengänge ein geschlossenes, sich perpetuierendes Versorgungssystem entsteht, dann muss die Betonung deshalb auf «geschlossen» liegen. Nicht nur in bezug darauf, dass an den Schulen vor allem Akademiker – und das heisst mittlerweile auch: Alumni vergangener Studienzyklen – lehren. Die um die Institute gebildeten Netzwerke greifen auch ausserhalb dieses Rahmens, und die Grenzen zwischen «Netzwerk» und «Filz» sind bekanntlich fliessend. Die eine sitzt hie, der andere da in einer Kulturkommission oder Jury, man tritt in diesem geschlossenen System in mehrfacher Funktion auf und schiebt einander Preise und Werkbeiträge zu. Einmal «zertifiziert», kann man sich so von Werkbeitrag zu Stipendium hangeln, im Extremfall auch ohne nennenswerte eigene literarische Produktivität. Die writers who are not writers and produce other writers who are not writers, es gibt sie, auch in der Schweiz.
8b. Und wenn in den Vergabegremien für kantonale oder umso mehr für kommunal finanzierte oder privat gestiftete Werkbeiträge Personen einsitzen, die nur beschränkt über Kriterien etwa zur Analyse von Sprache und Form verfügen, wird doch ihre Wahl im Zweifel auf den «zertifizierten» Schriftsteller und nicht auf den «No-Name» fallen; das Qualitätslabel «hat in Leipzig studiert» oder «lehrt in Biel» ist so auch willkommene Absicherung gegen allfällige Kritik an der Vergabe. Gerade in der Schweiz, wo es nur ein Literaturinstitut gibt, ist die Gefahr, dass man als Bieler «drin», ohne aber tendenziell «draussen» ist, real. Die Netzwerke der «Schreibschulen» sind eine grosse Stärke, aber auch ihre wohl wichtigste Schwäche.
9. Noch ein Wort zur ausgemachten Marginalisierung von Minderheiten, zum Sexismus, zu ungesunden Machtstrukturen: Diese Probleme sollen unbedingt thematisiert werden, insoweit sie vorhanden sind. Aber es sind Probleme, mit denen Literaturstudiengänge nicht exklusiv kämpfen. Wer sie benennt und kritisiert, stellt nicht mehr grundsätzlich in Frage, ob Literatur im akademischen Umfeld studiert werden kann, sondern will die strukturellen «Herstellungsbedingungen» verbessern, optimieren. Die Diskussion ist einen Schritt weitergekommen; das ist begrüssenswert.
10. Nehmen wir an, ich hätte eine Patentochter – oder einen guten Freund – mit Schreibtalent. Würde ich ihr oder ihm empfehlen, sich in Biel zu bewerben (oder in Leipzig, Wien, Hildesheim)? Natürlich würde ich das! Zwei Jahre Input für das eigene Schreiben – in Theorie und als ständiges Feedback–, das Mentorat als Eins-zu-eins-Betreuung mit Profischriftstellern, Vorbildern vielleicht sogar, und fast nebenbei werden Netzwerke gebildet und erste Erfahrungen mit dem Literaturbetrieb gesammelt (oder im Rahmen hochschuleigener Projekte simuliert). Top. Und wenn’s nicht klappt, hat man doch ein reguläres Diplom in der Tasche.
11. Aber eben: Was ist mit den anderen Talenten, den Nichtbielern? Autoren wie Peter Zimmermann (Kurzgeschichte in diesem Heft!), der Wettbewerbe gewonnen hat – und doch noch ohne Verlag dasteht? Sind Schreibschulen doch zu dominant? Oder die Gatekeeper mitunter doch zu faul?
Schreiben als Studium: das funktioniert. Gute Sache! Sorge muss eher dazu getragen werden, dass auch andere Wege in den Betrieb möglich und offen bleiben.