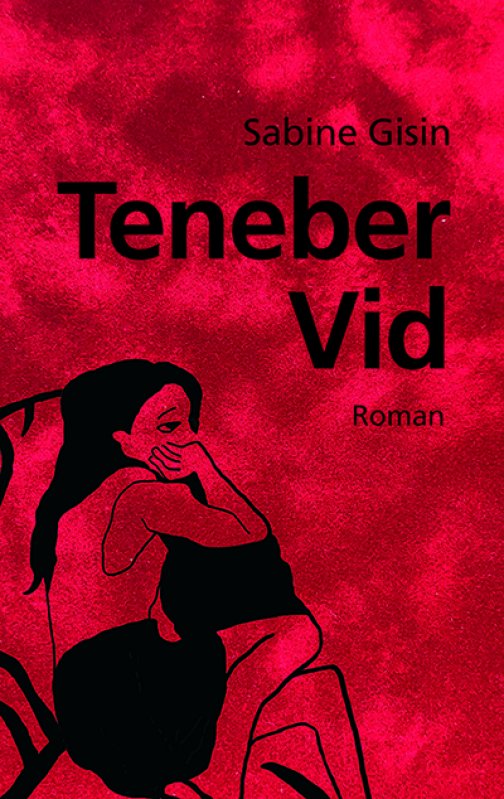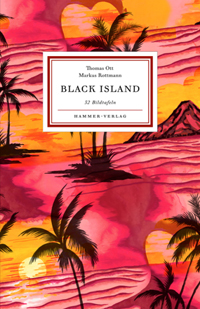«Ich weiss gar nicht, warum man am Klischee vorbeikommen will»
Er gehört zu den erfolgreichsten Schriftstellern Deutschlands, seine Lyrics zu den besten in deutscher Sprache. Mit wem sonst sollte man also über Literatur und Musik sprechen?
Herr Regener, bei welchem Songtext sagen Sie: «Schade, dass ich das nicht war»?
«Ain’t No Sunshine When She’s Gone» von Bill Withers.
Warum ist der so gut?
Weil er nur so wenige Worte braucht und damit alles sagt. Und so gut klingt!
Bei Element of Crime schreibt ihr zuerst die Musik, der Text kommt erst danach. Das heisst ja auch: Ihr findet den Song schon gut, bevor ein Text da ist. Wird die Rolle des Songtextes für das «Gesamterlebnis Song» überschätzt?
Man kann Songtexte ebenso wenig überschätzen, wie man Gitarrenspiel oder Schlagzeug überschätzen kann. Es hängt immer davon ab, worauf man gerade achtet. Songtexte sind
musikalische Werke, Songtexte zu schreiben ist eine musikalische Handlung. Wenn man die Musik gemeinsam in einer Band entwickelt, dann ist es naheliegend, die Songtexte eher später als früher zu schreiben. Je mehr man über die Musik weiss, desto besser kann man den Text dazu entwickeln. Es würde ja auch niemand ein Gitarrensolo spielen, bevor Schlagzeug und Bass aufgenommen wurden. Es kommt beim Songtexten letztendlich darauf an, die Geschichte zu finden, die man die ganze Zeit in der Musik schon zu hören glaubte.
Wie muss ich mir Ihre Textarbeit vorstellen, wenn die Band einen neuen Song musikalisch für gut befindet: Alle sind ganz heiss darauf, das tolle neue Stück zu finalisieren, und erwarten den Text zur nächsten Bandprobe – und Sie versuchen das möglichst zu schaffen?
Genau so ist das. Aber mit Arbeit hat das nichts zu tun. Musik wird gespielt. Man probiert herum, versucht, verwirft, improvisiert, gemeinsam oder, gerade wenn es um den Text geht, dann auch zu Hause allein mit der Gitarre und der eigenen Stimme. Trinkt ein Bier dabei und macht zwischendurch auch mal einen kleinen Mittagsschlaf, die Geschirrspülmaschine an oder die Steuererklärung. Wenn dann der Text zum Lied kommt, ist das ein bisschen wie in der Endmontage eines Automobils, wenn der Motor auf die Karosserie trifft. Das hat dann eine neue Qualität und ist mehr als die Summe der einzelnen Teile. Und ja, da sind dann alle auch ganz heiss darauf!
Bei der neuen Element-of-Crime-Platte «Schafe, Monster und Mäuse» scheint den meisten Leuten (oder vielleicht: Journalisten) vor allem aufzufallen, dass viel Berlin darin vorkommt. Haben Sie nicht immer über Berlin gesungen, auch ohne wie diesmal Ku’damm, Schlesisches Tor und Co. zu nennen?
Ja und nein. Sie haben auf jeden Fall recht. Nur: Wir haben eigentlich nie «über Berlin» gesungen und tun das in dem Sinne auch auf der neuen Platte nicht: Bei uns sind Städte immer Hintergrund, Kulisse, Bühnenbild, keine handelnden Subjekte. Wenn in einem Liebeslied eine Zigarette geraucht wird, ist es ja auch kein Lied über das Rauchen.
Da haben Sie natürlich recht. Aber anders gefragt: Ist aus eigener Erfahrung oder Beobachtung zu schreiben der einzige Weg, am Klischee vorbeizukommen?
Ich weiss gar nicht, warum man am Klischee vorbeikommen will. Das kommt mir irgendwie unfrei vor. Über so was mache ich mir keine Gedanken.
Was ist mit politischen Texten? Haben Sie nie den Drang verspürt, die Ihnen zur Verfügung stehende Öffentlichkeit zu nutzen, um «Position zu beziehen», in- oder ausserhalb von Songtexten? Was halten Sie davon, wenn andere Bands das tun, wie zuletzt in Chemnitz?
Wir haben die Band nicht gegründet, um eine politische Agenda zu verfolgen. In der Politik hat Gesang keinen Platz, da gibt es andere, bessere Kommunikationsmittel, Debatte, Rede, Manifest, Flugblatt, Essay, Journalismus, was auch immer. Element of Crime haben Anfang der 90er Jahre, als es in grösserem Stil Angriffe gegen Asylbewerberheime in Deutschland gab, bei einem Konzert gegen rechts gespielt. Es gibt auch ein Lied von uns, das damit zu tun hat, es heisst «Unter Brüdern» und findet sich auf der Platte «An einem Sonntag im April». Das macht aber Element of Crime nicht zu einer explizit politischen Band. Nicht einmal zu einer implizit politischen. Die Sache in Chemnitz fand ich gut.
In Bob Dylans Wikipedia-Eintrag steht, er sei Musiker «und Lyriker». Ich habe irgendwie das Gefühl, Sven Regener, der Songtexter, würde sich nicht als Lyriker bezeichnen.
Natürlich sind alle Songtexter Lyriker. Die Lyrik ist die musikalischste Seite der Literatur. Darum haben es die Lyriker auch so schwer unter den Literaten. Die Songtexter sind dagegen Mitglieder der Gema bzw. der Suisa, nicht aber der VG Wort bzw. der ProLitteris. Das sagt doch eigentlich schon alles.
Und doch kann man es mit Songtexten bis zum Literaturnobelpreis schaffen. Ist das überhaupt eine treffende Würdigung für einen Songtexter? Die Auszeichnung behauptet doch letztlich, Bob Dylans Texte funktionierten auch ohne Musik, bräuchten sie gar nicht. Ist nicht der beste Songtext einer, der mit der Musik seine volle (auch sprachliche) Wirkung entfaltet?
Nun ja, Bob Dylan hat jeden Preis der Welt verdient und warum also nicht den Literaturnobelpreis? Wer ansonsten feststellt, dass ein Songtext auch ohne Musik funktionieren kann, mag ja recht haben. Aber es ist kein Kompliment, eher irgendwie belanglos. Der Motor funktioniert sicher auch ohne Karosserie. Aber wozu?
Songtexte werden ja in der Legende oft auf Bierdeckel, auf Schreibblöcke mit Hotellogos oder in Kladden mit abgegrabbelten Ecken geschrieben. Weil das eben «genau dann genau dort geschrieben werden musste» – und dann fotografiert man es stolz fürs Booklet. Andere Songwriter, angeblich zum Beispiel Nick Cave, gehen dafür ins Büro und machen um 17 Uhr Feierabend. Wie, wo, wann schreiben Sie?
Ich mache mir keine Notizen, ich mache viel im Kopf. Wenn man es sich nicht merken kann, ist es nicht gut genug. Später, wenn sich eine Idee verfestigt hat, spiele ich dann zu Hause damit herum, immer in Sichtweite meiner Gitarren.
Ist das ein anderer Habitus als beim Romanschreiben?
Beim Romanschreiben sitze ich auch zu Hause. Und auch dabei mache ich vieles zunächst im Kopf, ich denke lange nach, bevor ich etwas aufschreibe. Ich mag es, wenn die Dinge möglichst lange in der Schwebe bleiben. Aber die Gitarre bleibt aussen vor.
Apropos Romanschreiben: Im Sommer schrieben Sie auf Ihrer Website, ruhig sei die Welt von Sven Regener, dem Schriftsteller, eine echte «Kraut-und-Rüben-Existenz». Wie sieht das aktuell aus – Platte im Kasten und erschienen, jetzt wieder ein Buch?
Ich habe Pläne, aber ich würde sie nicht verraten wollen. Wenn die dann nicht aufgehen, steht man plötzlich als Ankündigungsweltmeister da! Ansonsten ist es schon wahr: Am besten zum Romanschreiben ist die Zeit zwischen zwei Alben. Und umgekehrt.
Sind Musik und Schriftstellerei also Welten, die Sie klar trennen? Arbeiten Sie da sozusagen blockweise?
Ja, ich arbeite blockweise. Wobei man natürlich live spielen kann, während man an einem Roman schreibt, wie man auch Lesungen geben kann, wenn man gerade Songs schreibt. Ich habe auch schon auf einer Tournee, das war die «Wir-hängen-tagsüber-ab-und-spielen-abends-im-Club»-Tournee, an einem Roman geschrieben, an «Magical Mystery oder Die Rückkehr des Karl Schmidt», das ging wohl vor allem deshalb, weil man da tagsüber so viel abhing! Aber gleichzeitig Songtexte und Romane schreiben geht nicht, weil beides vor allem im Kopf stattfindet, ich also die Dinge lange im Kopf mit mir herumtrage, bis ich sie aufschreibe, beim Songtextschreiben dazu noch die Melodie, deshalb kann man das nicht zeitgleich durchziehen, davon käme nur Kummer und Verwirrung.
Also kein spontaner Songtext auf einer Serviette, während Sie «eigentlich» am Romanschreiben sind?
Auf Servietten schreibe ich nie. Ich mache, wie gesagt, keine Notizen, ich behalte alles im Kopf. Oder auch nicht. Manchmal entstehen die Dinge auch unabsichtlich. Das erste Kapitel von «Herr Lehmann» war eigentlich eine Kurzgeschichte namens «Der Hund». Die hatte mir so gut gefallen, dass ich dauernd darüber nachdachte und sie schliesslich neun Jahre nach ihrer Entstehung weiterschrieb, und so entstand dann der Roman.
Ein Unterschied zwischen Romanen und Lyrics ist offensichtlich: Der Roman hat 500 Seiten, der Song dauert allenfalls 5:00 Minuten. Was bedeutet das dafür, wie man sich in so einem Format mit Sprache ausdrücken kann?
Ich mag an den Büchern das Ausufernde, gerade auch in der Rede der Leute, das gefällt mir gut. Ich mag auch die langen, verschachtelten Sätze und all das andere, das einem in der Schule immer ausgeredet wird. An so was habe ich meinen Spass. Manchmal findet das auch seinen Weg in die Songs, wenn ein Satz sich über viele Zeilen dehnt, aber da ist das dann noch einmal was ganz Besonderes, weil durch die Verteilung über ebendiese Zeilen und den Kontrapunkt der Reimsetzung neue Akzente in den Satz kommen, von der Wirkung der Gesangsmelodie und ihrer Periodik ganz zu schweigen. Insofern kann man das nicht wirklich vergleichen. Ansonsten ist bei Songtexten das Musikalische, das eigentlich rein Musikalische, das die Sprache dort bekommt, äusserst faszinierend, aber natürlich auch ein enges Korsett. Nach einem Buch freue ich mich immer auf das Songschreiben und nach einer Platte auf das nächste Buch.
Musik ist dennoch auch in Ihren Büchern sehr präsent, Personal und Szenen sind denen in den Songs durchaus ähnlich. Oder gibt es aus Ihrer Sicht Figuren oder Szenen, die in einem Song, und andere, die in einem Roman nicht passen?
Ich befürchte, Sie gehen mit Ihrer Frage von falschen Voraussetzungen aus. Sie setzen bei mir eine Kontrolle und eine Bewusstheit voraus, wenn es um das Schreiben von Songs und auch von Romanen geht, die ich nicht habe. Ich kann Ihnen allerdings ein Motiv sagen, das sowohl in einem Roman von mir vorkommt wie auch in einem Lied von Element of Crime. Es gibt in «Neue Vahr Süd» eine Stelle, da sitzt Frank Lehmann mit seinen Eltern beim Essen im titelgebenden Neubauviertel in Bremen und sinniert darüber, dass dort die Bäume jetzt grösser, die Häuser aber kleiner sind als früher, für ihn ein klares Zeichen von Älter-, Grösserwerden und ein Anlass für Melancholie. In dem Lied «Still wird das Echo sein» gibt es die Zeile: «Die Häuser sind klein und die Bäume sind gross und früher war’s umgekehrt.» Die Platte erschien 2005, das Buch 2004. Die Beobachtung habe ich wahrscheinlich in den frühen 80er Jahren selber mal gemacht, aber das geht ja wohl fast jedem so.
Über Ihre Bücher wird gesagt, da passiere eigentlich gar nicht so viel, das aber genau so wie in echt. Ein schönes Kompliment?
Ich finde, in den Büchern passiert enorm viel, aber das liegt vielleicht im Auge des Betrachters. «Wie in echt» ist es nicht, es ist ja Kunst, aber eben eine, die einen Teil ihrer Kraft aus einem trügerischen Realismus schöpft. Wenn das als Kompliment gemeint ist, dann ist es natürlich eins. Wenn es als Kritik gemeint ist, dann eben das. Die Gründe, warum jemand etwas mag oder nicht, sind ja immer sehr verschieden und meist ganz andere, als man selber hat, und das finde ich eigentlich ganz gut.
Mit «passiert nicht so viel» ist vielleicht präziser gemeint: Szenen, in denen äusserlich wenig Spektakuläres vor sich geht, sind bei Ihnen oft besonders lesenswert. Ich meine, das (und dass diese Szenen eben so «echt» wirken) kommt sehr stark durch die bis ins Detail geschilderten Dialoge – die inneren der Figuren mit sich selbst, die der Figuren untereinander. Ist die gesprochene Sprache einfach menschlicher?
Die Menschen singen dauernd ihr Lied in fast allem, was sie sagen. Es geht immer um mehr als nur darum, eine Botschaft zu vermitteln oder eine Auseinandersetzung zu führen, Informationen einzuholen oder ähnliches, vor allem singen die Menschen, wenn sie reden, ein Lied von sich selbst. So habe ich Walgesänge immer verstanden, dass die Wale einfach singen, um zu zeigen, dass sie da sind, und je einsamer sie sind, desto mehr tun sie das. So auch die Leute. Ich verzichte in meinen Romanen auf detaillierte Beschreibungen der Personen, weil ich glaube, dass sie sich durch das, was sie sagen und wie sie es sagen, selber beschreiben, auch wenn sie das vielleicht gar nicht merken.
Ich kann mir ganz gut vorstellen, wie sich so ein Gedankenstrom entwickelt – wie man beim Verschriftlichen damit Schritt hält, deutlich weniger. Wie bringen Sie diese Mündlichkeit zu Papier? Steigern Sie sich selbst in einen Redeschwall und nehmen das auf, um es später zu transkribieren?
O nein, Gott bewahre, ich habe mal beruflich so was machen müssen, als Fremdsprachenkorrespondent, mit Diktatkassetten und einem Abhörgerät, das ist furchtbar anstrengend. Ich komponiere alles, was ich schreibe, ganz in Ruhe, ohne Schwall und ohne Gedankenstrom. Na ja, vielleicht ist da ein Strom, aber keiner, der nicht gezähmt werden könnte.
Ihre Romane sind lustig, absurd, im besten Sinne unterhaltend. Warum sagt man das eigentlich kaum je über Element-of-Crime-Songs, obwohl darin doch die gleichen Figuren spielen, warten und mit ihrer Unzulänglichkeit klarzukommen versuchen? Ist es die Musik, Akkordeon und Trompete? Oder geht das vielleicht nur auf mehr Raum – auch hier, der Mensch in seinem ständigen kleinen Scheitern und Wiederaufstehen, Verheddern und Umwege gehen?
In der Musik ist Humor, der ja vor allem der Distanzgewinnung dient, nicht besonders wirkungsvoll, weil ja durch die Musik selbst und die durch sie stattfindende abstrakte Verklärung bereits Distanz zum Geschehen erreicht wird. In der Musik ist auch das Traurige schön und das hilft schon mal. Auch in Songtexten ist Witzigkeit nicht das höchste Gut, weil sie das Ambivalente auflöst und dadurch eine Verflachung bewirkt. Meine Romane erzählen eigentlich auch sehr traurige Geschichten, aber das ist in der Literatur ohne Humor in der Regel nicht zu ertragen, je trauriger die Geschichte und je grösser die Möglichkeit zur Identifikation beim Leser, desto dringender bedarf er eines Distanzmittels, und da kommt Humor gerade recht. Was also der Humor in den Romanen bewirkt, bewirkt bei den Songs von vornherein die Musik.