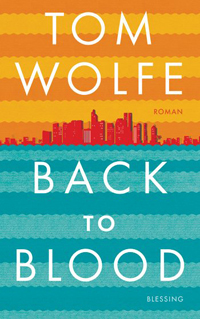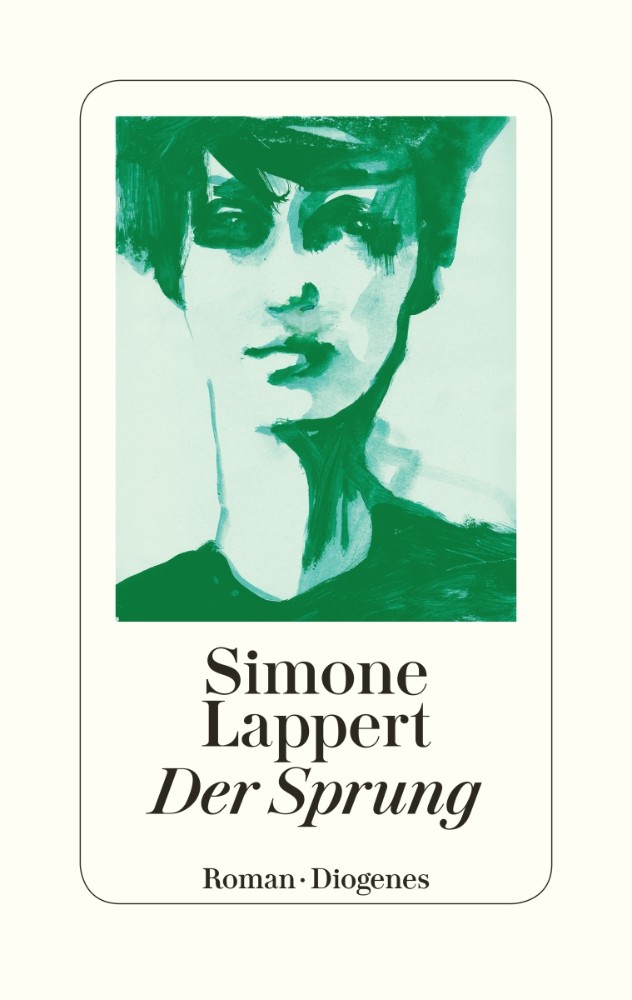Piano, piano
Ein Zustand in Dur.
Den Job und die Wohnung gekündigt, der Familie und dem Partner den Rücken gekehrt, stehe ich am ersten Tag dieses neuen Jahres mit einer Kiste voller Bücher und Klamotten in der Empfangshalle der Cité Internationale des Arts in Paris. Sehr darauf bedacht, mich in die Haltung einer werdenden Autorin einzufinden, warte ich, bis man mich in mein Atelier führt, wo ich für die nächsten drei Monate mein Quartier aufschlagen werde.
Als mich der Concierge mit einer Willkommensgeste zum Eintreten auffordert, gerate ich in einen musikalischen Wolkenbruch. Eine Kakophonie aus allen Instrumenten, von denen ich je gehört habe (und noch ein paar mehr), schallt durch den Raum. Es sei ein altes Gebäude, erwähnt der Concierge, 60er Jahre. In der Euphorie des Neuen winke ich seinen Kommentar lässig durch, Musik sei ja kein Baulärm, und werfe dem Mann unverhältnismässig viel Trinkgeld hinterher. Ein verklärter Zustand, wie ich bald feststelle.
Am zweiten Tag meines Paris-Aufenthalts ist alles eingerichtet und zum Schreiben bereit. Ich giesse feierlich eine Tasse Kaffee ein, setze mich an den Schreibtisch – und stelle fest, dass der Zimmernachbar zu meiner Linken um Punkt neun Uhr mit einer Tonleiterübung beginnt. «Diese Pünktlichkeit verheisst nichts Gutes», denke ich und ziehe in Betracht, dass es sich um ein Ritual handelt. Und wenn auch: «Jedem Tierchen sein Pläsierchen», spreche ich laut aus und starte den Laptop auf. Ich bin entzückt ob der vielen, fleissigen Klänge um mich herum, ein wahrer Musentempel und ich mittendrin ein Teil davon, wie schön! Wie schön! Ich schreibe keinen Satz.
Auch am dritten Tag beginnt um Punkt neun Uhr die Tonleiterübung, ein Rauf und Runter während exakt 45 Minuten. «Wo genau liegt die Grenze zwischen diszipliniert und zwanghaft?», frage ich mich, als auch Le oder La Pianiste über mir ab halb zehn den Tag einspielt. Ich beschliesse, meine Arbeit zu unterbrechen und durch die Stadt zu streifen. «Ich befinde mich ja nicht in Hinterkonolfingen!», sage ich mir, «sondern in Paris, Pa-ris! Hier gibt es einiges zu entdecken!», sage ich mir, «hier kann man sich die Tage um die Nächte schlagen!»
Am zehnten Tag verfluche ich die musischen Umtriebigkeiten in diesem Künstlerhaus in allen Tonlagen. Ich schleiche im Flur den verschlossenen Türen entlang und versuche die Quellen des Elends ausfindig zu machen. Wenn mir jemand begegnet, lächle ich und gebe einen Spaziergang zwecks Beinevertretens vor. Ob ich klopfen und mich beschweren soll? «Aber nein, es ist Kunst!», versichere ich mir, «die darf man nicht bekämpfen, gegen Kunst anzukämpfen ist ein Verbrechen, ein Vandalenakt, eine Barbarei! Ça ne va pas!» Ich schwanke zwischen Nachsicht und Ungeduld. Meine Anfangseuphorie hat sich gänzlich gelegt und die aus Übermut begangenen nachmittäglichen Kinobesuche gestalten sich zu Fluchtmassnahmen. Nach weniger als zwei Wochen habe ich die gesamte Retrospektive von Ingmar Bergmans Filmen gesehen.
«Wenn sie wenigstens Variationen spielen würden!», denke ich, wieder an meinem Schreibtisch sitzend. Die Unerträglichkeit entwächst der Repetition. Ich befinde mich in der Hölle der Wiederholung, bis auf die Spitze getriebener Stumpfsinn im Loop! Das ist kein Atelier, das ist ein Zustand! In Dur! Da hatte ich alle mir hinderlich scheinenden Umstände weggeräumt und abgeworfen, um den Kopf frei zu haben und zu schreiben, endlich schreiben zu können, und dann solch eine Widersacherei! Wie eine Kakerlakeninvasion strömen die Klänge von allen Seiten aus den Ritzen in mein Zimmer. Ich hebe die Füsse vom Boden und halte mir die Ohren zu. Meine Finger ballen sich zu Fäusten, die Schultern sind angespannt. Ich kann so nicht schreiben! Dann fange ich an, fiktive Nachrichten nach oben zu schicken: Liebe Pianiste, lieber Pianiste, gehen Sie doch mal raus, schauen Sie sich Paris an! Sie sind in Paris, hélas! «Diesen Unmenschen könnte man genauso gut in einem Oberaargauer Luftschutzkeller unterbringen», denke ich, «es machte für ihn keinen Unterschied. Das ist doch nicht normal, auch für Kunstschaffende nicht normal!» Ich schmeisse die Verpackung nutzloser Oropax an die gegenüberliegende Fensterfront.
Lieber Pianiste, liebe Pianiste, fuck you! Und als wäre mein Stossgebet erhört worden, beginnt Pianiste in der dritten Woche endlich in Variationen zu spielen. Nur erweist sich das als noch viel furchtbarer! Mein Ohr hatte sich an die Monotonie gewöhnt, nun verursachen die Variationen eine neue Unruhe. Die verinnerlichten Abläufe von Staccati und Fortissimi verkommen zum kompletten Chaos. «Dilettant!», rufe ich nach oben. «Das wird nichts mit deiner Klavierkarriere, das hört sogar mein Laienohr vom Schiff aus, das wird nichts!» Dann breche ich über dem Schreibtisch zusammen.
Die Musik lenkt meinen Tagesablauf. Nach drei Wochen bin ich auf die Tonleiter getaktet und erwache sieben Minuten vor neun Uhr. Ich liege im Bett und betrachte die von Faustknöcheln und Besenstielen verursachten Dellen in der Mineralfaserplattendecke, Zeugnisse von Wut und Verzweiflung meiner Vorgängerinnen. Ich finde in dieser gesammelten Ohnmacht ein bisschen Trost. Nach dem Kaffee setze ich mich in einen Stuhl, um das Elend mit Meditation zu lösen. Ich atme tief ein und aus und versuche, die ertönenden Melodien in die Atmung einzuflechten, die Klänge wie warmes Sonnenlicht in meinen Körper einfliessen zu lassen, mit den Tönen jede einzelne Zehe auszufüllen und sie dann wieder langsam hochwandern zu lassen, bis zum Knie, in den Magen, in die Brust – es geht nicht! Ich gebe auf. Ich kann so nicht arbeiten. Es geht nicht. Lieber Pianiste, Sie sind kein Künstler, Sie sind eine Maschine. «Das ist keine Kunst! Das ist Drill! Fliessbandarbeit! Ein Affront!»
Um den Aussenangriff mit elektronischer Musik abzuwehren, bewege ich mich ab Tag fünfundzwanzig nur noch mit Kopfhörern durch mein Atelier. Als ich einen Textentwurf probehalber spreche, schreie ich, um meine innere Stimme zu hören und mich auf das Geschriebene überhaupt konzentrieren zu können. Ich schreie also in meinem Atelier einen Text, um die elektronische Musik zu übertönen, welche das Klavierspiel im Atelier über mir überspielen soll, damit ich überhaupt meine innere Stimme hören kann. Zu viel des Lärms. Wild entschlossen gehe ich spazieren. Aber ja, fantastisch, Le oder La Pianiste hat sich in mein Ohr verkeilt, ich schleike Pianiste durch die ganze Stadt mit. Le oder La verfolgt mich jetzt also auch ausserhalb des Ateliers. Ich bin also auch draussen gezwungen, den Lärm im Ohr mit Gegenmusik zu bekämpfen. Ich werde dauerbeschallt.
Montagmorgen, Woche vier: Ich schlage die Augen auf, strecke beide Mittelfinger gegen die Zimmerdecke und artikuliere laut die ersten Worte in die neue Woche: «I’ll kill you!» Ich steh auf und rezitiere noch vor dem ersten Kaffee lauthals ein willkürlich aufgeschlagenes Baudelaire-Gedicht aus «Les fleurs du mal» aus dem Fenster in den Innenhof, um meinen Unmut kundzutun. Es tut mir gut.
Mittlerweile sind vier Wochen meiner wertvollen Pariser Schreibzeit vergangen und ich habe keine einzige Geschichte zustande gebracht. Ich muss nach oben gehen. Aber das geht nicht! Ich kann nicht einfach raufgehen, an die Tür klopfen und den Störenfried mit dem Problem, das ja mein Problem ist, konfrontieren. Denn ich muss in Betracht ziehen, dass ich auf Gleichgültigkeit stosse oder dass mir diese Kreatur unsympathisch ist oder noch schlimmer: dass wir in einen Streit geraten. Dann bekommt die Unerträglichkeit dieses Lärms eine erweiterte Dimension. Diesen Ablauf in Gedanken mehrmals bis zum Zerwürfnis durchgespielt, resigniere ich und versinke im Stuhl. Paris, c’est l’enfer! Und der Teufel ein Pianist.
Eine Stunde später klopfe ich an die Tür des Ministère chinois des Affaires étrangères. Komme, was wolle. Ich stelle mich bei La, es ist also eine La Pianiste, als die Nachbarin von unten vor und erläutere ihr meine Situation, indem ich Sätze um die Wörter silence, patience und nervous breakdown stammle. Dabei untersuche ich ihre Gesichtszüge nach Anzeichen von Empathie. Sie fährt ihre Augenbrauen nach oben und sagt: «I’m so sorry for you.» Nicht mehr, nicht weniger. Ich nicke verständnisvoll, was überhaupt keinen Sinn ergibt, drehe mich um und geh wieder in meine Zelle zurück.
Epilog
Nach eineinhalb Monaten habe ich einen neuen Schlachtumgehungsplan ausgeklügelt. Ich besuche abends die Open Studios und spüre Künstlerinnen und Künstler auf, die am Folgetag ausser Haus sind. Die meisten bieten mir Asyl für einen Tag an. «Aber bei mir ist ein Geiger nebenan, nervt auch.» – «Ein Geiger», winke ich ab und lächle müde. So tingle ich mit dem Laptop unter dem Arm von Atelier zu Atelier und finde Unterschlupf bei den Kroaten, bei den Kanadiern und bei den Holländerinnen, eine digitale Nomadin in der Cité des Arts. Wieso nicht, ja, wieso nicht.