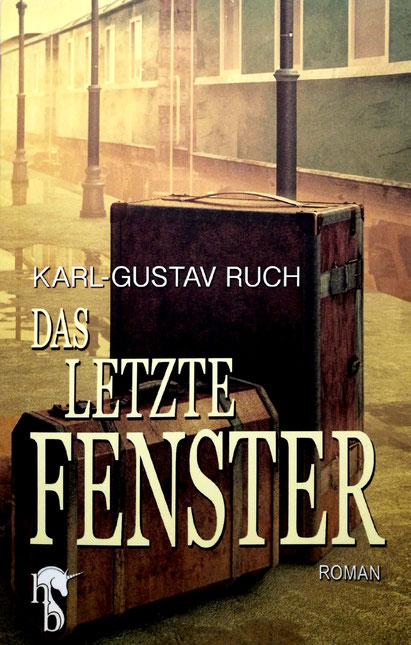Die Sache mit der Sauberkeit
Warum es zwischen Kreuzlingen und Göschenen keinen Popjournalismus mehr gibt. Eine Abrechnung von einem, der die wichtigsten Schweizer Redaktionen von innen kennt.
Vor drei Jahren suchte eine Magazin-Journalistin nach Liftgeschichten. Es sollte um Begegnungen im Fahrstuhl gehen. Bestenfalls Sex. Um Gefühle der Beklemmung und den Klassiker: das Steckenbleiben. Ich erzählte ihr, wie ich in Teheran nach einer Party mit jungen Iranern betrunken und bekifft im Hotelaufzug stecken blieb. Gefangen auf 2×2 Metern, in einem isolierten Staat, der Konsumenten bewusstseinserweiternder Substanzen mit dem Tod bestraft. Ich kaute auf dem Kaugummi, den mir die iranischen Freunde beim Abschied in den Mund gesteckt hatten, um meine Fahne zu verschleiern, und schied hyperventilierend aus dem Bewusstsein. Ein paar Wochen später stand die Geschichte im Magazin. Das Kiffen kam darin nicht vor. Der Chefredaktor finde, sagte mir die Journalistin, Cannabis schade der Reputation des Berufsstands.
Den Rausch der Gefühle, das eigene Empfinden in seiner radikalen Subjektivität in Worte fassen. Sich in Geschichten auflösen, das Ich auflösen im Wir. Bestenfalls erbarmungslos scharfe Beobachtungen, die auch Selbstentblössung nicht scheuen. Autoren, die sich nicht zu schade sind, so weit zu gehen, bis es schmerzt und schmutzig wird, die flüchtige Momente festhalten, in denen das grosse Ganze aufblitzt. Das ist Popjournalismus. Literarisch-erzählerisches Chargieren mit den Leitdifferenzen zwischen Fakten und Fiktionen, zwischen Objektivität und Subjektivität kann Teil davon sein.
Die Weltwoche war das letzte Schweizer Blatt, das den Zeitgeist auf bedruckten Seiten bändigte. Der Zeitpunkt, an dem sie sich davon verabschiedete, lässt sich nicht präzis bestimmen. Viele sahen ihn 2003 mit dem Wahlaufruf für die SVP gekommen. In den Jahren davor und auch noch danach blühte der Popjournalismus, die Weltwoche war der Hype. Albert Kuhns Popkritiken. David Signers ethnologische Expeditionen. Die Listen von Mathias Plüss. Eugen Sorgs Suche nach dem Bösen, seine erotische Vorliebe für das Wilde. Die leichte Feder von Bruno Ziauddin. Alles veredelt von Andreas Wellnitz, der die Artikel mit Bildern remixt, und Ingolf Gillmann, dem Textgott.
Das Team um Roger Köppel liess einen Hauch von Tempo-Gefühl aufkommen. Tempo war das Mutterschiff des Popjournalismus. Marc Fischer schrieb dort zum Beispiel die unfassbar anmutig erzählte Geschichte darüber, wie er mit Topmodel Kate Moss einen Nachmittag in ihrem Pariser Hotelzimmer verbrachte. Das war 1995, ich 16 Jahre alt, und diese Geschichte mein erster journalistischer Feuchttraum. Jeden Monat holte ich mir Tempo am Dorfkiosk, etwas verschämt, den Nackten auf den Titeln wegen oder Zeilen wie: «Wie wichtig ist der Penis?» Der Journalist in mir erwachte mit Tempo. So war das bei vielen Journalisten meiner Generation. 1995 ist auch das Jahr, in dem Christian Kracht seinen Debütroman Faserland veröffentlicht. Gut zehn Jahre später, von 2004 bis 2006, gibt Kracht dann mit Der Freund das neue beste Magazin aller Zeiten heraus. Finanziert von Axel Springer, der Redaktionssitz in Kathmandu, Nepal. Womit auch bewiesen wäre: Hohe Berge und Popjournalismus schliessen sich nicht zwingend aus.
Die Geschichte von Marc Fischer und Kate Moss ist eine der letzten Tempo-Geschichten. Es kündigen sich ernstere Zeiten an, für den Journalismus, überhaupt. Der Zeitgeist verändert sich. Tempo bleibt seltsam schrill, der Popjournalismus entdeckt seine konservative Seite. 1996 gehen in der Hamburger Redaktion die Lichter aus, und der Popjournalismus ist überall. Feuilletons deutscher Zeitungen prügeln sich um poppige Autoren. Köppel bringt als Magazin-Chef Popjournalismus 1997 in den Schweizer Mainstream. Katapultiert den Geist des Schweizer Magazin-Journalismus, geprägt von grossen Namen wie Laure Wyss oder Niklaus Meienberg, in die flimmernde Gegenwart. Namen, die schon Popjournalismus machten, als er noch einfach «aufregender Journalismus» hiess. Köppels frischer Wind inspiriert die damals etwas angestaubte Weltwoche zu ihrem legendären Experiment, sechs Journalisten mit sechs verschiedenen Drogen zu versorgen und schreiben zu lassen. Im Jahr 2000 stolpert Roger Köppel fast über die gefälschten Texte von Tom Kummer, ein Jahr später übernimmt er die Weltwoche und konsolidiert den Popjournalismus als Stosstrupp des konservativen Eskapismus.
Nein, Popjournalismus ist nicht nur Sex, Drogen, Innerlichkeit. Popjournalismus ist auch Politik. Geld. Geschwätz. Egoshooting. Scheitern. Popjournalismus ist eine Momentaufnahme, ein Spiegelbild der Gesellschaft, die sich in seinen Protagonisten erkennen kann. Und Popjournalismus würde, gäbe es ihn noch, die guten Fragen stellen, zum Beispiel diese hier: Wieso hat eine ganze Generation junger Schweizer Journalisten das Fühlen verlernt? Und warum lassen sich die Alten alle kaufen?
2006, als das Magazin Stil mit Haltung zu verwechseln beginnt, räumt Peer Teuwsen, der heute den Schweiz-Seiten der Zeit soliden Glanz verpasst, für Finn Canonica das Feld als Chefredaktor, der fortan ein Blatt verantwortet, das besser zu seinem Vornamen passen würde, mit dem er bei Tamedia im internen Telefonverzeichnis zu finden ist: Marco.
Harmlos und bünzlig ist das Magazin unter Canonica geworden, versessen auf Kinder und Kindererziehung und dieses allgegenwärtige Abfeiern der Kunst des schönen Lebens, weit weg von Dringlichkeit und Dreck. Das Magazin verwurstet das linksliberale Zürcher Leitmotto «Erlaubt ist, was nicht stört» in gepflegte publizistische Langeweile. Kürzlich brachte das Zeit-Magazin eine sehr aufwühlende, sehr explizite Geschichte über junge Palästinenser, die sich in Tel Aviv als Stricher verdingen. Canonica quittierte die Geschichte der Konkurrenz intern mit einem «Pfui».
Derselbe Finn Canonica dachte jüngst bei Facebook darüber nach, das Leben am Zürichberg, im Zürcher Seefeld, führe womöglich zu einer selbstreferenziellen Wahrnehmung der Welt, abgeschottet von der Realität. Damit bringt er das Magazin-Problem ziemlich präzise auf den Punkt. «Es ist die Kauf-, nicht die Überzeugungskraft der Babyboomer, die das Antlitz der Gesellschaft verändert», schrieb Frank Schirrmacher. Die Magazin-Macher sind wie auf Eis gelegte, schlecht gewordene Austern, an denen keiner mehr schlürft.
Die Sache mit dem Ich. Der Wirrniss aus Wahrheiten, Teilwahrheiten und Lügen, der Heuchelei, an der die Welt zugrunde geht, ein trotziges Ich entgegensetzen ist die Sache der Schweizer Journalisten nicht. Eine ganze Generation junger Journalisten macht Journalismus wie Banken ihre Finanzgeschäfte: kühl berechnend im Hintergrund, ohne eigenes Risiko.
Die Sache mit dem Geld. Eine ganze Generation altgedienter Journalisten verschachert den Journalismus meistbietend. Walter de Gregorio, einst bester Interviewer im Land, schwindelt für Fifa-Chef Sepp Blatter seine ehemaligen Kollegen an. Jetzt wird ein Fifa-Magazin geplant, mit an Bord ist Christian Kämmerling, Erfinder des SZ-Magazins. Finn Canonica verzichtet lieber auf Reportagen, als dass er seinen Bonus riskieren würde, der an die Einhaltung des Magazin-Budgets gebunden ist.
Die Sache mit der Sauberkeit. Daniel Ryser, einst poppiges Aushängeschild der WOZ, beim Magazin im grossen, schwarzen Nichts verschwunden, Träger eines Gonzo-Tattoos auf dem linken Oberarm, hat kürzlich in einer Reportage über das laotische Backpacker-Paradies Vang Vieng, die als Geschichte zehn Jahre zu spät gekommen ist und deshalb als Abgesang auf die Ära des Popjournalismus gelesen werden muss, den Sauberkeitswahn seines Vorgesetzten geradezu brillant karikiert. Ryser sitzt im Dunst des feuchten Dschungels, eine qualmende Opiumpfeife in der Hand, als sein Chef anruft: «Wie läuft es im Dschungel?», fragt er.
«Ich kann grad nicht reden.»
«Warum?»
«Weil ich gerade Opium rauche.»
«Wie bitte? Das geht nicht! Und das hat mit der Geschichte nichts zu tun. Komm sofort nach Hause!»
Warum es in der Schweiz keinen Popjournalismus gibt? Frei nach Jean Ziegler: Die Schweiz schreibt weisser. Das Derbe, eine eigentlich urschweizerische Sache, geht unserer Journaille zunehmend ab. Es scheint, als würde, je schmutzigere Seiten der Schweiz zu Tage treten, der Journalismus immer sauberer, oberflächlicher und verschämter.