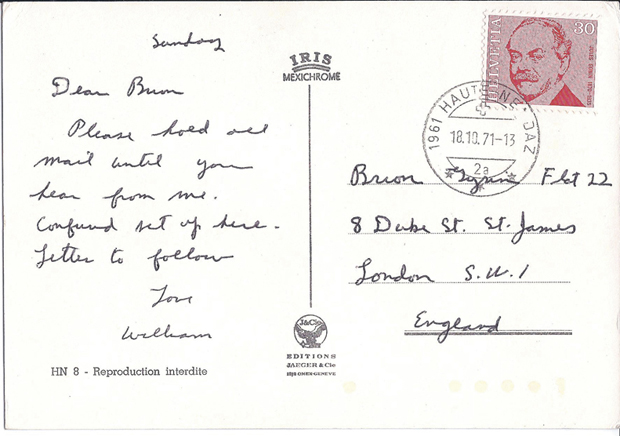Die Verdingdichter
Just do it! Ist das leichter gesagt als getan – oder umgekehrt? Werbetexter Markus Rottmann über das lockere Auftreten von scharfen Sprüchen und die unerträgliche Leichtigkeit einer harten Arbeit: das poetische Schreiben für andere.
Es gibt ihn auch im Literatursalon, den ungebetenen Gast, wie immer kommt er verspätet, leicht overdressed, war vorher noch auf einer anderen Party, aber jetzt steht er da, zwischen Lyrik und Poesie: der Werbetext. Er ist der Typ, der schon beim Reinkommen weiss, dass er nicht mithalten kann. Das macht ihn verkrampft – oder frei. Er darf billig sein, wenn er dabei Charakter zeigt. Er ist ein durchschaubarer Flirt. Ehrlich in seiner Absicht. Ein klarer Kerl. Das entspannt die Ladies. Wenn er jetzt noch Humor hat, eine gute Schnauze oder Esprit, dann werden die Platzhirsche unruhig. Mit seinen Sprüchen wie Reduce to the max, Just do it und Ich bin auch ein Tram macht er sie rasend. Der Werbetext verhält sich zur Lyrik etwa so wie der Herrgottsschnitzer zur Sixtinischen Kapelle. Aber war die nicht auch ein Bezahljob? Bei Beuys klingt das so: «Ob Werbung Kunst ist, kommt nur darauf an, wofür sie wirbt.» Eines aber muss man ihm lassen: der Werbetext hat Publikum, er wird gelesen, parodiert, ehrlich gehasst, viel zitiert oder leidenschaftlich ignoriert. Mit anderen Worten: er strotzt vor Leben. Das schafft die Lyrik noch gerade mal als Song. Und trotzdem bekommt Bob Dylan den Literaturnobelpreis jedes Jahr aufs neue nicht. Der Werbetext dagegen kann sich vor Preisen kaum retten. Doch wer diese Bühne sucht, muss pausenlos unterhalten, immer auffallen, und wenn er mal still ist, muss er das laut tun. Das macht auf Dauer nicht unbedingt sympathisch, und nicht jeder Autor, der sich im lärmenden Globe Theatre gegen Bärenschaukämpfe durchsetzen musste, ist ein Shakespeare geworden. Aber es gibt sie schon auch, die Sternstunden des Werbetexts. Denn wer’s ernst nimmt, der zielt höher als die Verkaufszahlen und höher als der Publikumsgeschmack. Es gilt etwas einzufangen, was grösser ist als das Produkt oder die Saison, was einen Kern berührt, der tiefer liegt. Die Meister aus England haben dafür das deutsche Wort Zeitgeist etabliert. Wer ihn bannt, ist nah am grossen Pop. Drei Worte können ein Jahrzehnt einfangen, die Erinnerung an einen Sommer oder eine Haltung, die weltweit zündet.
Yes, we can. Aber nur sofern sie ein Lebensgefühl verdichten, ohne es zu verkürzen. Generation X war so ein Wurf, aber es bedurfte noch eines mehrere hundert Seiten starken Buches, um den Begriff so aufzuladen, dass er eine Ära porträtierte. Einem Texter von Apple genügte dafür ein einzelner Buchstabe. Mit der Wortschöpfung iMac, iPhone, iPad hat er den heute alles bestimmenden Wunsch nach Selbstverwirklichung elegant und präzise auf den i-Punkt gebracht. Konkrete Industrie-Lyrik. Etwas weniger global zitiert: Geiz ist geil war der gültigere Satz zu Deutschland in den Nullerjahren als Wir sind Papst und Die Welt zu Gast bei Freunden. Er stammt übrigens von einem Schweizer. Vielleicht ein spätes Dankeschön für Wilhelm Tell, diese grosse Dichtung eines Deutschen, die heute ihr Dasein als National-Werbetext für die Schweiz fristet. Doch all dies Vergleichen offenbart auch die ewigen Unterschiede. Bei den Verdingdichtern muss nicht der Seelenschmerz unerträglich sein, um sich in höchste Höhen zu schwingen, sondern die Aufgabe möglichst unmöglich. Wie zum Beispiel den Amerikanern nach dem 2. Weltkrieg das Hitler-Auto zu verkaufen. Dafür musste man schon die Chuzpe und den jüdischen Humor eines Bill Bernbach haben. Es war ein Texter, der die Welterfolgsgeschichte von Volkswagen geschrieben hat. Und wo Lyrik Destillat sein darf, wird beim Werbetext selbst noch der Abfall riesenhaft auf Plakatwände geworfen. Die Gnade des Papierkorbs bleibt vielen Sprüchen verwehrt. Das ist meist nicht Schuld, aber Schicksal ihrer Schreiber.
Am schwersten trägt der Werbetext aber an seinem Dasein als ewiger Like-Button. Von Berufs wegen ist er einer, der immer nur vom Guten spricht, der in jedem Kuhfladen noch den Fünfliber erblickt und sich kaum je mit der Unbill des Daseins abgeben mag. Und so vermasselt er sich als keineswegs oberflächlicher, aber völlig unkritischer Zeitgenosse zuverlässig seinen Auftritt in der Hochkultur. Dafür geht er als letzter.