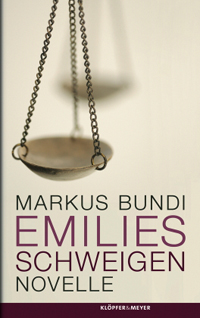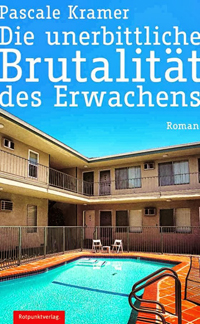Mit Chimären spazieren
«Michael Fehr sagt», unter diesem Titel haben wir 2013 lyrische Kaskaden eines Autors veröffentlicht, den heute die ganze Schweiz feiert, mitunter als neuen «Mundartautor». Mundartautor? «Nein. Nein. Nein», sagt Michael Fehr. Ein Gespräch über Sprachen jenseits von Schubladen – oder: ein Spaziergang mit Gotthelf, Frisch und dem Vogelfisch.

Michael, seit du deinen Roman «Simeliberg» veröffentlicht hast, redet die ganze lesende Schweiz über dich. Martin Ebel hat dich, leicht zynisch, gar schon zum «neuen Heilsbringer der Mundartszene» erkoren. Den heilsbringenden Gehalt deiner Literatur -wollen wir mal offenlassen und uns auf ihre sprachliche -Spezifität konzentrieren. In -deinem Buch, das in einem Berner «Krachen», ja im tiefsten Emmentaler «Pflotsch» spielt, webst du mundartliche Ausdrücke in ein hochdeutsches Textgefüge. Bist du damit Teil einer Mundartszene?
Nein. Nein. Nein. Ich wüsste nicht warum. Natürlich kann man das, was ich mache, als «Mundart» oder «mundartbezogene» -Literatur abtun. Damit kann man sich beruhigen, die Dinge verorten und sagen: «Dieser Jungspund hat seine Ecke dort, aus der soll er reden, wenn er ums Verrecken will – bedeutend ist aber sicher nicht, was aus ihr kommt.» Gegen diese Kategorisierung kann sich meine Literatur nicht wehren, das ist klar. Aber ich denke trotzdem: Wenn man sie wirklich liest, diese Literatur, dann merkt man, dass diese Etikettierung zu einfach ist. Denn ich pflege die Mundart nicht. Es geht mir nicht darum, mich besonders träf in einer Sprache auszudrücken, die ich zur Festivität machen will. Nie. Ich will etwas ganz anderes. Ich will in einer Sprache echt sein. Nahe bei dem sein, was ich für den richtigen Ausdruck halte. Die Sprache soll so klingen wie das Werk. Wie seine Geschichte. Das bedeutet aber nicht, dass ich berndeutsche Wörter in den Text flechte, weil die Geschichte in einem Emmentaler Krachen spielt. Es geht mir nur um den Klang, und spätestens wenn man klanglich denkt, spielt die Sprache an sich keine Rolle mehr. Dass ich Berndeutsch verwende, ist somit eigentlich nur noch Zufall.
Aber für einen Roman im Bauernmilieu eine immerhin ziemlich naheliegende Entscheidung. Max Frisch sagt: «Am Ende ist es immer das Fällige, was uns zufällt.»
Es gibt möglichere und unmöglichere Zufälle. Es ist eine kleine Wahrscheinlichkeitsrechnung: Da ich mit 0 Jahren und mit 3 und 5 und 9 Jahren Berndeutsch gesprochen habe, ist es einfach ein bisschen wahrscheinlicher, dass ich solche Wörter brauche und so eine Szenerie «bespiele», als wenn ich im Kongo zur Welt gekommen wäre. Mal abgesehen davon, dass man nicht wüsste, ob ich dann noch leben würde. Also: natürlich ist es mir naheliegender, berndeutsche anstatt chinesischer Worte zu verwenden; natürlich hat meine Sprache ihre Wurzeln dort, wo ich herkomme. Das heisst nun aber nicht, dass man den Emmentaler Krachen mit den Mitteln der chinesischen Sprache nicht genauso treffend klingen lassen könnte wie mit jenen der berndeutschen. Nur habe ich diese Mittel leider nicht zur Verfügung. Ich könnte sie mir aneignen und würde dann mit dem Chinesischen, wie jetzt mit dem Deutschen, suchen und probieren und es hoffentlich schaffen, den Klang für den Berner Krachen zu finden.
Du suchst deine Sprache also sehr aktiv. -Jeremias Gotthelf, der ebenfalls bäuerische Szenerien bespielte und stets zwischen Hochdeutsch und Mundart hin- und herwechselte, beschrieb einen umgekehrten Prozess – er suchte nicht seine Sprache, sondern wurde von ihr gefunden. Gotthelf sagt: «Eigentlich will ich nie im Dialekt schreiben und auf den ersten 20 Seiten wird man wenig davon merken, nachher werde ich dazu gezwungen, ich mag wollen oder nicht.»
Wenn man ein Weltbild hat, das ein bisschen animistischer ist als das, was gegenwärtig als selbstverständlich hingenommen wird, dann ist der Suchprozess der gleiche wie der Findungsprozess von dem, was man sucht – und umgekehrt. Wenn ich suche, werde ich gefunden. Wenn ich finde, werde ich gesucht. Ich hatte schon immer eine solche Idee von Doppelkommunikation; natürlich nicht im Zusammenhang mit Objekthaftem, Gegenständlichem, sondern mit Blick auf ein Wesen, das ich finden will. Um gefunden zu werden, muss sich mir dieses Wesen zuwenden. Es ist eine Zuwendung von zwei Seiten. Was Gotthelf sagt, würde ich sofort unterschreiben. Aber auch er konnte ja nur gefunden werden von seiner Sprache, weil er sich ihr öffnete. Die Sprache schlägt nicht ein wie ein Blitz; man wird nicht automatisch von ihr getroffen, sondern muss von ihr betroffen sein wollen. Dann kommt sie. Sie ist ein scheues Wesen, die Sprache.
Die Sprache, zu der Gotthelf kam, ist eine, die Mundart und Hochdeutsch kombiniert. Mit etwas anderen Mitteln schaffst du im Prinzip etwas Ähnliches, etwas Hybrides, das -hier-zulande selten ist und zuweilen gar als etwas zwar Erstrebenswertes, aber Unrealisier-bares erachtet wird. Guy Krneta sagt: -«Fliessende Übergänge zwischen Dialekt und Hochdeutsch lassen sich kaum bewerkstelligen, es geht nicht, aber es wäre etwas sehr Schönes.»
Was heisst denn fliessend? Fliessend sind Übergänge für mich immer dann, wenn sie klanglich unauffällig sind. Alles, was klanglich auffällig ist, erzeugt dagegen eine stockende Empfindung; die Aufmerksamkeit bleibt dann kurz stehen und muss nachher dem Text hinterherhetzen. Was als auffällig und was als unauffällig erachtet wird, hängt doch aber einzig von der Welt ab, aus der man kommt. Mir fallen englische Wörter in deutschen Texten sofort auf – da stocke ich und denke: Das ist nicht meins. Mundartausdrücke dagegen nehme ich hin, ohne aufzumerken. Gerade bei Gotthelf realisiere ich häufig erst nach ein, zwei Sätzen, dass ein Sprachwechsel stattgefunden hat. Dies, obwohl er in der direkten Rede ganze Passagen in Mundart schreibt. Mir scheint das völlig normal; bruchlos oder flies-send, wenn man will. Denn schliesslich spaziere ich doch seit je mit einer Chimäre an der Leine durch die Welt, mit einem Sprach-geschöpf, in dem Mundart und Hochdeutsch verschmelzen.
Dennoch verwendest du selber eine Form von eingedeutschten Wörtern – etwa treffen sich die Protagonisten «gegen die Achten» und essen «Gehacktes und Hörnlein» – und lässt, anders eben als Gotthelf, das Schweizer-deutsche nicht ungeschützt aufs Hochdeutsche prallen. Nimmst du also, bei aller Durchlässigkeit, auch ein Spannungsverhältnis zwischen den beiden Sprachen wahr? Friedrich Dürrenmatt sah gerade die Schriftsteller in einem solchen leben. Er sagt: «Der deutschschweizerische Schriftsteller bleibt in der Spannung dessen, der anders redet, als er schreibt. Zur Muttersprache tritt gleichsam eine ‹Vatersprache›. Das Schweizerdeutsche als seine Mutter-sprache ist die Sprache seines Gefühls, das Deutsche als seine ‹Vatersprache› die Sprache seines Verstandes, seines Willens, seines Abenteuers.»
Es gibt eine Spannung, aber die Spannung, die mir die Zweisprachigkeit bringt, ist die höhere Bewusstheit für den Einsatz jedes Wortes. Dass ich die Wörter in meinem Text nicht in der Mundart stehenlasse, hat rein klangliche Gründe. Wenn ich ein Mundartwort unverändert in einen deutschen Satz einbaue, stehe ich vor dem Problem, dass es unsinnlich erscheinen würde, und zwar weil es im Rest des Satzes durch keine klangliche Wiederholung seine Legitimität erhielte. Ich behaupte: ein Satz ist dann schön, wenn er sich in seinem Verlauf selber aufgreift und zu einem Ende bringt, und dieses ästhetische Grundgefüge würde durch die Verwendung einzelner «reiner» Mundartworte gestört. Trotzdem erachte ich meine Sprache als total verschmolzene. Klar, wir haben uns angewöhnt, in Kategorien zu denken, auch in der Sprache: hier das Deutsche, der Fisch, der sich windet, und dort die Mundart, der Vogel, der flattert. Aber jede Kategorie ist selber ein Geschöpf und kann sich verändern – bis hin zur Auflösung, denn alles, was wir kennen, ist vergänglich. Und so steht man halt plötzlich vor einem Fischvogel. Oder einem Vogelfisch? Die einzige Sprache, die ich zur Verfügung habe, ist ein Schmelzprodukt. Es entsteht nicht einfach dadurch, dass sich eine Kategorie der anderen aufpfropft, sondern dadurch, dass sich die beiden zusammenschliessen und etwas Neues bilden. Wenn man das weiter- und weiterdenkt und sich vorstellt, dass nochmal und nochmal eine Sprache dazukommt und mitverschmilzt, stünde am Ende ein Wesen, in dem sich alle verstehen – die Ausschüttung des Heiligen Geists. Das ist natürlich schon mein Ziel. Ich habe jetzt aber vorläufig mal nur mit Mundart und Deutsch begonnen. (lacht)
Doch noch der Heilsbringer! Bleibt bloss die Frage, ob die Sprache diese hehren Erwartungen ihrem Wesen nach überhaupt erfüllen kann. Zwischen Mundart und Hochdeutsch mögen sich die Grenzen aufheben, und -meinetwegen mögen sich unserem deutschen Vogelfisch eines Tages auch Suaheli-Zebras und Mars-Idiome angliedern. Wird aber irgendeine Sprache je in der Lage sein, das auszudrücken, was wir eigentlich mitteilen wollen? Max Frisch sagt: «Wichtig ist das Unsagbare, das Weisse zwischen den Worten, und immer reden diese Worte von den -Nebensachen, die wir eigentlich nicht meinen. Unser Anliegen, das Eigentliche, lässt sich -bestenfalls umschreiben, und das heisst ganz wörtlich: man schreibt darum herum. Man umstellt es.» Dass ein derart defizitäres Medium je den Heiligen Geist auszuschütten vermag, würde ich also bezweifeln.
Die Sprache ist so reich, wie sie arm ist. Dass wir das, was wir sagen wollen, nie treffen können, oder greifen oder geschweige denn überhaupt selber begreifen, ich glaube, das ist klar, unbestritten. Und man kann dann natürlich generell über das Unverständnis in der körperlichen Abgeschiedenheit reden oder über die Möglichkeiten zur Überbrückung – gelingt das überhaupt, kann man verschmelzen, wird man mal eins? Ist es die Liebe vielleicht, die einzige Kraft, die das kann, oder gar niemand? Auf dieser Ebene kann die Sprache wenig ausrichten. In anderen Situationen aber erweist sie sich als erstaunlich effizient. Wie würden wir den Austausch, den wir jetzt haben, vollziehen, wenn wir nicht reden könnten? Würden wir im Innersten etwas Ähnliches als Empfindung davontragen, wenn wir uns nur über Klatschgeräusche verständigen würden oder über Berührungen? Ich weiss es nicht. Aber eben, Sprache ist ein Mittel und fast lächerlich armselig, und gleichzeitig ist sie eine Art über sich selbst hinausweisendes Wesen. Und dadurch eben auch ein Wunder.