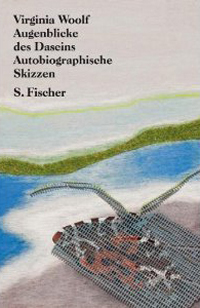«Nehmen wir an, wir haben ein Mammut-Genom…»
Einst schrieb er Romane, heute fasst er Erkenntnisse aus der Wissenschaft in Worte, die jeder versteht. Bestsellerautor Rolf Dobelli erklärt, wie er seine neue Schreibtätigkeit jenseits der Prosa versteht. Und wo die Unterschiede zwischen den Milieus Literatur und Wissenschaft liegen.

Herr Dobelli, Sie haben erfolgreich Romane geschrieben und bringen jetzt – noch erfolgreicher – Ihre Kolumnen in Buchform heraus. «Die Kunst des klaren Denkens» und «Die Kunst des klugen Handelns» halten sich beide hartnäckig in den Sachbuch-Bestsellerlisten. Aber: Was reizt einen Romanautor am Sachbuchschreiben?
Meine gegenwärtige Aufgabe sehe ich darin, das Wissen, das wir in den letzten 30 Jahren auf dem Gebiet der kognitiven und sozialen Psychologie, einer unglaublich interessanten Wissenschaft, über den Menschen gesammelt haben, in eine brauchbare Sprache zu übersetzen. In eine Sprache, die Normalsterbliche verstehen. Ich verfolge also diesen enzyklopädischen Diderot-Ansatz. Das Ziel Denis Diderots war es, in seiner Encyclopédie die Summe des gesamten Wissens seiner Zeit zu versammeln. Ich versuche das zumindest auf einem Gebiet. Und mit getAbstract haben wir’s auch auf dem Gebiet der Wirtschaft gemacht.
Hierzulande wurden die Sachbuchregale lange von Kochbüchern und Pilgerweg-Ratgebern dominiert. Nun machen Sie öffentlichkeitswirksam auf menschliche Denkfehler aufmerksam. Dieses Prinzip ist im englischsprachigen Raum seit geraumer Zeit erfolgreich. Diese Art der Wissensvermittlung hat dort auch eine ungleich längere Tradition als in Europa. Hat Sie Ihre Zeit in den USA dahingehend beeinflusst?
Vielleicht. Das habe ich mir noch nie überlegt. Ich habe lange in Amerika gelebt und so womöglich unbewusst diese Form des Schreibens absorbiert. Ich glaube, diese populärwissenschaftlichen Bücher sind vor allem erfolgreich, weil sie hervorragend geschrieben sind. Tatsache bleibt auch, dass sich amerikanische Wissenschafter irgendwann – und das zu einem relativ frühen Zeitpunkt ihrer Karriere – entscheiden, ein Buch für ein grosses Publikum zu schreiben. Das ist hierzulande leider immer noch Wunschdenken.
Sie sagen, Wissenschafter sollten den Anspruch haben, für ein breites Publikum zu schreiben?
Zumindest dann, wenn sie wollen, dass ihre Arbeit jenseits ihrer Fakultäten etwas auslöst.
Die wenigsten Wissenschafter sind literarisch versiert. Stellen Sie an Ihr «neues» Schreiben denn dieselben Ansprüche an die Sprache wie beim Verfassen eines Prosawerks?
Nein. Das Sätzchenschmieden ist in der Belletristik viel wichtiger als im Sachbuchbereich. Der einzelne Satz muss innovativ und toll sein, bestenfalls einen Wow-Effekt auslösen. In Sachbüchern wollen Sie nicht neue Bilder evozieren wie in der Literatur, wo Sie mit Metaphern neue Realitäten schaffen und neue Gefühle erzeugen. Das wäre schlicht fehl am Platze. Ich pflege in meinen Kolumnen aber immerhin kleine Geschichten oder Vignetten zu erzählen, die die «nackten» Fakten konsumierbarer und eindrücklicher machen. Das braucht es, damit sie sich auch einprägen.
Vermissen Sie das «Sätzchenschmieden» nicht?
(lacht) Doch, doch, ich vermisse das, natürlich. Eine Stunde lang an einem Satz zu feilen, das ist etwas Schönes, in gewissem Sinne Bereicherndes. Ich werde das auch wieder mal tun, aber im Moment macht es keinen Sinn.
Wieso? Das eine schliesst das andere doch nicht aus?
Nein. Aber die Leser warten auf den nächsten «Dobelli» aus der Sachbuchecke, niemand wartet auf meinen nächsten Roman.
Ich helfe ein wenig nach und behaupte: Gerade die kognitive Psychologie würde sich ausserordentlich gut anbieten, um Ihre Erkenntnisse literarisch zu verhandeln, sie also, wie Sie sagen, einprägsam mit einer Geschichte zu verweben. In Ihrem Roman «Himmelreich» haben Sie das zum Teil doch schon gemacht?
Im «Himmelreich» gibt es die beiden Ebenen, wo sich die Phantasiewelt mit der Realität vermischt. Allerdings halte ich das Buch rückblickend nicht für das gelungenste meiner Werke – aus Sicht der Psychologie sind viele darin verhandelte Geschehnisse unhaltbar. Mein bisher letzter Roman, «Massimo Marini», ist mit Blick auf das Handwerk wohl besser verfasst, tritt aber eben mit viel weniger psychologischem Beiwerk an. Da ist es eher die Technik, die als Wissenschaft miteinfliesst. Aber ob es sich wirklich anbietet, wissenschaftliche Fakten über Romane zu vermitteln? Ich weiss es nicht. Natürlich könnte man ein Thema aufgreifen und zu einem Science-Fiction-Roman aufblasen, aber…
Sie kennen sicher «Dino Park» von Michael Crichton, das danach als «Jurassic Park» verfilmt wurde?
Ja. Das ist eine solche Science-Fiction-Geschichte.
Genau. Crichtons Bücher mögen keine besonders anspruchsvollen «Literaturen» sein, aber immerhin: Zuvor wusste niemand etwas von in Bernstein eingeschlossenen Mücken, aus denen man die DNA von Dinosauriern gewinnen könnte – und plötzlich ist diese Möglichkeit im Allgemeinwissen der ganzen westlichen Welt verankert…
Nun, ich würde es lieber direkt wissen wollen: Nehmen wir an, wir haben ein Mammut-Genom. Wie funktioniert das ganz konkret, dass wir daraus ein Mammut züchten können? Man würde das Genom wohl in ein Proteom eines Elefanten einbauen, es von so einem austragen lassen, ein paar Monate zu früh herausholen und in einem Brutkasten ganz auswachsen lassen. Davon sind wir heute vielleicht 5 bis 10 Jahre entfernt. Das interessiert mich vom Fachtechnischen her, aber am Schluss muss eine Geschichte stehen, denn sie ist es, die überlebt, wenn die Theorien dahinter und der Autor längst gestorben sind. Bei Crichton ist es der Urplot «Mensch versus Natur» – eine Neufassung des Melville-Klassikers «Moby Dick», wenn Sie so wollen.
Wenn Sie «die Wissenschaft» nicht als primäres Ideenarsenal für Ihre Prosa betrachten, dann vielleicht ihr Personal: Waren Sie nie versucht, Ihre Freunde aus dem Wissenschaftsbetrieb als Figuren in Ihren Romanen zu verarbeiten?
Das würde ich nie tun.
Das Motiv des Forschers mit unstillbarem Wissensdurst ist keines, das Sie reizt?
Doch, das würde mich durchaus reizen. Die Protagonisten meiner Romane waren aber bisher immer Unternehmer und Manager. Aus gutem Grund: Solche kenne ich aus meinem eigenen Leben, ich war ja selbst einer. Jetzt kenne ich zwar auch viele Wissenschafter und ich denke, die eine oder andere personale Anregung werde ich mir da künftig schon holen. Nur: das kann man nicht planen. So eine Idee entsteht durch Nachdenken, aber ich denke zurzeit überhaupt nicht an einen Roman. In diese Literaturwelt kam ich generell auch eher zufällig. Die Liebe zu Büchern war zwar schon immer da, aber das Schreiben kam effektiv aus dieser 35er-Krise – der Quarter Life Crisis, unter der ja viele Menschen leiden, die wissenschaftlich aber lustigerweise immer noch nicht untersucht ist.
Die haben Sie produktiv überwunden, inzwischen sind Sie etablierter Schriftsteller…
…das hat aber gedauert! Zu Beginn musste ich in der Freizeit schreiben und war unterwegs auf Lesereise. Mein Verleger, Daniel Keel, hat immer zu mir gesagt: «Herr Dobelli, Bremgarten! Bremgarten! – Lesen Sie in so Käffern wie Bremgarten, nicht in grossen Städten. Gehen Sie raus, da hat man Zeit für Sie. Und machen Sie viele Lesungen. So bilden Sie eine Community von Lesern.» (lacht) Er ist immer mit dem Bremgarten-Beispiel gekommen. Und ich habe das viele Jahre lang gemacht. Stellen Sie sich das so vor: Man fährt nach Aarau, hält seine Lesung vor vier Leuten, verdient seine 200 Fränkli und fährt wieder zurück. Das ist auf lange Sicht schon betrüblich, dieses Leben, man muss wohl wirklich für diesen Kuchen gemacht sein.
Also: Ein gutes Netz aus Gleichgesinnten haben, meinen Sie?
Vielleicht. Das hatte ich aber nie. Als Mann aus der Wirtschaft war ich in der Literaturszene immer ein Aussenseiter. Man wird als Unternehmer in der Belletristik nicht recht aufgenommen, weil man vielleicht einen anderen Zugang oder Habitus hat. Aber ich wollte das auch nicht unbedingt. Sie wissen schon: Bier trinken mit Peter Bichsel in Solothurn im «Kreuz». (lacht) Das würde mir nicht viel geben. So richtig spürt man es aber bei den Rezensionen von Leuten, die selbst auch schreiben. Die können sehr reserviert, wenn nicht gar feindselig werden, wenn einer von aussen kommt, der keine Literatur studiert hat, sondern an der HSG war.
Aber das ist doch auch im Wissenschaftsbetrieb so. Konkurrenz ist nicht gemütlich – belebt aber das Geschäft!
Nein, da muss ich Sie korrigieren. Unter den Wissenschaftsautoren habe ich sehr viele Freunde. Wahre Freunde.
Woran liegt das? Gewinnt man mit Fakten leichter Freunde als mit dem Erzählen?
Nun, innerhalb eines Fachgebietes kann es durchaus auch zu solchen Unstimmigkeiten kommen. Jeder Astrophysiker weiss, wer weltweit die Nummer eins, wer die Nummer zwei ist etc. Aber wenn wir ZURICH.MINDS nehmen: in dieser Community leidet einfach keiner unter Statusangst und dem Druck, jemandem etwas beweisen zu müssen. Jeder ist auf seinem Gebiet herausragend und weiss das auch. Unter Schriftstellern der Belletristik ist das eine ganz andere Geschichte. Es wird hinter vorgehaltener Hand gesprochen über Verträge mit Verlagen, Literaturpreise und Stadtschreiberstellen. Da gibt es unglaubliche Neidgeschichten und Statuskämpfe – und ich glaube, das macht den Unterschied zwischen den beiden Milieus aus. Aber: ich habe meine Standbeine in beiden Betrieben – und das bleibt auch sicher künftig so.