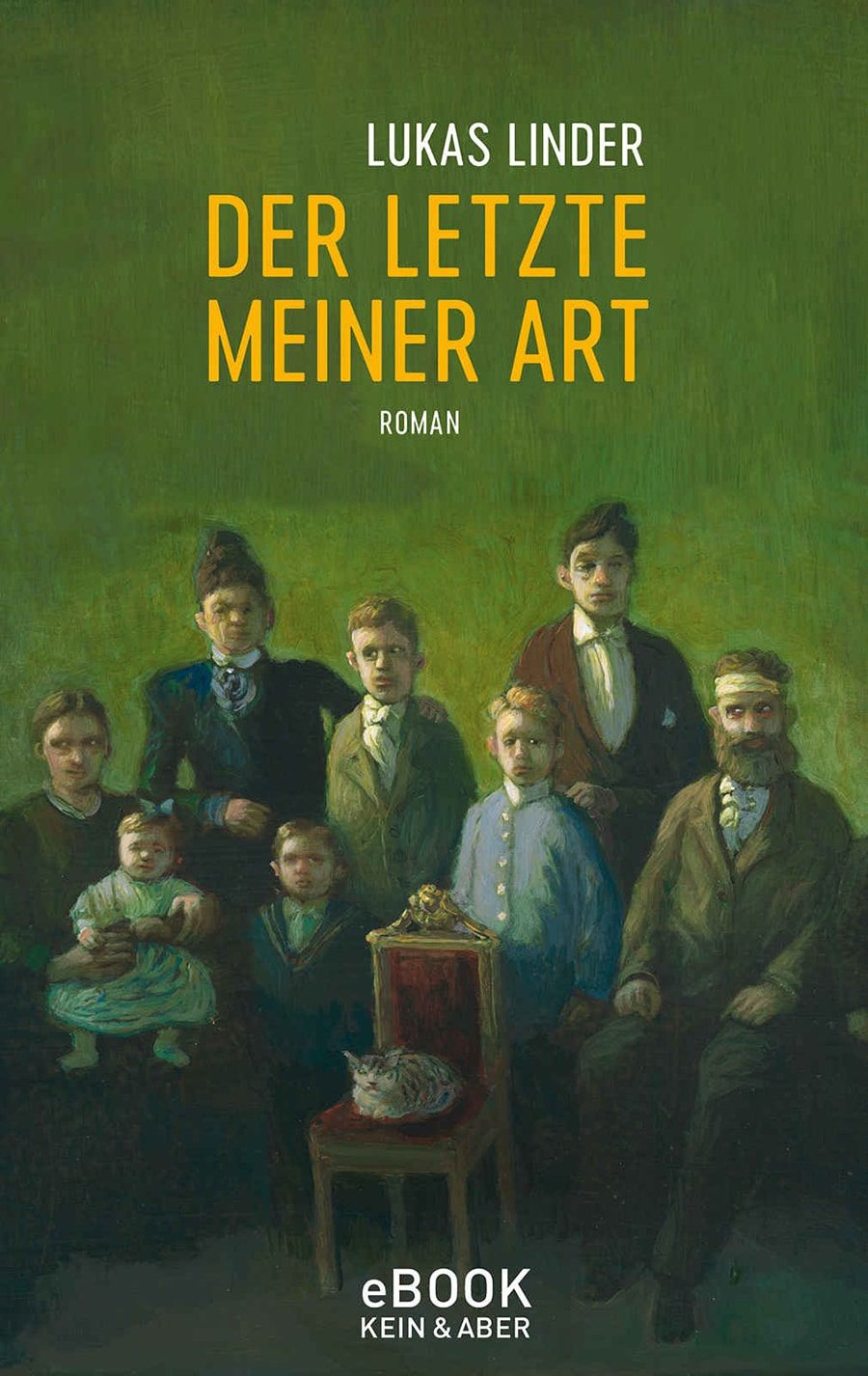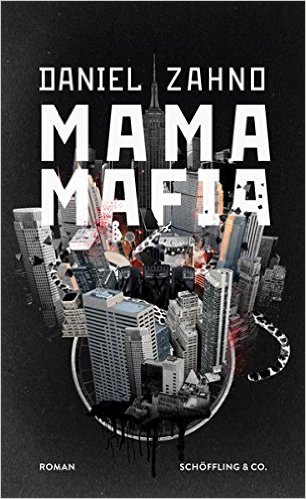Die versteckte Expertokratie
Ökonomie und Literatur: der Philosoph und Schriftsteller Jonas Lüscher über gefährliche Geschichten, den irritierenden Zahlenkult in Wirtschaft und Gesellschaft – und über Tiefkühlprodukte von erschütternder Sinnlosigkeit.

Herr Lüscher, Sie setzen sich in Ihrer Novelle «Frühling der Barbaren» mit einem fiktiven Staatsbankrott auseinander: ein heikles, hochaktuelles Thema. Wie viele Ökonomen haben Sie konsultiert, bevor Sie zu schreiben begannen?
(lacht) Wenige. Als Geisteswissenschafter neige ich eher dazu, in die Bibliotheken zu gehen und mich lesend zu informieren. Und natürlich sind die Wirtschaftsteile der Zeitungen eine wichtige Quelle. Da es aber in meiner Novelle nur am Rande darum geht, wie ein Staatsbankrott abläuft, beschäftigte ich mich eher mit der Freizeitgestaltung von Investmentbankern. Die spielen in «Frühling der Barbaren» nämlich eine zentrale Rolle.
Wie sind Sie da vorgegangen?
Eine interessante Quelle waren Webseiten mit Lifestyle- und Partytips für Cityboys. Oder auch Blogs, in denen sich Investmentbanker ganz freimütig über Boni, Bars, Anzüge und Autos austauschen. Dann entstammt aber vieles auch einfach meiner Vorstellung – oder ich spiele als Autor ganz offen mit Klischees, so wie es im übrigen viele der jungen Leute, die in diesem Geschäft sind, auch tun. Man muss sich klarmachen, dass das sehr junge Menschen sind, die von der Uni kommen und sich dann in diese Strukturen hineinbegeben. Ich kann mir vorstellen, dass sich das für viele anfühlt, als würden sie eine Rolle übernehmen. Und dann bedienen sie sich eben der Codes, die sie vorfinden. Die wenigen Quellen, die ich persönlich sprechen konnte, haben mir auch bestätigt, dass zum Beispiel das «work hard, play hard» exzessiv gelebt wird und mehr ist als nur ein Klischee. Oder wie es Sanford, der alternde Soziologe in meinem Buch, ausdrückt: es ist beeindruckend, welche Energie diese Leute darauf verwenden, die Klischees zu erfüllen.
Die Finanzkrise und der Staatsbankrott Englands dienen in Ihrer Novelle eher als dramatische Kulisse, vor der sich die eigentliche Tragödie abspielt?
Richtig. In erster Linie erzähle ich nämlich die Geschichte eines Mannes, der sich nicht als Handelnder verstehen kann.
Sie wollten also keinen Roman zur Finanzkrise schreiben?
Den Finanzkrisenroman gibt es nicht. Und wenn es ihn gäbe, so wäre er wohl von vornherein von eher zweifelhafter Qualität.
Wieso?
Weil Literatur nicht so funktioniert. Literatur beschreibt Einzelfälle und als Beschreibung von Einzelfällen sollten wir sie auch lesen. Wir neigen dazu, Erzählungen von Einzelfällen als exemplarisch für einen viel zu grossen Bereich zu lesen.
Konkreter, bitte. Wie funktioniert Literatur, wenn nicht exemplarisch?
Auf ganz vielfältige Art und Weise, muss eigentlich die etwas unbefriedigende Antwort lauten. (lacht) Aber was mich am meisten interessiert, ist eben die Literatur als Beschreibung von spezifischen Einzelfällen: von kontingenten Geschichten, die wir dann mit anderen Erzählungen von ebenso kontingenten Einzelfällen in Bezug setzen können. Je mehr solcher Geschichten wir kennenlernen, desto enger können wir unser Netz knüpfen und so nach und nach zu ganz dichten Beschreibungen kommen.
Wir lesen also den «Frühling der Barbaren», John Lanchesters «Capital», die Blogs von Greg Mankiw, die Essays von Deirdre McCloskey, «Buddenbrooks» von Thomas Mann, einige andere – und wissen irgendwann mehr über Ökonomie, als uns der Wirtschaftsteil der NZZ über dieselbe Zeit beigebracht hätte?
Ja, wobei es natürlich wichtig ist, auch den Wirtschaftsteil der NZZ zu lesen, da er auch eine Facette dieser dichten Beschreibung ist. (lacht) Und dann am besten auch noch den Wirtschaftsteil einer Zeitung mit einer konträren politischen Ausrichtung. Aber damit sind wir mit dem Lesepensum noch nicht am Ende. Denn es empfiehlt sich, auch noch Narrationen zu berücksichtigen, die zunächst mit unserer ökonomischen Welt nichts zu tun haben – damit wir überhaupt in der Lage sind, den ökonomischen Komplex in unsere weitere Lebenswelt einzuordnen. In Anlehnung an den deutschen Philosophen Wilhelm Schapp würde ich sagen: Wir sollen uns in Geschichten verstricken.
Das alte Konzept der guten Allgemeinbildung: die Diversität der Welt in ihren vielen Formen möglichst bewusst aufnehmen, um aufgrund dieser Basis gute Entscheidungen treffen zu können. So gesehen: nichts Neues.
Nein, im Grunde genommen nichts Neues, aber eben eine heute dringend nötige Erinnerung daran, dass es unterschiedliche Weltbetrachtungen gibt und der szientistische, der empirische, quantitativ-mathematische Zugang zu Wissen über die Welt nur einer unter anderen ist. Auch Narrationen sollen als Quellen von autoritativem Wissen verstanden werden.
Sie sprechen von Narrationen…
…und ich verwende den Begriff relativ frei und umfassend, ja. Narrationen sind erzählte Geschichten. Das können Romane sein, Zeitungsartikel, mündliche Überlieferungen, Filme, aber auch Fernsehsendungen. Fiction und Nonfiction.
Sie stellen diese Narrationen den Computermodellen der Ökonomie gegenüber und behaupten nun, wir sollten uns als Gesellschaft wieder vermehrt auf die Narrationen verlassen?
Grundsätzlich glaube ich, dass wir einer Art «Quantitativer Verblendung» unterliegen, wie die italienische Soziologin Elena Esposito geschrieben hat. Mathematische Modelle sind ein wunderbares Werkzeug, wenn es um die Beschreibung komplexer Systeme ohne menschliche Agenten geht. Kommt aber eine soziale Dimension dazu, sehen wir uns mit einigen Nachteilen dieser Methode konfrontiert. Nachteile, derer wir uns bewusst sein sollten und denen, zumindest zum Teil, durch narrative Beschreibungen ausgewichen werden kann.
Von welchen Nachteilen sprechen Sie ganz konkret?
Etwas verkürzt kann man sagen, dass die Komplexität der Pro-bleme sprunghaft ansteigt, wenn menschliche Agenten ins Spiel kommen. Die Modelle müssen deswegen extrem vereinfachen. Einige dieser Vereinfachungen, zum Beispiel der Homo oeconomicus, die Annahme rationaler Agenten, haben dann schlichtweg nicht mehr viel mit der Realität zu tun.
Die Idee des Homo oeconomicus war aber doch auch in der Ökonomie nie unumstritten.
Das stimmt. Aber einige Wissenschafter glauben bis heute, man könne dieser Kritik mit noch komplexeren Modellen begegnen. Das führt direkt zum nächsten Problem: Kaum jemand ist noch in der Lage, diese Modelle zu verstehen. Vor allem nicht die Entscheidungsträger in Wirtschaft und Politik. Wir haben es also mit einer versteckten Expertokratie zu tun. Zudem haben dieses und andere Modelle bis heute den Nimbus der strengen Wissenschaftlichkeit, der Objektivität. Dabei geht vergessen, dass im Modellierungsprozess extrem viele normative Entscheidungen getroffen werden können. Die Narrationen dagegen sind ganz offensichtlich normativ, ihnen begegnet man deshalb auch glücklicherweise kritischer.
Mich erinnert Ihr Ansatz an Tomáš Sedláčeks «Die Ökonomie von Gut und Böse». Der tschechische Ökonom vertritt eine ähnliche These wie Sie, redet aber dezidiert von den grossen Mythen und den grossen Geschichten der Menschheit, die – in seinem Fall – angeblich mehr ökonomisches Wissen bereithalten, als viele zeitgenössische Fakultäten produzieren.
Diese Einschränkung finde ich aber problematisch. Diese grossen Mythen sind oft das, was der deutsche Philosoph Odo Marquard als «Monomythen» bezeichnet, vor denen er aus guten Gründen warnt. Mythen also, die keine anderen Geschichten neben sich zulassen, die einen Alleinerklärungsanspruch geltend machen. Sie wollen exemplarisch gelten und nicht bloss Beschreibungen von Einzelfällen sein. Sie zielen auf das Allgemeine, Notwendige. Zudem haben sie auch einen elitären Zug. Sie schliessen neuere und populäre Erzählformen und Narrative aus. Kennen Sie die US-Fernsehserie «The Wire»? Diese Sendung ersetzt eine Vielzahl aufwendiger Studien zur Lage der postindustriellen amerikanischen Stadt. Und wer «Mad Men» schaut, gewinnt einen wunderbaren Einblick in die Verhältnisse des städtischen Amerikas der 1960er Jahre. Mir wurde zum Beispiel beim Schauen von «Mad Men» plötzlich bewusst, und zwar auf eine ganz unmittelbare, präsente Art, wie sehr doch die Befreiung der Frau auch eine Befreiung des Mannes war. Einfach dadurch, dass diese asymmetrische Beziehung jener Zeit, bei der Betty von Donald mehr oder weniger wie ein weiteres Kind behandelt wird und er in dieser dann auch ganz einsamen Rolle des starken Ernährers feststeckt, so plastisch erzählt wird.
Das Herstellen dieser subjektiv erfahrbaren Präsenz von komplizierten Sachverhalten ist also die Stärke – aber auch das potentiell Gefährliche der Narration. Man denke etwa an die Propaganda totalitärer Systeme.
Genau. Es gibt auch die, die gefährlich sind. Die ausgesprochen wirkmächtigen Narrative der Nationalsozialisten – oder auch anderer totalitärer Systeme – sind ein gutes Beispiel für gefährliche Narrative. Aber sie alle haben eines gemeinsam: Sie sind ausgesprochen monomythisch.
Sie akzeptieren keine alternativen Erzählungen neben sich…
…sondern beanspruchen stattdessen exemplarische Geltung und wollen nicht nur einen kontingenten Einzelfall beschreiben. Wenn eine Erzählung nach Monomythos riecht, dann sollten wir also sofort skeptisch werden. Ein gutes Beispiel ist auch «Atlas Shrugged» von Ayn Rand, über das letzthin im «Schweizer Monat» debattiert wurde. Das ist auch eine solch monomythische Erzählung: Es geht hier nur um den einsamen, starken, unabhängigen Helden, um einen simplen Archetypen. Alles andere wird nicht erzählt oder – falls doch – diesem Mythos geopfert. Damit werden Horizonte nicht geöffnet, sondern geschlossen. Und das sollte Literatur nicht tun. Mir gefällt also die Unterscheidung zwischen nützlichen und gefährlichen Beschreibungen. Nützliche Beschreibungen dienen immer einer besseren Zukunft, wie der Philosoph Richard Rorty einmal geschrieben hat. Und diese bessere Zukunft ist eine mit weniger Schmerz und weniger Demütigung für alle.
Schmerz und Demütigung, das sind zwei gute Stichwörter, denn von beiden wimmelt es in Ihrer Novelle. Sie selbst brauchen in Ihrer Figurenzeichnung auch extrem viele Klischees: Die Banker im «Frühling der Barbaren» sind alle geldgeil, der Schweizer ist etwas sehr neutral, der Soziologieprofessor weiss, wie Gesellschaften ticken, hat aber keine Ahnung, wie er mit seiner Frau umgehen soll… hier finden sich eigentlich nur plakative Durchschnittstypen, die am Ende gemeinsam in den Untergang schlittern. Wieso?
Nun, ich glaube, das Wichtige ist, dass sie auf ganz unterschiedliche Art und Weise auf den Zusammenbruch reagieren. Aber Sie haben natürlich recht, ich spiele da sehr mit Klischees. Zum einen hat meine Novelle den Charakter einer Versuchsanordnung, in der ich verschiedene Mi-lieus aufeinandertreffen lasse. Zum anderen dienen meine Figuren auch als Projektionsfläche, die den Leser im besten Fall sein eigenes Klischeedenken reflektieren lässt. Und natürlich hoffe ich, dass das manchmal etwas Holzschnittartige zum ironischen Grundton der Novelle passt.
Der Leser findet sich in derselben Lage wieder wie alle Protagonisten des Buches. Er sagt sich, sobald dann das Finanzsystem literarisch zusammenbricht: «Ich habe es ja schon immer gewusst!» Aber: Sollte da nicht mehr sein?
So war es doch! Die Krise kam doch 2007 nicht wirklich überraschend. In meinem Bekanntenkreis war man sich bereits davor – unter den ökonomischen Laien – vollkommen einig, dass im Finanzsystem etwas schiefläuft. Dass das doch alles irgendwie nur virtuelle Werte sind, mit Wertschöpfung im traditionellen Sinn wenig zu tun hat. Wir fühlten uns alle an ein Schneeballsystem oder einen grossen Bluff erinnert. Aber das Gefühl war ein diffuses, mehr eine Intuition. Wenn ich mich in dieser Art geäussert habe, dann immer mit einem schlechten Gefühl. Vielleicht, so dachte ich, verstehe ich einfach zu wenig von der Sache. Die Intuition erwies sich aber in erschreckender Weise als richtig.
Und warum, glauben Sie, war es ausgerechnet der Laie, der Durchschnittsbürger, der «schon immer geahnt hat, dass das passieren wird», wie es ihn Ihrem Buch heisst?
Das ist eine interessante Frage und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie sie zu beantworten ist. Es ist natürlich interessant, dass dann doch viele bereit waren, ihre Bedenken in den Wind zu schiessen, als die Kaupthing Bank 6 Prozent Zinsen angeboten hat. Was aber die Leute innerhalb des Systems angeht, die Trader und Analysten, da habe ich zwei Vermutungen: Zum einen ist es möglich, dass die meisten dieselben Bedenken hatten, es ihnen aber gelungen ist, sie beiseite zu wischen, weil das Geld ja geflossen ist, und an übermorgen wollte man erst mal nicht denken. Es ist aber auch möglich, dass sie tatsächlich gedacht haben, ihre Modelle würden funktionieren. Das wäre dann eine Art von Betriebsblindheit. Sie wussten ja, so hoffe ich zumindest, wie ihr einzelnes Produkt – sowieso eine seltsame Terminologie – funktioniert, konnten also «das grosse Ganze» gut aus dem Auge verlieren und sich mit ihrem kleinen, beschränkten Modell auf der sicheren Seite fühlen. Der Laie hat diese Möglichkeit nicht. Er kann nur, sozusagen aus der Ferne, auf das grosse, verwirrende Ganze starren und dabei ein Gefühl, eine Intuition entwickeln. Diese Intuition muss nicht immer richtig sein. Aber in unserem Fall war sie das.
Die Intuition mag, was das Ende, die grosse Krise also, angeht, richtig gewesen sein. Über die Ursachen der Krise streiten Ökonomen wie Laien aber bis heute. Und es gab doch einige Wissenschafter, die auf Gefahren wie zu niedrige Zinsen und damit einhergehende Klumpenrisiken bei abzuzahlenden Krediten hingewiesen haben. Sie machen es sich also zu einfach.
Die Risikoprognose ist ja sozusagen das Kerngeschäft der modernen Ökonomie. Man versucht vorauszusehen, wie die Zukunft, die da auf uns zukommt, aussehen wird. Dass man diese Zukunft mit der Prognose natürlich bereits verändert, wird von zu wenigen beachtet. Das wichtige Problem scheint mir aber von noch viel grundlegenderer Natur. Die Frage nach den kommenden Risiken ins Zentrum unserer Bemühungen zu stellen, ist nämlich möglicherweise gar keine besonders gute Idee. Denn das ist immer eine Frage danach, wie unsere Zukunft aussehen wird. Dabei wird die Frage vernachlässigt, in welcher Zukunft wir eigentlich leben wollen. Ich spreche von dem Unterschied zwischen «Zukunft vorfinden» und «Zukunft erfinden».
Und das wiederum hat dann ganz viel mit dem Handeln und Nichthandeln zu tun, dem eigentlichen Thema Ihrer Novelle.
Ja, weil uns gegenwärtig gerne erzählt wird, dass die Zukunft ein abgeschlossener Horizont sei, an dem vor allem grosse Risiken auf uns warteten. Handlungsspielräume gibt es da keine mehr. Und deswegen kann Frau Merkel von der Alternativlosigkeit ihrer Massnahmen sprechen, eine Sprechweise, die – gerade aus dem Mund einer Regierungschefin – den Rahmen des Demokratischen verlässt.
Und wie, stellen Sie sich vor, würde eine Ökonomie aussehen, die sich diese Frage nach der Zukunft, in der wir leben wollen, stellen würde?
Ziemlich anders. Würden sich die jungen Ökonomen die Frage ernsthaft stellen, hätten die Banken Nachwuchssorgen. Es ist eine Frage, die weit über das hinausgeht, was wir normalerweise mit dem Begriff des ehrbaren Kaufmanns oder der Corporate Responsibility, wie das heute genannt wird, verbinden.
Können Sie das anhand eines Beispiels erläutern?
Ja. Kennen Sie diese Fertighotdogs, die in Deutschland im Supermarkt zu kaufen sind? Ein in eine grössere Menge Plastik eingeschweisstes Objekt aus einer Art Brot, dazwischen eingeklemmt ein runzliges Würstchen, mit einer vertrockneten Senfschlange verziert. Man macht das in der Mikrowelle warm. Ein Produkt von erschütternder Sinnlosigkeit. Dieser Convenience Hotdog würde aus den Kühlregalen verschwinden.
Er existiert heute also, weil sich die Konsumenten die falschen Fragen stellen. Das ist eine recht abschätzige Bewertung, finden Sie nicht?
Ich spreche aber gar nicht vom Konsumenten. Es geht mir in dieser Frage ganz dezidiert um den Produzenten. Hinter diesem Produkt steckt eine Geschichte. Die Geschichte eines Mannes, der sich diesen Hotdog ausgedacht hat. Es gibt irgendwo einen Mann, der sich gedacht hat: Es wäre schön, wenn ich mir mein Leben mit der Produktion dieser runzligen Hotdogs finanzieren könnte. Das ist eine traurige Geschichte. Das Problem ist, dass viele Menschen heute diese Geschichte nicht traurig finden. Nicht wenn unser Geschäftsmann mit seinen Hotdogs reich wird. Wirtschaftlicher Erfolg verleiht sogar dem Produzenten eines Fertighotdogs eine gewisse Sexieness. Solche Geschichten werden sich die Menschen hoffentlich irgendwann nicht mehr erzählen.
Die Forderung nach der Frage, in welcher Zukunft wir leben wollen, klingt zwar charmant – aber auch ziemlich naiv. Haben Sie denn eine konkrete Vorstellung davon, wie man dieser Art Fragen mehr Bedeutung verleihen könnte?
Nein, leider nur sehr begrenzt. Es geht dabei um eine Verschiebung von Prioritäten und es geht vor allem um ein anderes Sprechen. Dabei kommt wieder die Narration und die quantitative Verblendung ins Spiel. Einer der Gründe, weshalb wir uns als Gesellschaft so sehr auf mathematische quantitative Methoden verlassen, ist der, dass sich damit den Dingen ein Wert zuweisen lässt. Ein numerischer Wert, der sich aber eben auch als monetärer Wert lesen lässt. Gegenwärtig gibt es Versuche, die erstaunlichsten Dinge einzupreisen. Glück, Leben, Wissen… Ethische Fragen lösen wir gerne mit einer Kosten-Nutzen-Analyse. Das ist keine monokausale Erscheinung. Es ist also nicht nur der sogenannte Kapitalismus, der das quantitative Denken begünstigt, sondern auch umgekehrt. In einer narrativen Gesellschaft würden wir mit einem anderen Vokabular über diese Dinge sprechen. Numerische Werte würden eine geringere Rolle spielen. Ganz wichtig ist aber auch, dass wir das «Wir» in der Frage ernst nehmen.
Ich behaupte: das «Wir» hat dauerhaft Hochkonjunktur. Jedenfalls in der politischen Sphäre – der Begriff der «Solidarität» ist doch gerade deshalb so ausgeleiert. Was sollen wir ihm noch abgewinnen?
Nur weil ein Begriff ausgeleiert ist, bedeutet das ja nicht, dass wir das damit bezeichnete Handeln aufgeben sollten. Das «Wir» sollten wir möglichst gross fassen. Und dabei, das ist auch eine Idee von Richard Rorty, sind wieder die Narrationen hilfreich. Narrationen helfen mir dabei, den anderen nicht als einen von jenen, sondern als einen von uns zu sehen. Indem wir verschiedene Lebensmodelle kennenlernen, fangen wir an zu verstehen, inwiefern andere leiden oder gedemütigt werden – und wir verstehen, dass uns vielleicht doch mehr verbindet als trennt.
Das klingt nun wieder so schön idealistisch. Haben Sie keine konkrete umsetzbare Idee?
Doch: wir sollten in unseren Bildungsinstitutionen dem Beschreiben die gleiche Bedeutung einräumen wie dem Erklären.